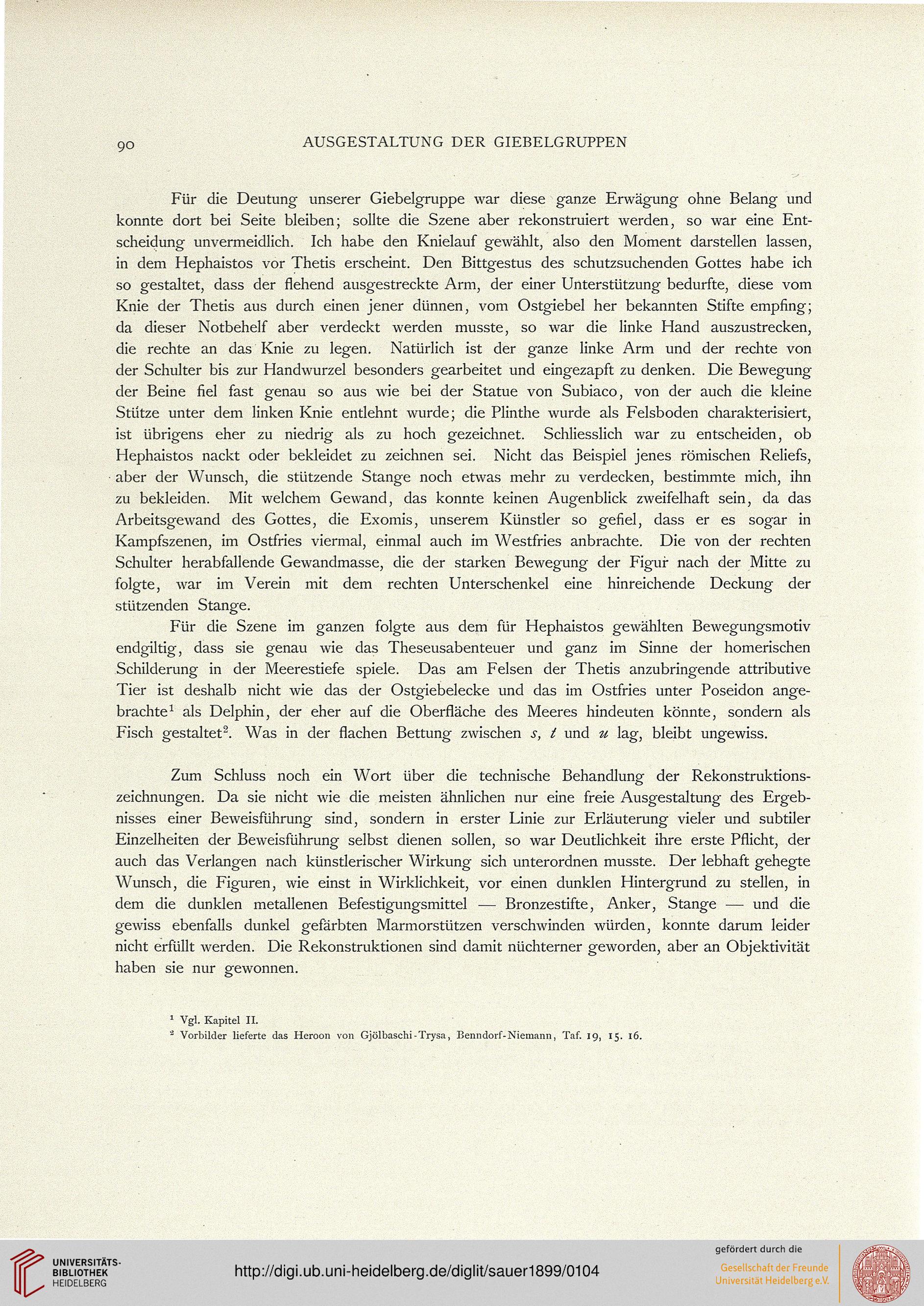90
AUSGESTALTUNG DER GIEBELGRUPPEN
Für die Deutung unserer Giebelgruppe war diese ganze Erwägung ohne Belang und
konnte dort bei Seite bleiben; sollte die Szene aber rekonstruiert werden, so war eine Ent-
scheidung unvermeidlich. Ich habe den Knielauf gewählt, also den Moment darstellen lassen,
in dem Hephaistos vor Thetis erscheint. Den Bittgestus des schutzsuchenden Gottes habe ich
so gestaltet, dass der flehend ausgestreckte Arm, der einer Unterstützung bedurfte, diese vom
Knie der Thetis aus durch einen jener dünnen, vom Ostgiebel her bekannten Stifte empfing;
da dieser Notbehelf aber verdeckt werden musste, so war die linke Hand auszustrecken,
die rechte an das Knie zu legen. Natürlich ist der ganze linke Arm und der rechte von
der Schulter bis zur Handwurzel besonders gearbeitet und eingezapft zu denken. Die Bewegung
der Beine fiel fast genau so aus wie bei der Statue von Subiaco, von der auch die kleine
Stütze unter dem linken Knie entlehnt wurde; die Plinthe wurde als Felsboden charakterisiert,
ist übrigens eher zu niedrig als zu hoch gezeichnet. Schliesslich war zu entscheiden, ob
Hephaistos nackt oder bekleidet zu zeichnen sei. Nicht das Beispiel jenes römischen Reliefs,
aber der Wunsch, die stützende Stange noch etwas mehr zu verdecken, bestimmte mich, ihn
zu bekleiden. Mit welchem Gewand, das konnte keinen Augenblick zweifelhaft sein, da das
Arbeitsgewand des Gottes, die Exomis, unserem Künstler so gefiel, dass er es sogar in
Kampfszenen, im Ostfries viermal, einmal auch im Westfries anbrachte. Die von der rechten
Schulter herabfallende Gewandmasse, die der starken Bewegung der Figur nach der Mitte zu
folgte, war im Verein mit dem rechten Unterschenkel eine hinreichende Deckung der
stützenden Stange.
Für die Szene im ganzen folgte aus dem für Hephaistos gewählten Bewegungsmotiv
endgiltig, dass sie genau wie das Theseusabenteuer und ganz im Sinne der homerischen
Schilderung in der Meerestiefe spiele. Das am Felsen der Thetis anzubringende attributive
Tier ist deshalb nicht wie das der Ostgiebelecke und das im Ostfries unter Poseidon ange-
brachte1 als Delphin, der eher auf die Oberfläche des Meeres hindeuten könnte, sondern als
Fisch gestaltet2. Was in der flachen Bettung zwischen s, t und u lag, bleibt ungewiss.
Zum Schluss noch ein Wort über die technische Behandlung der Rekonstruktions-
zeichnungen. Da sie nicht wie die meisten ähnlichen nur eine freie Ausgestaltung des Ergeb-
nisses einer Beweisführung sind, sondern in erster Linie zur Erläuterung vieler und subtiler
Einzelheiten der Beweisführung selbst dienen sollen, so war Deutlichkeit ihre erste Pflicht, der
auch das Verlangen nach künstlerischer Wirkung sich unterordnen musste. Der lebhaft gehegte
Wunsch, die Figuren, wie einst in Wirklichkeit, vor einen dunklen Hintergrund zu stellen, in
dem die dunklen metallenen Befestigungsmittel — Bronzestifte, Anker, Stange — und die
gewiss ebenfalls dunkel gefärbten Marmorstützen verschwinden würden, konnte darum leider
nicht erfüllt werden. Die Rekonstruktionen sind damit nüchterner geworden, aber an Objektivität
haben sie nur gewonnen.
1 Vgl. Kapitel II.
2 Vorbilder lieferte das Heroon von Gjölbaschi-Trysa, Benndorf-Niemann, Taf. 19, 15. 16.
AUSGESTALTUNG DER GIEBELGRUPPEN
Für die Deutung unserer Giebelgruppe war diese ganze Erwägung ohne Belang und
konnte dort bei Seite bleiben; sollte die Szene aber rekonstruiert werden, so war eine Ent-
scheidung unvermeidlich. Ich habe den Knielauf gewählt, also den Moment darstellen lassen,
in dem Hephaistos vor Thetis erscheint. Den Bittgestus des schutzsuchenden Gottes habe ich
so gestaltet, dass der flehend ausgestreckte Arm, der einer Unterstützung bedurfte, diese vom
Knie der Thetis aus durch einen jener dünnen, vom Ostgiebel her bekannten Stifte empfing;
da dieser Notbehelf aber verdeckt werden musste, so war die linke Hand auszustrecken,
die rechte an das Knie zu legen. Natürlich ist der ganze linke Arm und der rechte von
der Schulter bis zur Handwurzel besonders gearbeitet und eingezapft zu denken. Die Bewegung
der Beine fiel fast genau so aus wie bei der Statue von Subiaco, von der auch die kleine
Stütze unter dem linken Knie entlehnt wurde; die Plinthe wurde als Felsboden charakterisiert,
ist übrigens eher zu niedrig als zu hoch gezeichnet. Schliesslich war zu entscheiden, ob
Hephaistos nackt oder bekleidet zu zeichnen sei. Nicht das Beispiel jenes römischen Reliefs,
aber der Wunsch, die stützende Stange noch etwas mehr zu verdecken, bestimmte mich, ihn
zu bekleiden. Mit welchem Gewand, das konnte keinen Augenblick zweifelhaft sein, da das
Arbeitsgewand des Gottes, die Exomis, unserem Künstler so gefiel, dass er es sogar in
Kampfszenen, im Ostfries viermal, einmal auch im Westfries anbrachte. Die von der rechten
Schulter herabfallende Gewandmasse, die der starken Bewegung der Figur nach der Mitte zu
folgte, war im Verein mit dem rechten Unterschenkel eine hinreichende Deckung der
stützenden Stange.
Für die Szene im ganzen folgte aus dem für Hephaistos gewählten Bewegungsmotiv
endgiltig, dass sie genau wie das Theseusabenteuer und ganz im Sinne der homerischen
Schilderung in der Meerestiefe spiele. Das am Felsen der Thetis anzubringende attributive
Tier ist deshalb nicht wie das der Ostgiebelecke und das im Ostfries unter Poseidon ange-
brachte1 als Delphin, der eher auf die Oberfläche des Meeres hindeuten könnte, sondern als
Fisch gestaltet2. Was in der flachen Bettung zwischen s, t und u lag, bleibt ungewiss.
Zum Schluss noch ein Wort über die technische Behandlung der Rekonstruktions-
zeichnungen. Da sie nicht wie die meisten ähnlichen nur eine freie Ausgestaltung des Ergeb-
nisses einer Beweisführung sind, sondern in erster Linie zur Erläuterung vieler und subtiler
Einzelheiten der Beweisführung selbst dienen sollen, so war Deutlichkeit ihre erste Pflicht, der
auch das Verlangen nach künstlerischer Wirkung sich unterordnen musste. Der lebhaft gehegte
Wunsch, die Figuren, wie einst in Wirklichkeit, vor einen dunklen Hintergrund zu stellen, in
dem die dunklen metallenen Befestigungsmittel — Bronzestifte, Anker, Stange — und die
gewiss ebenfalls dunkel gefärbten Marmorstützen verschwinden würden, konnte darum leider
nicht erfüllt werden. Die Rekonstruktionen sind damit nüchterner geworden, aber an Objektivität
haben sie nur gewonnen.
1 Vgl. Kapitel II.
2 Vorbilder lieferte das Heroon von Gjölbaschi-Trysa, Benndorf-Niemann, Taf. 19, 15. 16.