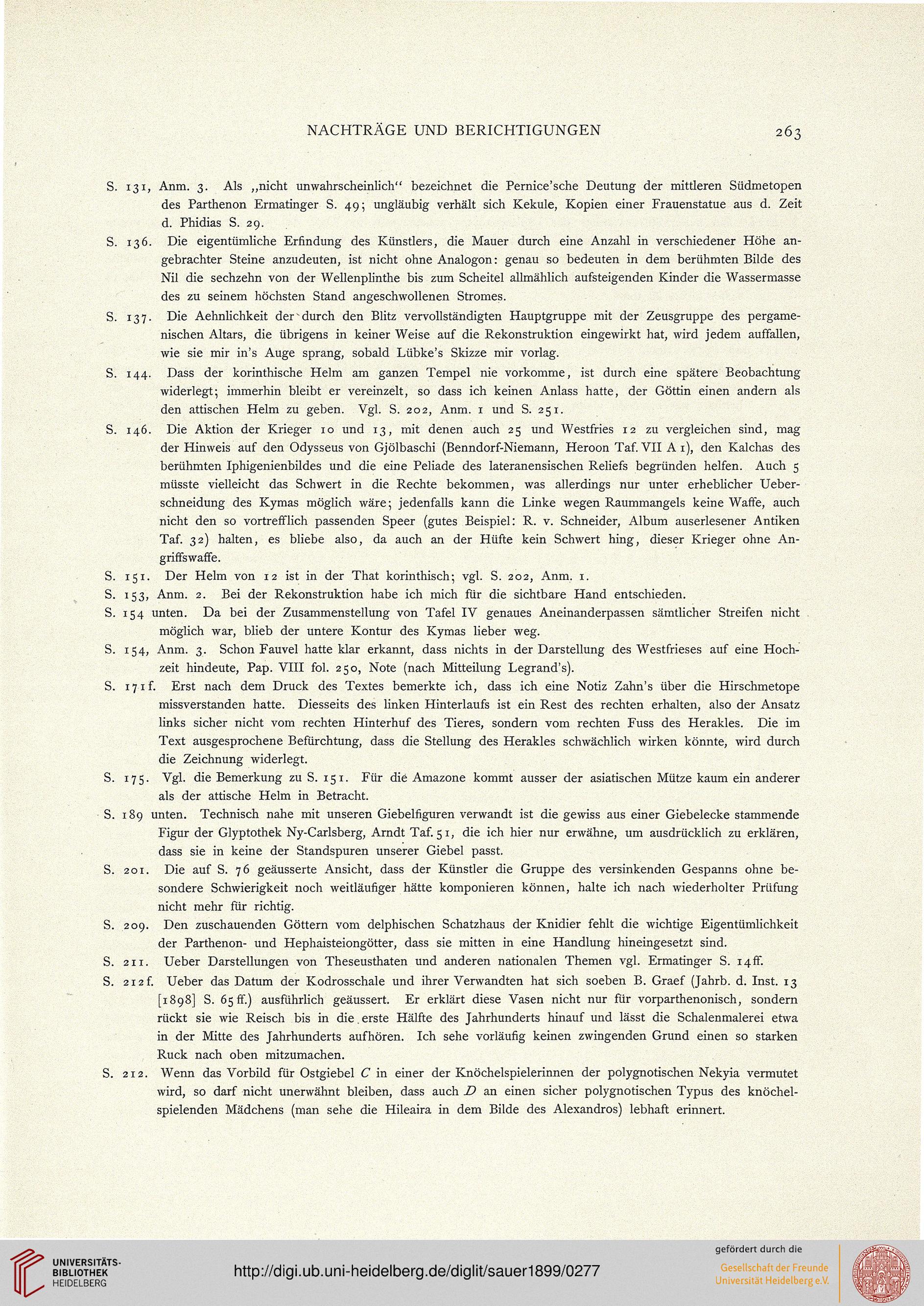NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN 263
S. 131, Anm. 3. Als „nicht unwahrscheinlich" bezeichnet die Pernice'sche Deutung der mittleren Südmetopen
des Parthenon Ermatinger S. 49; ungläubig verhält sich Kekule, Kopien einer Frauenstatue aus d. Zeit
d. Phidias S. 29.
S. 136. Die eigentümliche Erfindung des Künstlers, die Mauer durch eine Anzahl in verschiedener Höhe an-
gebrachter Steine anzudeuten, ist nicht ohne Analogon: genau so bedeuten in dem berühmten Bilde des
Nil die sechzehn von der Wellenplinthe bis zum Scheitel allmählich aufsteigenden Kinder die Wassermasse
des zu seinem höchsten Stand angeschwollenen Stromes.
S. 137. Die Aehnlichkeit der durch den Blitz vervollständigten Hauptgruppe mit der Zeusgruppe des pergame-
nischen Altars, die übrigens in keiner Weise auf die Rekonstruktion eingewirkt hat, wird jedem auffallen,
wie sie mir in's Auge sprang, sobald Lübke's Skizze mir vorlag.
S. 144. Dass der korinthische Helm am ganzen Tempel nie vorkomme, ist durch eine spätere Beobachtung
widerlegt; immerhin bleibt er vereinzelt, so dass ich keinen Anlass hatte, der Göttin einen andern als
den attischen Helm zu geben. Vgl. S. 202, Anm. 1 und S. 251.
S. 146. Die Aktion der Krieger 10 und 13, mit denen auch 25 und Westfries 12 zu vergleichen sind, mag
der Hinweis auf den Odysseus von Gjölbaschi (Benndorf-Niemann, Heroon Taf. VII A 1), den Kalchas des
berühmten Iphigenienbildes und die eine Peliade des lateranensischen Reliefs begründen helfen. Auch 5
müsste vielleicht das Schwert in die Rechte bekommen, was allerdings nur unter erheblicher Ueber-
schneidung des Kymas möglich wäre; jedenfalls kann die Linke wegen Raummangels keine Waffe, auch
nicht den so vortrefflich passenden Speer (gutes Beispiel: R. v. Schneider, Album auserlesener Antiken
Taf. 32) halten, es bliebe also, da auch an der Hüfte kein Schwert hing, dieser Krieger ohne An-
griffswaffe.
S. 151. Der Helm von 12 ist in der That korinthisch; vgl. S. 202, Anm. 1.
S. 153, Anm. 2. Bei der Rekonstruktion habe ich mich für die sichtbare Hand entschieden.
S. 154 unten. Da bei der Zusammenstellung von Tafel IV genaues Aneinanderpassen sämtlicher Streifen nicht
möglich war, blieb der untere Kontur des Kymas lieber weg.
S. 154, Anm. 3. Schon Fauvel hatte klar erkannt, dass nichts in der Darstellung des Westfrieses auf eine Hoch-
zeit hindeute, Pap. VIII fol. 250, Note (nach Mitteilung Legrand's).
S. 171 f. Erst nach dem Druck des Textes bemerkte ich, dass ich eine Notiz Zahn's über die Hirschmetope
missverstanden hatte. Diesseits des linken Hinterlaufs ist ein Rest des rechten erhalten, also der Ansatz
links sicher nicht vom rechten Hinterhuf des Tieres, sondern vom rechten Fuss des Herakles. Die im
Text ausgesprochene Befürchtung, dass die Stellung des Herakles schwächlich wirken könnte, wird durch
die Zeichnung widerlegt.
S. 175. Vgl. die Bemerkung zu S. 151. Für die Amazone kommt ausser der asiatischen Mütze kaum ein anderer
als der attische Helm in Betracht.
S. 189 unten. Technisch nahe mit unseren Giebelfiguren verwandt ist die gewiss aus einer Giebelecke stammende
Figur der Glyptothek Ny-Carlsberg, Arndt Taf. 51, die ich hier nur erwähne, um ausdrücklich zu erklären,
dass sie in keine der Standspuren unserer Giebel passt.
S. 201. Die auf S. 76 geäusserte Ansicht, dass der Künstler die Gruppe des versinkenden Gespanns ohne be-
sondere Schwierigkeit noch weitläufiger hätte komponieren können, halte ich nach wiederholter Prüfung
nicht mehr für richtig.
S. 209. Den zuschauenden Göttern vom delphischen Schatzhaus der Knidier fehlt die wichtige Eigentümlichkeit
der Parthenon- und Hephaisteiongötter, dass sie mitten in eine Handlung hineingesetzt sind.
S. 211. Ueber Darstellungen von Theseusthaten und anderen nationalen Themen vgl. Ermatinger S. 14 ff.
S. 2i2f. Ueber das Datum der Kodrosschale und ihrer Verwandten hat sich soeben B. Graef (Jahrb. d. Inst. 13
[1898] S. 65 ff.) ausfuhrlich geäussert. Er erklärt diese Vasen nicht nur für vorparthenonisch, sondern
rückt sie wie Reisch bis in die. erste Hälfte des Jahrhunderts hinauf und lässt die Schalenmalerei etwa
in der Mitte des Jahrhunderts aufhören. Ich sehe vorläufig keinen zwingenden Grund einen so starken
Ruck nach oben mitzumachen.
S. 212. Wenn das Vorbild für Ostgiebel C in einer der Knöchelspielerinnen der polygnotischen Nekyia vermutet
wird, so darf nicht unerwähnt bleiben, dass auch D an einen sicher polygnotischen Typus des knöchel-
spielenden Mädchens (man sehe die Hileaira in dem Bilde des Alexandros) lebhaft erinnert.
S. 131, Anm. 3. Als „nicht unwahrscheinlich" bezeichnet die Pernice'sche Deutung der mittleren Südmetopen
des Parthenon Ermatinger S. 49; ungläubig verhält sich Kekule, Kopien einer Frauenstatue aus d. Zeit
d. Phidias S. 29.
S. 136. Die eigentümliche Erfindung des Künstlers, die Mauer durch eine Anzahl in verschiedener Höhe an-
gebrachter Steine anzudeuten, ist nicht ohne Analogon: genau so bedeuten in dem berühmten Bilde des
Nil die sechzehn von der Wellenplinthe bis zum Scheitel allmählich aufsteigenden Kinder die Wassermasse
des zu seinem höchsten Stand angeschwollenen Stromes.
S. 137. Die Aehnlichkeit der durch den Blitz vervollständigten Hauptgruppe mit der Zeusgruppe des pergame-
nischen Altars, die übrigens in keiner Weise auf die Rekonstruktion eingewirkt hat, wird jedem auffallen,
wie sie mir in's Auge sprang, sobald Lübke's Skizze mir vorlag.
S. 144. Dass der korinthische Helm am ganzen Tempel nie vorkomme, ist durch eine spätere Beobachtung
widerlegt; immerhin bleibt er vereinzelt, so dass ich keinen Anlass hatte, der Göttin einen andern als
den attischen Helm zu geben. Vgl. S. 202, Anm. 1 und S. 251.
S. 146. Die Aktion der Krieger 10 und 13, mit denen auch 25 und Westfries 12 zu vergleichen sind, mag
der Hinweis auf den Odysseus von Gjölbaschi (Benndorf-Niemann, Heroon Taf. VII A 1), den Kalchas des
berühmten Iphigenienbildes und die eine Peliade des lateranensischen Reliefs begründen helfen. Auch 5
müsste vielleicht das Schwert in die Rechte bekommen, was allerdings nur unter erheblicher Ueber-
schneidung des Kymas möglich wäre; jedenfalls kann die Linke wegen Raummangels keine Waffe, auch
nicht den so vortrefflich passenden Speer (gutes Beispiel: R. v. Schneider, Album auserlesener Antiken
Taf. 32) halten, es bliebe also, da auch an der Hüfte kein Schwert hing, dieser Krieger ohne An-
griffswaffe.
S. 151. Der Helm von 12 ist in der That korinthisch; vgl. S. 202, Anm. 1.
S. 153, Anm. 2. Bei der Rekonstruktion habe ich mich für die sichtbare Hand entschieden.
S. 154 unten. Da bei der Zusammenstellung von Tafel IV genaues Aneinanderpassen sämtlicher Streifen nicht
möglich war, blieb der untere Kontur des Kymas lieber weg.
S. 154, Anm. 3. Schon Fauvel hatte klar erkannt, dass nichts in der Darstellung des Westfrieses auf eine Hoch-
zeit hindeute, Pap. VIII fol. 250, Note (nach Mitteilung Legrand's).
S. 171 f. Erst nach dem Druck des Textes bemerkte ich, dass ich eine Notiz Zahn's über die Hirschmetope
missverstanden hatte. Diesseits des linken Hinterlaufs ist ein Rest des rechten erhalten, also der Ansatz
links sicher nicht vom rechten Hinterhuf des Tieres, sondern vom rechten Fuss des Herakles. Die im
Text ausgesprochene Befürchtung, dass die Stellung des Herakles schwächlich wirken könnte, wird durch
die Zeichnung widerlegt.
S. 175. Vgl. die Bemerkung zu S. 151. Für die Amazone kommt ausser der asiatischen Mütze kaum ein anderer
als der attische Helm in Betracht.
S. 189 unten. Technisch nahe mit unseren Giebelfiguren verwandt ist die gewiss aus einer Giebelecke stammende
Figur der Glyptothek Ny-Carlsberg, Arndt Taf. 51, die ich hier nur erwähne, um ausdrücklich zu erklären,
dass sie in keine der Standspuren unserer Giebel passt.
S. 201. Die auf S. 76 geäusserte Ansicht, dass der Künstler die Gruppe des versinkenden Gespanns ohne be-
sondere Schwierigkeit noch weitläufiger hätte komponieren können, halte ich nach wiederholter Prüfung
nicht mehr für richtig.
S. 209. Den zuschauenden Göttern vom delphischen Schatzhaus der Knidier fehlt die wichtige Eigentümlichkeit
der Parthenon- und Hephaisteiongötter, dass sie mitten in eine Handlung hineingesetzt sind.
S. 211. Ueber Darstellungen von Theseusthaten und anderen nationalen Themen vgl. Ermatinger S. 14 ff.
S. 2i2f. Ueber das Datum der Kodrosschale und ihrer Verwandten hat sich soeben B. Graef (Jahrb. d. Inst. 13
[1898] S. 65 ff.) ausfuhrlich geäussert. Er erklärt diese Vasen nicht nur für vorparthenonisch, sondern
rückt sie wie Reisch bis in die. erste Hälfte des Jahrhunderts hinauf und lässt die Schalenmalerei etwa
in der Mitte des Jahrhunderts aufhören. Ich sehe vorläufig keinen zwingenden Grund einen so starken
Ruck nach oben mitzumachen.
S. 212. Wenn das Vorbild für Ostgiebel C in einer der Knöchelspielerinnen der polygnotischen Nekyia vermutet
wird, so darf nicht unerwähnt bleiben, dass auch D an einen sicher polygnotischen Typus des knöchel-
spielenden Mädchens (man sehe die Hileaira in dem Bilde des Alexandros) lebhaft erinnert.