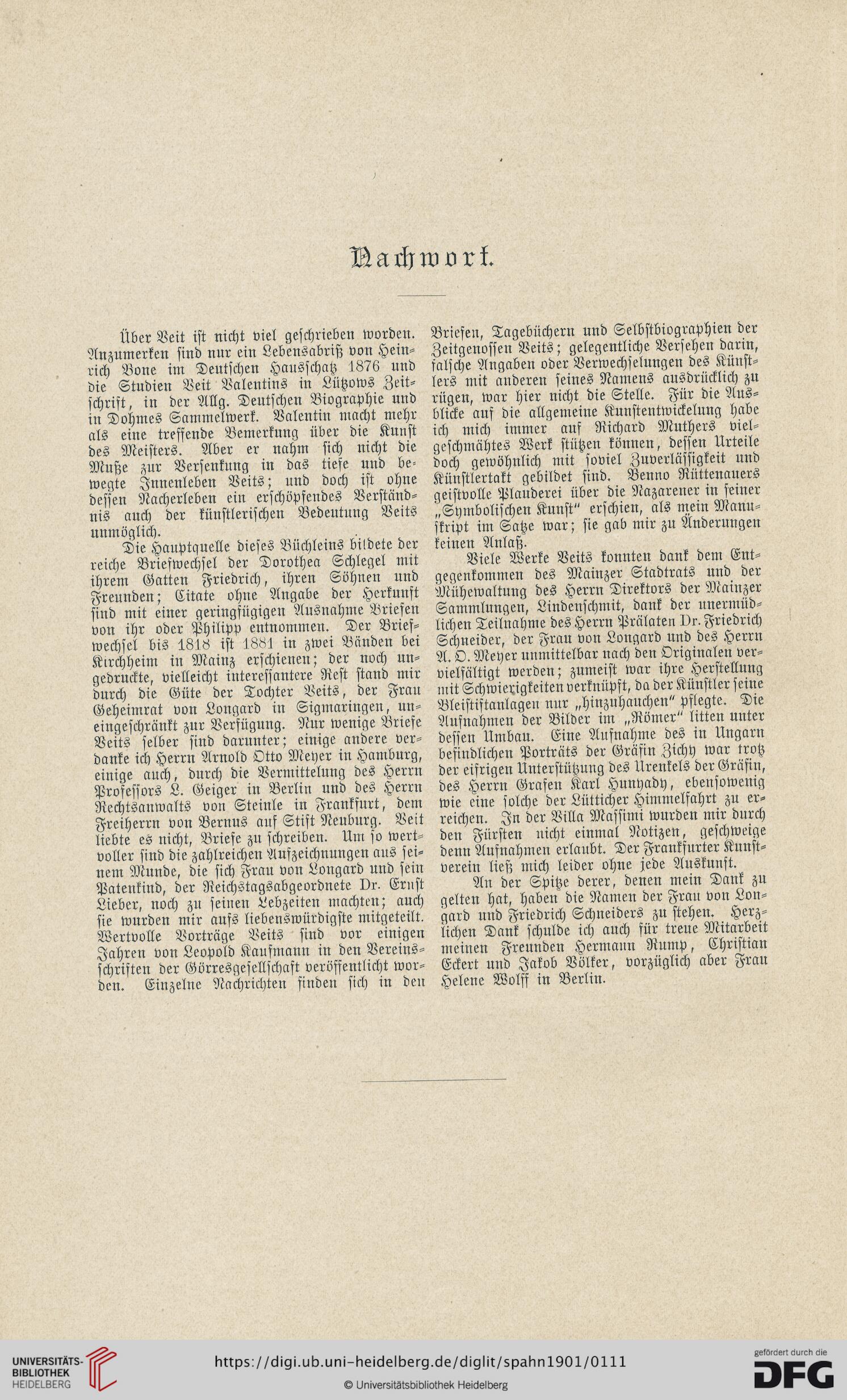Nachwort.
Über Veit ist nicht viel geschrieben worden.
Anzumerken sind nur ein Lebensabriß von Hein-
rich Bone im Deutschen Hausschatz 1876 und
die Studien Veit Valentins in Lützows Zeit-
schrift, in der Allg. Deutschen Biographie und
in Dohmes Sammelwerk. Valentin macht mehr
als eine treffende Bemerkung über die Kunst
des Meisters. Aber er nahm sich nicht die
Muße zur Versenkung in das tiefe und be-
wegte Innenleben Veits; und doch ist ohne
dessen Nacherleben ein erschöpfendes Verständ-
nis auch der künstlerischen Bedeutung Veits
unmöglich.
Die Hauptguelle dieses Büchleins bildete der
reiche Briefwechsel der Dorothea Schlegel mit
ihrem Gatten Friedrich, ihren Söhnen und
Freunden; Citate ohne Angabe der Herkunft
sind mit einer geringfügigen Ausnahme Briefen
von ihr oder Philipp entnommen. Der Brief-
wechsel bis 1818 ist 1881 in zwei Bänden bei
Kirchheim in Mainz erschienen; der noch un-
gedruckte, vielleicht interessantere Rest stand mir
durch die Güte der Tochter Veits, der Frau
Geheimrat von Longard in Sigmaringen, un-
eingeschränkt zur Verfügung. Nur wenige Briefe
Veits selber sind darunter; einige andere ver-
danke ich Herrn Arnold Otto Bleyer in Hamburg,
einige auch, durch die Vermittelung des Herrn
Professors L. Geiger in Berlin und des Herrn
Rechtsanwalts von Steinle in Frankfurt, dem
Freiherrn von Bernus auf Stift Neuburg. Veit
liebte es nicht, Briefe zu schreiben. Um so wert-
voller sind die zahlreichen Aufzeichnungen aus sei-
nem Munde, die sich Frau von Longard und sein
Patenkind, der Reichstagsabgeordnete I)r. Ernst
Lieber, noch zu seinen Lebzeiten machten; auch
sie wurden mir aufs liebenswürdigste mitgeteilt.
Wertvolle Vorträge Veits sind vor einigen
Jahren von Leopold Kaufmann in den Vereins-
schristen der Görresgesellschaft veröffentlicht wor-
den. Einzelne Nachrichten finden sich in den
Briefen, Tagebüchern und Selbstbiographien der
Zeitgenossen Veits; gelegentliche Versehen darin,
falsche Angaben oder Verwechselungen des Künst-
lers mit anderen seines Namens ausdrücklich zu
rügen, war hier nicht die Stelle. Für die Aus-
blicke ans die allgemeine Kunstentwickelung habe
ich mich immer auf Richard Muthers viel-
geschmähtes Werk stützen können, dessen Urteile
doch gewöhnlich mit soviel Zuverlässigkeit und
Künstlertakt gebildet sind. Benno Rüttenauers
geistvolle Plauderei über die Nazarener in seiner
„Symbolischen Kunst" erschien, als mein Manu-
skript im Satze war; sie gab mir zu Änderungen
keinen Anlaß.
Viele Werke Veits konnten dank dem Ent-
gegenkommen des Mainzer Stadtrats nnd der
Mühewaltung des Herrn Direktors der Mainzer
Sammlungen, Lindenschmit, dank der unermüd-
lichen Teilnahme des Herrn Prälaten Vr. Friedrich
Schneider, der Frau von Longard und des Herrn
A. O. Meyer unmittelbar nach den Originalen ver-
vielsültigt werden; zumeist war ihre Herstellung
mit Schwierigkeiten verknüpft, da der Künstler seine
Bleistiftanlagen nur „hinzuhanchen" pflegte. Die
Aufnahmen der Bilder im „Römer" litten unter
dessen Umbau. Eine Aufnahme des in Ungarn
befindlichen Porträts der Gräfin Zichy war trotz
der eifrigen Unterstützung des Urenkels der Gräfin,
des Herrn Grafen Karl Hunyady, ebensowenig
wie eine solche der Lütticher Himmelfahrt zu er-
reichen. In der Villa Massimi wurden mir durch
den Fürsten nicht einmal Notizen, geschweige
denn Aufnahmen erlaubt. Der Frankfurter Kunst-
verein ließ mich leider ohne jede Auskunft.
An der Spitze derer, denen mein Dank zu
gelten hat, Haben die Namen der Frau von Lon-
gard und Friedrich Schneiders zu stehen. Herz-
lichen Dank schulde ich auch sür treue Mitarbeit
meinen Freunden Hermann Rump, Christian
Eckert und Jakob Völker, vorzüglich aber Frau
Helene Wolff in Berlin.
Über Veit ist nicht viel geschrieben worden.
Anzumerken sind nur ein Lebensabriß von Hein-
rich Bone im Deutschen Hausschatz 1876 und
die Studien Veit Valentins in Lützows Zeit-
schrift, in der Allg. Deutschen Biographie und
in Dohmes Sammelwerk. Valentin macht mehr
als eine treffende Bemerkung über die Kunst
des Meisters. Aber er nahm sich nicht die
Muße zur Versenkung in das tiefe und be-
wegte Innenleben Veits; und doch ist ohne
dessen Nacherleben ein erschöpfendes Verständ-
nis auch der künstlerischen Bedeutung Veits
unmöglich.
Die Hauptguelle dieses Büchleins bildete der
reiche Briefwechsel der Dorothea Schlegel mit
ihrem Gatten Friedrich, ihren Söhnen und
Freunden; Citate ohne Angabe der Herkunft
sind mit einer geringfügigen Ausnahme Briefen
von ihr oder Philipp entnommen. Der Brief-
wechsel bis 1818 ist 1881 in zwei Bänden bei
Kirchheim in Mainz erschienen; der noch un-
gedruckte, vielleicht interessantere Rest stand mir
durch die Güte der Tochter Veits, der Frau
Geheimrat von Longard in Sigmaringen, un-
eingeschränkt zur Verfügung. Nur wenige Briefe
Veits selber sind darunter; einige andere ver-
danke ich Herrn Arnold Otto Bleyer in Hamburg,
einige auch, durch die Vermittelung des Herrn
Professors L. Geiger in Berlin und des Herrn
Rechtsanwalts von Steinle in Frankfurt, dem
Freiherrn von Bernus auf Stift Neuburg. Veit
liebte es nicht, Briefe zu schreiben. Um so wert-
voller sind die zahlreichen Aufzeichnungen aus sei-
nem Munde, die sich Frau von Longard und sein
Patenkind, der Reichstagsabgeordnete I)r. Ernst
Lieber, noch zu seinen Lebzeiten machten; auch
sie wurden mir aufs liebenswürdigste mitgeteilt.
Wertvolle Vorträge Veits sind vor einigen
Jahren von Leopold Kaufmann in den Vereins-
schristen der Görresgesellschaft veröffentlicht wor-
den. Einzelne Nachrichten finden sich in den
Briefen, Tagebüchern und Selbstbiographien der
Zeitgenossen Veits; gelegentliche Versehen darin,
falsche Angaben oder Verwechselungen des Künst-
lers mit anderen seines Namens ausdrücklich zu
rügen, war hier nicht die Stelle. Für die Aus-
blicke ans die allgemeine Kunstentwickelung habe
ich mich immer auf Richard Muthers viel-
geschmähtes Werk stützen können, dessen Urteile
doch gewöhnlich mit soviel Zuverlässigkeit und
Künstlertakt gebildet sind. Benno Rüttenauers
geistvolle Plauderei über die Nazarener in seiner
„Symbolischen Kunst" erschien, als mein Manu-
skript im Satze war; sie gab mir zu Änderungen
keinen Anlaß.
Viele Werke Veits konnten dank dem Ent-
gegenkommen des Mainzer Stadtrats nnd der
Mühewaltung des Herrn Direktors der Mainzer
Sammlungen, Lindenschmit, dank der unermüd-
lichen Teilnahme des Herrn Prälaten Vr. Friedrich
Schneider, der Frau von Longard und des Herrn
A. O. Meyer unmittelbar nach den Originalen ver-
vielsültigt werden; zumeist war ihre Herstellung
mit Schwierigkeiten verknüpft, da der Künstler seine
Bleistiftanlagen nur „hinzuhanchen" pflegte. Die
Aufnahmen der Bilder im „Römer" litten unter
dessen Umbau. Eine Aufnahme des in Ungarn
befindlichen Porträts der Gräfin Zichy war trotz
der eifrigen Unterstützung des Urenkels der Gräfin,
des Herrn Grafen Karl Hunyady, ebensowenig
wie eine solche der Lütticher Himmelfahrt zu er-
reichen. In der Villa Massimi wurden mir durch
den Fürsten nicht einmal Notizen, geschweige
denn Aufnahmen erlaubt. Der Frankfurter Kunst-
verein ließ mich leider ohne jede Auskunft.
An der Spitze derer, denen mein Dank zu
gelten hat, Haben die Namen der Frau von Lon-
gard und Friedrich Schneiders zu stehen. Herz-
lichen Dank schulde ich auch sür treue Mitarbeit
meinen Freunden Hermann Rump, Christian
Eckert und Jakob Völker, vorzüglich aber Frau
Helene Wolff in Berlin.