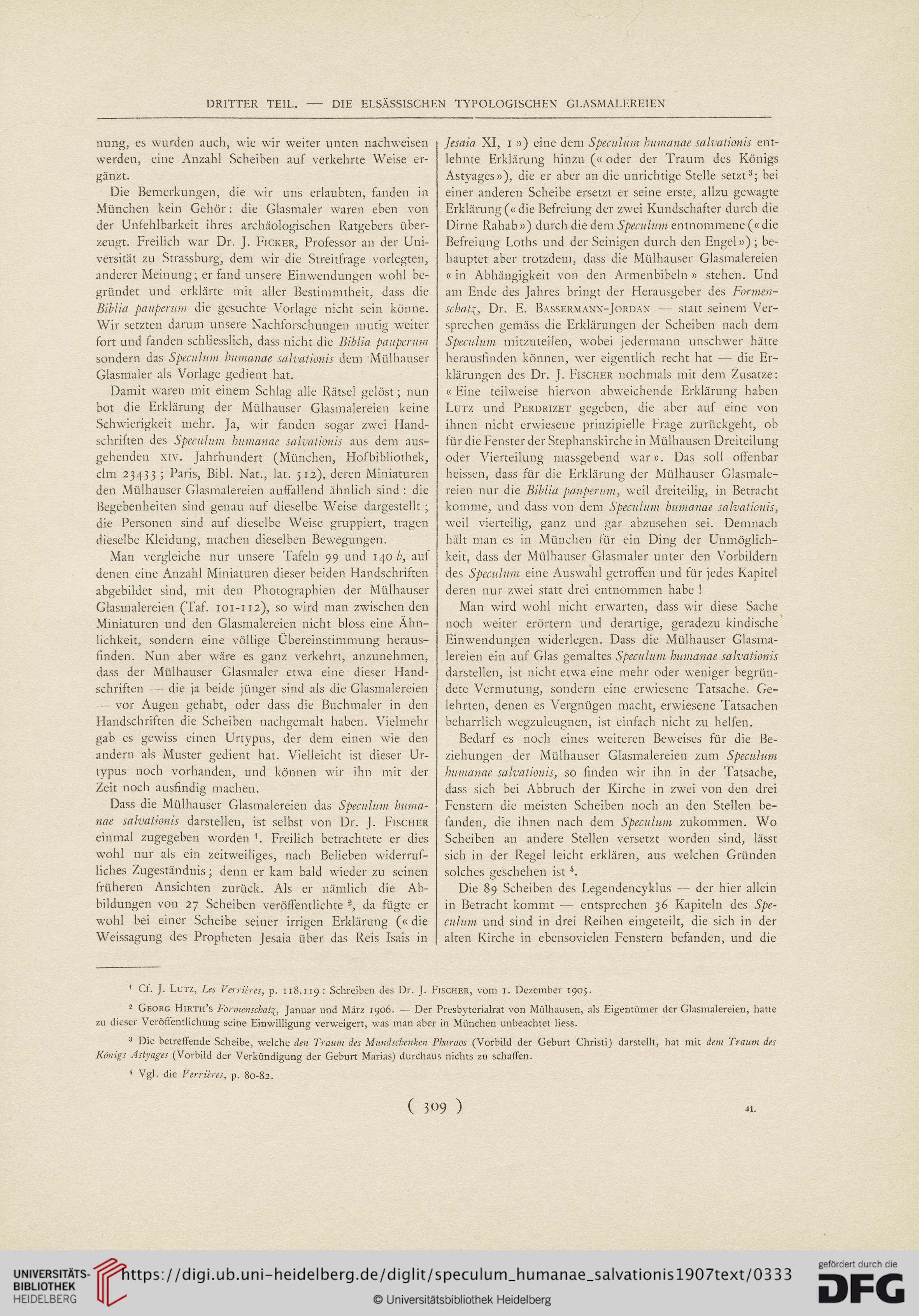DRITTER TEIL. - DIE ELSÄSSISCHEN TYPOLOGISCHEN GLASMALEREIEN
nung, es wurden auch, wie wir weiter unten nachweisen
werden, eine Anzahl Scheiben auf verkehrte Weise er-
gänzt.
Die Bemerkungen, die wir uns erlaubten, fanden in
München kein Gehör : die Glasmaler waren eben von
der Unfehlbarkeit ihres archäologischen Ratgebers über-
zeugt. Freilich war Dr. J. Ficker, Professor an der Uni-
versität zu Strassburg, dem wir die Streitfrage vorlegten,
anderer Meinung; er fand unsere Einwendungen wohl be-
gründet und erklärte mit aller Bestimmtheit, dass die
Biblia pauperum die gesuchte Vorlage nicht sein könne.
Wir setzten darum unsere Nachforschungen mutig weiter
fort und fanden schliesslich, dass nicht die Biblia pauperum
sondern das Speculum humanae salvationis dem Mülhauser
Glasmaler als Vorlage gedient hat.
Damit waren mit einem Schlag alle Rätsel gelöst ; nun
bot die Erklärung der Mülhauser Glasmalereien keine
Schwierigkeit mehr. Ja, wir fanden sogar zwei Hand-
schriften des Speculum humanae salvationis aus dem aus-
gehenden xiv. Jahrhundert (München, Hofbibliothek,
clm 23433 ; Paris, Bibi. Nat., lat. 512), deren Miniaturen
den Mülhauser Glasmalereien auffallend ähnlich sind : die
Begebenheiten sind genau auf dieselbe Weise dargestellt ;
die Personen sind auf dieselbe Weise gruppiert, tragen
dieselbe Kleidung, machen dieselben Bewegungen.
Man vergleiche nur unsere Tafeln 99 und 140 b, auf
denen eine Anzahl Miniaturen dieser beiden Handschriften
abgebildet sind, mit den Photographien der Mülhauser
Glasmalereien (Taf. 101-112), so wird man zwischen den
Miniaturen und den Glasmalereien nicht bloss eine Ähn-
lichkeit, sondern eine völlige Übereinstimmung heraus-
finden. Nun aber wäre es ganz verkehrt, anzunehmen,
dass der Mülhauser Glasmaler etwa eine dieser Hand-
schriften — die ja beide jünger sind als die Glasmalereien
— vor Augen gehabt, oder dass die Buchmaler in den
Handschriften die Scheiben nachgemalt haben. Vielmehr
gab es gewiss einen Urtypus, der dem einen wie den
andern als Muster gedient hat. Vielleicht ist dieser Ur-
typus noch vorhanden, und können wir ihn mit der
Zeit noch ausfindig machen.
Dass die Mülhauser Glasmalereien das Speculum huma-
nae salvationis darstellen, ist selbst von Dr. J. Fischer
einmal zugegeben worden L Freilich betrachtete er dies
wohl nur als ein zeitweiliges, nach Belieben widerruf-
liches Zugeständnis ; denn er kam bald wieder zu seinen
früheren Ansichten zurück. Als er nämlich die Ab-
bildungen von 27 Scheiben veröffentlichte 2, da fügte er
wohl bei einer Scheibe seiner irrigen Erklärung (« die
Weissagung des Propheten Jesaia über das Reis Isais in
Jesaia XI, 1 ») eine dem Speculum humanae salvationis ent-
lehnte Erklärung hinzu (« oder der Traum des Königs
Astyages»), die er aber an die unrichtige Stelle setzt3; bei
einer anderen Scheibe ersetzt er seine erste, allzu gewagte
Erklärung («die Befreiung der zwei Kundschafter durch die
Dirne Rahab ») durch die dem Speculum entnommene (« die
Befreiung Loths und der Seinigen durch den Engel») ; be-
hauptet aber trotzdem, dass die Mülhauser Glasmalereien
« in Abhängigkeit von den Armenbibeln » stehen. Und
am Ende des Jahres bringt der Herausgeber des Formen-
schaff, Dr. E. Bassermann-Jordan — statt seinem Ver-
sprechen gemäss die Erklärungen der Scheiben nach dem
Speculum mitzuteilen, wobei jedermann unschwer hätte
herausfinden können, wer eigentlich recht hat — die Er-
klärungen des Dr. J. Fischer nochmals mit dem Zusatze:
« Eine teilweise hiervon abweichende Erklärung haben
Lutz und Perdrizet gegeben, die aber auf eine von
ihnen nicht erwiesene prinzipielle Frage zurückgeht, ob
für die Fenster der Stephanskirche in Mülhausen Dreiteilung
oder Vierteilung massgebend war». Das soll offenbar
heissen, dass für die Erklärung der Mülhauser Glasmale-
reien nur die Biblia pauperum, weil dreiteilig, in Betracht
komme, und dass von dem Speculum humanae salvationis,
weil vierteilig, ganz und gar abzusehen sei. Demnach
hält man es in München für ein Ding der Unmöglich-
keit, dass der Mülhauser Glasmaler unter den Vorbildern
des Speculum eine Auswahl getroffen und für jedes Kapitel
deren nur zwei statt drei entnommen habe !
Man wird wohl nicht erwarten, dass wir diese Sache
noch weiter erörtern und derartige, geradezu kindische
Einwendungen widerlegen. Dass die Mülhauser Glasma-
lereien ein auf Glas gemaltes Speculum humanae, salvationis
darstellen, ist nicht etwa eine mehr oder weniger begrün-
dete Vermutung, sondern eine erwiesene Tatsache. Ge-
lehrten, denen es Vergnügen macht, erwiesene Tatsachen
beharrlich wegzuleugnen, ist einfach nicht zu helfen.
Bedarf es noch eines weiteren Beweises für die Be-
ziehungen der Mülhauser Glasmalereien zum Speculum
humanae salvationis, so finden wir ihn in der Tatsache,
dass sich bei Abbruch der Kirche in zwei von den drei
Fenstern die meisten Scheiben noch an den Stellen be-
fanden, die ihnen nach dem Speculum zukommen. Wo
Scheiben an andere Stellen versetzt worden sind, lässt
sich in der Regel leicht erklären, aus welchen Gründen
solches geschehen istL
Die 89 Scheiben des Legendencyklus — der hier allein
in Betracht kommt — entsprechen 36 Kapiteln des Spe-
culum und sind in drei Reihen eingeteilt, die sich in der
alten Kirche in ebensovielen Fenstern befanden, und die
1 Cf. J. Lutz, Les Verrières, p. 118.119 : Schreiben des Dr. J. Fischer, vom 1. Dezember 1905.
4 Georg Hirth’s Formenschatg, Januar und März 1906. — Der Presbyterialrat von Mülhausen, als Eigentümer der Glasmalereien, hatte
zu dieser Veröffentlichung seine Einwilligung verweigert, was man aber in München unbeachtet liess.
3 Die betreffende Scheibe, welche de» Traum des Mundschenken Pharaos (Vorbild der Geburt Christi) darstellt, hat mit dem Traum des
Königs Astyages (Vorbild der Verkündigung der Geburt Marias) durchaus nichts zu schaffen.
4 Vgl. die Verrières, p. 80-82.
( 309 )
41.
nung, es wurden auch, wie wir weiter unten nachweisen
werden, eine Anzahl Scheiben auf verkehrte Weise er-
gänzt.
Die Bemerkungen, die wir uns erlaubten, fanden in
München kein Gehör : die Glasmaler waren eben von
der Unfehlbarkeit ihres archäologischen Ratgebers über-
zeugt. Freilich war Dr. J. Ficker, Professor an der Uni-
versität zu Strassburg, dem wir die Streitfrage vorlegten,
anderer Meinung; er fand unsere Einwendungen wohl be-
gründet und erklärte mit aller Bestimmtheit, dass die
Biblia pauperum die gesuchte Vorlage nicht sein könne.
Wir setzten darum unsere Nachforschungen mutig weiter
fort und fanden schliesslich, dass nicht die Biblia pauperum
sondern das Speculum humanae salvationis dem Mülhauser
Glasmaler als Vorlage gedient hat.
Damit waren mit einem Schlag alle Rätsel gelöst ; nun
bot die Erklärung der Mülhauser Glasmalereien keine
Schwierigkeit mehr. Ja, wir fanden sogar zwei Hand-
schriften des Speculum humanae salvationis aus dem aus-
gehenden xiv. Jahrhundert (München, Hofbibliothek,
clm 23433 ; Paris, Bibi. Nat., lat. 512), deren Miniaturen
den Mülhauser Glasmalereien auffallend ähnlich sind : die
Begebenheiten sind genau auf dieselbe Weise dargestellt ;
die Personen sind auf dieselbe Weise gruppiert, tragen
dieselbe Kleidung, machen dieselben Bewegungen.
Man vergleiche nur unsere Tafeln 99 und 140 b, auf
denen eine Anzahl Miniaturen dieser beiden Handschriften
abgebildet sind, mit den Photographien der Mülhauser
Glasmalereien (Taf. 101-112), so wird man zwischen den
Miniaturen und den Glasmalereien nicht bloss eine Ähn-
lichkeit, sondern eine völlige Übereinstimmung heraus-
finden. Nun aber wäre es ganz verkehrt, anzunehmen,
dass der Mülhauser Glasmaler etwa eine dieser Hand-
schriften — die ja beide jünger sind als die Glasmalereien
— vor Augen gehabt, oder dass die Buchmaler in den
Handschriften die Scheiben nachgemalt haben. Vielmehr
gab es gewiss einen Urtypus, der dem einen wie den
andern als Muster gedient hat. Vielleicht ist dieser Ur-
typus noch vorhanden, und können wir ihn mit der
Zeit noch ausfindig machen.
Dass die Mülhauser Glasmalereien das Speculum huma-
nae salvationis darstellen, ist selbst von Dr. J. Fischer
einmal zugegeben worden L Freilich betrachtete er dies
wohl nur als ein zeitweiliges, nach Belieben widerruf-
liches Zugeständnis ; denn er kam bald wieder zu seinen
früheren Ansichten zurück. Als er nämlich die Ab-
bildungen von 27 Scheiben veröffentlichte 2, da fügte er
wohl bei einer Scheibe seiner irrigen Erklärung (« die
Weissagung des Propheten Jesaia über das Reis Isais in
Jesaia XI, 1 ») eine dem Speculum humanae salvationis ent-
lehnte Erklärung hinzu (« oder der Traum des Königs
Astyages»), die er aber an die unrichtige Stelle setzt3; bei
einer anderen Scheibe ersetzt er seine erste, allzu gewagte
Erklärung («die Befreiung der zwei Kundschafter durch die
Dirne Rahab ») durch die dem Speculum entnommene (« die
Befreiung Loths und der Seinigen durch den Engel») ; be-
hauptet aber trotzdem, dass die Mülhauser Glasmalereien
« in Abhängigkeit von den Armenbibeln » stehen. Und
am Ende des Jahres bringt der Herausgeber des Formen-
schaff, Dr. E. Bassermann-Jordan — statt seinem Ver-
sprechen gemäss die Erklärungen der Scheiben nach dem
Speculum mitzuteilen, wobei jedermann unschwer hätte
herausfinden können, wer eigentlich recht hat — die Er-
klärungen des Dr. J. Fischer nochmals mit dem Zusatze:
« Eine teilweise hiervon abweichende Erklärung haben
Lutz und Perdrizet gegeben, die aber auf eine von
ihnen nicht erwiesene prinzipielle Frage zurückgeht, ob
für die Fenster der Stephanskirche in Mülhausen Dreiteilung
oder Vierteilung massgebend war». Das soll offenbar
heissen, dass für die Erklärung der Mülhauser Glasmale-
reien nur die Biblia pauperum, weil dreiteilig, in Betracht
komme, und dass von dem Speculum humanae salvationis,
weil vierteilig, ganz und gar abzusehen sei. Demnach
hält man es in München für ein Ding der Unmöglich-
keit, dass der Mülhauser Glasmaler unter den Vorbildern
des Speculum eine Auswahl getroffen und für jedes Kapitel
deren nur zwei statt drei entnommen habe !
Man wird wohl nicht erwarten, dass wir diese Sache
noch weiter erörtern und derartige, geradezu kindische
Einwendungen widerlegen. Dass die Mülhauser Glasma-
lereien ein auf Glas gemaltes Speculum humanae, salvationis
darstellen, ist nicht etwa eine mehr oder weniger begrün-
dete Vermutung, sondern eine erwiesene Tatsache. Ge-
lehrten, denen es Vergnügen macht, erwiesene Tatsachen
beharrlich wegzuleugnen, ist einfach nicht zu helfen.
Bedarf es noch eines weiteren Beweises für die Be-
ziehungen der Mülhauser Glasmalereien zum Speculum
humanae salvationis, so finden wir ihn in der Tatsache,
dass sich bei Abbruch der Kirche in zwei von den drei
Fenstern die meisten Scheiben noch an den Stellen be-
fanden, die ihnen nach dem Speculum zukommen. Wo
Scheiben an andere Stellen versetzt worden sind, lässt
sich in der Regel leicht erklären, aus welchen Gründen
solches geschehen istL
Die 89 Scheiben des Legendencyklus — der hier allein
in Betracht kommt — entsprechen 36 Kapiteln des Spe-
culum und sind in drei Reihen eingeteilt, die sich in der
alten Kirche in ebensovielen Fenstern befanden, und die
1 Cf. J. Lutz, Les Verrières, p. 118.119 : Schreiben des Dr. J. Fischer, vom 1. Dezember 1905.
4 Georg Hirth’s Formenschatg, Januar und März 1906. — Der Presbyterialrat von Mülhausen, als Eigentümer der Glasmalereien, hatte
zu dieser Veröffentlichung seine Einwilligung verweigert, was man aber in München unbeachtet liess.
3 Die betreffende Scheibe, welche de» Traum des Mundschenken Pharaos (Vorbild der Geburt Christi) darstellt, hat mit dem Traum des
Königs Astyages (Vorbild der Verkündigung der Geburt Marias) durchaus nichts zu schaffen.
4 Vgl. die Verrières, p. 80-82.
( 309 )
41.