Hinweis: Dies ist eine zusätzlich gescannte Seite, um Farbkeil und Maßstab abbilden zu können.
0.5
1 cm
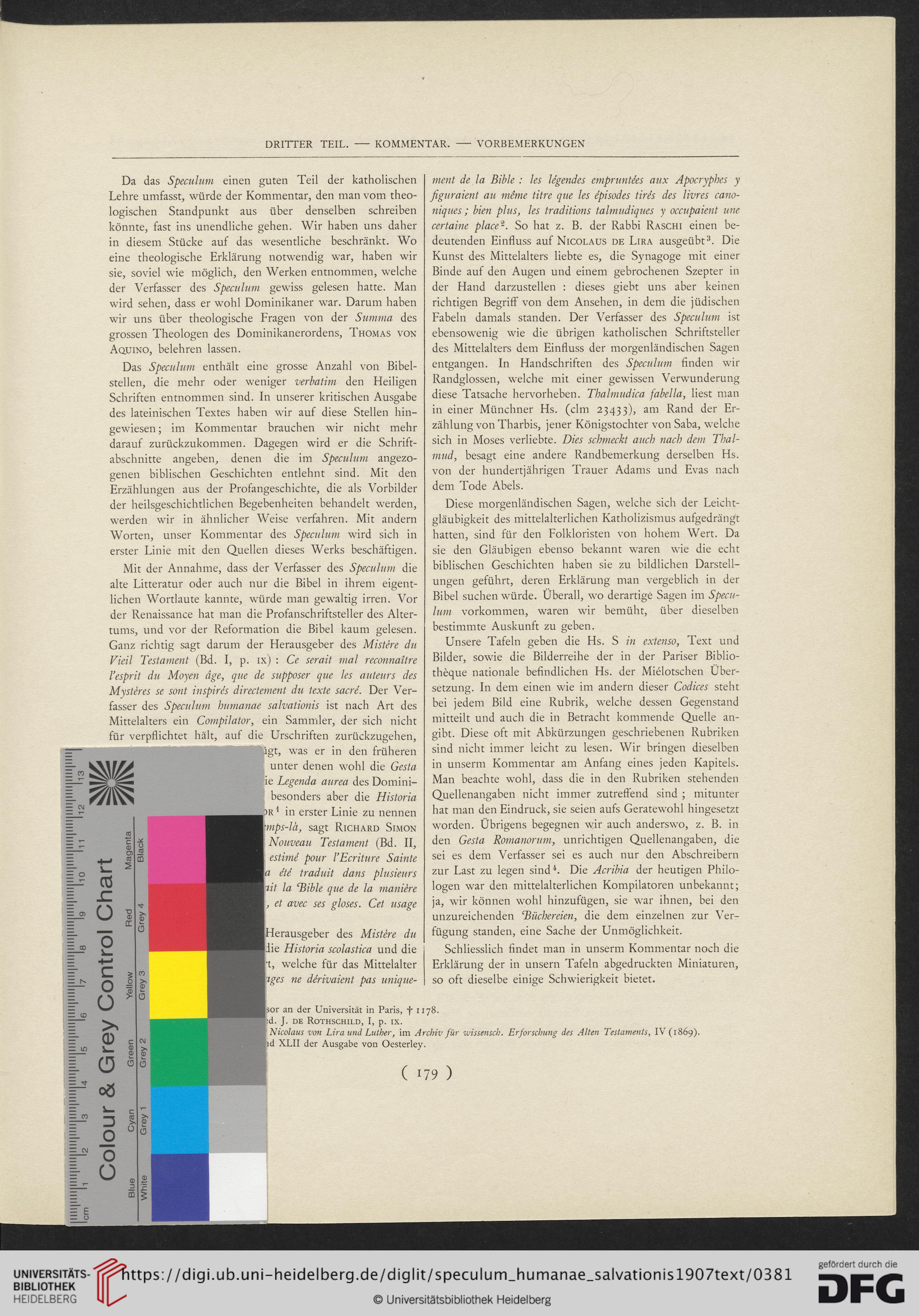
Colour & Grey Control Chart
DRITTER TEIL. - KOMMENTAR. - VORBEMERKUNGEN
Da das Speculum einen guten Teil der katholischen
Lehre umfasst, würde der Kommentar, den man vom theo-
logischen Standpunkt aus über denselben schreiben
könnte, fast ins unendliche gehen. Wir haben uns daher
in diesem Stücke auf das wesentliche beschränkt. Wo
eine theologische Erklärung notwendig war, haben wir
sie, soviel wie möglich, den Werken entnommen, welche
der Verfasser des Speculum gewiss gelesen hatte. Man
wird sehen, dass er wohl Dominikaner war. Darum haben
wir uns über theologische Fragen von der Summa des
grossen Theologen des Dominikanerordens, Thomas von
Aquino, belehren lassen.
Das Speculum enthält eine grosse Anzahl von Bibel-
stellen, die mehr oder weniger Verbatim den Heiligen
Schriften entnommen sind. In unserer kritischen Ausgabe
des lateinischen Textes haben wir auf diese Stellen hin-
gewiesen; im Kommentar brauchen wir nicht mehr
darauf zurückzukommen. Dagegen wird er die Schrift-
abschnitte angeben, denen die im Speculum angezo-
genen biblischen Geschichten entlehnt sind. Mit den
Erzählungen aus der Profangeschichte, die als Vorbilder
der heilsgeschichtlichen Begebenheiten behandelt werden,
werden wir in ähnlicher Weise verfahren. Mit andern
Worten, unser Kommentar des Speculum wird sich in
erster Linie mit den Quellen dieses Werks beschäftigen.
Mit der Annahme, dass der Verfasser des Speculum die
alte Litteratur oder auch nur die Bibel in ihrem eigent-
lichen Wortlaute kannte, würde man gewaltig irren. Vor
der Renaissance hat man die Profanschriftsteller des Alter-
ment de la Bible : les legendes empruntées aux Apocryphes y
figuraient au même titre que les épisodes tirés des livres cano-
niques ; bien plus, les traditions talmudiques y occupaient une
certaine place*. So hat z. B. der Rabbi Raschi einen be-
deutenden Einfluss auf Nicolaus de Lira ausgeübt3. Die
Kunst des Mittelalters liebte es, die Synagoge mit einer
Binde auf den Augen und einem gebrochenen Szepter in
der Hand darzustellen : dieses giebt uns aber keinen
richtigen Begriff von dem Ansehen, in dem die jüdischen
Fabeln damals standen. Der Verfasser des Speculum ist
ebensowenig wie die übrigen katholischen Schriftsteller
des Mittelalters dem Einfluss der morgenländischen Sagen
entgangen. In Handschriften des Speculum finden wir
Randglossen, welche mit einer gewissen Verwunderung
diese Tatsache hervorheben. Thalmudica fabella, liest man
in einer Münchner Hs. (clm 23433), am Rand der Er-
zählung von Tharbis, jener Königstochter von Saba, welche
sich in Moses verliebte. Dies schmeckt auch nach dem Thal-
mud, besagt eine andere Randbemerkung derselben Hs.
von der hundertjährigen Trauer Adams und Evas nach
dem Tode Abels.
Diese morgenländischen Sagen, welche sich der Leicht-
gläubigkeit des mittelalterlichen Katholizismus aufgedrängt
hatten, sind für den Folkloristen von hohem Wert. Da
sie den Gläubigen ebenso bekannt waren wie die echt
biblischen Geschichten haben sie zu bildlichen Darstell-
ungen geführt, deren Erklärung man vergeblich in der
Bibel suchen würde. Überall, wo derartige Sagen im Specu-
lum vorkommen, waren wir bemüht, über dieselben
tums, und vor der Reformation die Bibel kaum gelesen.
Ganz richtig sagt darum der Herausgeber des Mistère du
Vieil Testament (Bd. I, p. ix) : Ce serait mal reconnaître
l’esprit du Moyen âge, que de supposer que les auteurs des
Mystères se sont inspirés directement du texte sacré. Der Ver-
fasser des Speculum humanae salvationis ist nach Art des
Mittelalters ein Compilator, ein Sammler, der sich nicht
für verpflichtet hält, auf die Urschriften zurückzugehen,
jgt, was er in den früheren
bestimmte Auskunft zu geben.
Unsere Tafeln geben die Hs. S in extenso, Text und
Bilder, sowie die Bilderreihe der in der Pariser Biblio-
thèque nationale befindlichen Hs. der Miélotschen Über-
setzung. In dem einen wie im andern dieser Codices steht
bei jedem Bild eine Rubrik, welche dessen Gegenstand
mitteilt und auch die in Betracht kommende Quelle an-
gibt. Diese oft mit Abkürzungen geschriebenen Rubriken
sind nicht immer leicht zu lesen. Wir bringen dieselben
CM
o
5
o
35
Herausgeber des Mistère du
pie Historia scolastica und die
rt, welche für das Mittelalter
lages ne dérivaient pas unique-
œ
CE
c:
s
o
O
□
ra
0)
O)
cü
O
d
CD
in unserm Kommentar am Anfang eines jeden Kapitels.
Man beachte wohl, dass die in den Rubriken stehenden
Quellenangaben nicht immer zutreffend sind ; mitunter
hat man den Eindruck, sie seien aufs Geratewohl hingesetzt
worden. Übrigens begegnen wir auch anderswo, z. B. in
den Gesta Romanorum, unrichtigen Quellenangaben, die
sei es dem Verfasser sei es auch nur den Abschreibern
zur Last zu legen sind4. Die Acribia der heutigen Philo-
logen war den mittelalterlichen Kompilatoren unbekannt;
ja, wir können wohl hinzufügen, sie war ihnen, bei den
unzureichenden ‘Büchereien, die dem einzelnen zur Ver-
fügung standen, eine Sache der Unmöglichkeit.
Schliesslich findet man in unserm Kommentar noch die
Erklärung der in unsern Tafeln abgedruckten Miniaturen,
so oft dieselbe einige Schwierigkeit bietet.
0)
0
o
0
CM
0
0
o
œ
0
2
0
sor an der Universität in Paris, f 1178.
:d. J. de Rothschild, I, p. ix.
Nicolaus von Lira und Luther, im Archiv für wissensch. Erforschung des Alten Testaments, IV (1869).
nd XLII der Ausgabe von Oesterley.
unter denen wohl die Gesta
ie Legenda aurea des Domini-
besonders aber die Historia
pR1 in erster Linie zu nennen
hnps-la, sagt Richard Simon
Nouveau Testament (Bd. II,
estimé pour l’Ecriture Sainte
la été traduit dans plusieurs
nit la “Bible que de la manière
, et avec ses gloses. Cet usage
DRITTER TEIL. - KOMMENTAR. - VORBEMERKUNGEN
Da das Speculum einen guten Teil der katholischen
Lehre umfasst, würde der Kommentar, den man vom theo-
logischen Standpunkt aus über denselben schreiben
könnte, fast ins unendliche gehen. Wir haben uns daher
in diesem Stücke auf das wesentliche beschränkt. Wo
eine theologische Erklärung notwendig war, haben wir
sie, soviel wie möglich, den Werken entnommen, welche
der Verfasser des Speculum gewiss gelesen hatte. Man
wird sehen, dass er wohl Dominikaner war. Darum haben
wir uns über theologische Fragen von der Summa des
grossen Theologen des Dominikanerordens, Thomas von
Aquino, belehren lassen.
Das Speculum enthält eine grosse Anzahl von Bibel-
stellen, die mehr oder weniger Verbatim den Heiligen
Schriften entnommen sind. In unserer kritischen Ausgabe
des lateinischen Textes haben wir auf diese Stellen hin-
gewiesen; im Kommentar brauchen wir nicht mehr
darauf zurückzukommen. Dagegen wird er die Schrift-
abschnitte angeben, denen die im Speculum angezo-
genen biblischen Geschichten entlehnt sind. Mit den
Erzählungen aus der Profangeschichte, die als Vorbilder
der heilsgeschichtlichen Begebenheiten behandelt werden,
werden wir in ähnlicher Weise verfahren. Mit andern
Worten, unser Kommentar des Speculum wird sich in
erster Linie mit den Quellen dieses Werks beschäftigen.
Mit der Annahme, dass der Verfasser des Speculum die
alte Litteratur oder auch nur die Bibel in ihrem eigent-
lichen Wortlaute kannte, würde man gewaltig irren. Vor
der Renaissance hat man die Profanschriftsteller des Alter-
ment de la Bible : les legendes empruntées aux Apocryphes y
figuraient au même titre que les épisodes tirés des livres cano-
niques ; bien plus, les traditions talmudiques y occupaient une
certaine place*. So hat z. B. der Rabbi Raschi einen be-
deutenden Einfluss auf Nicolaus de Lira ausgeübt3. Die
Kunst des Mittelalters liebte es, die Synagoge mit einer
Binde auf den Augen und einem gebrochenen Szepter in
der Hand darzustellen : dieses giebt uns aber keinen
richtigen Begriff von dem Ansehen, in dem die jüdischen
Fabeln damals standen. Der Verfasser des Speculum ist
ebensowenig wie die übrigen katholischen Schriftsteller
des Mittelalters dem Einfluss der morgenländischen Sagen
entgangen. In Handschriften des Speculum finden wir
Randglossen, welche mit einer gewissen Verwunderung
diese Tatsache hervorheben. Thalmudica fabella, liest man
in einer Münchner Hs. (clm 23433), am Rand der Er-
zählung von Tharbis, jener Königstochter von Saba, welche
sich in Moses verliebte. Dies schmeckt auch nach dem Thal-
mud, besagt eine andere Randbemerkung derselben Hs.
von der hundertjährigen Trauer Adams und Evas nach
dem Tode Abels.
Diese morgenländischen Sagen, welche sich der Leicht-
gläubigkeit des mittelalterlichen Katholizismus aufgedrängt
hatten, sind für den Folkloristen von hohem Wert. Da
sie den Gläubigen ebenso bekannt waren wie die echt
biblischen Geschichten haben sie zu bildlichen Darstell-
ungen geführt, deren Erklärung man vergeblich in der
Bibel suchen würde. Überall, wo derartige Sagen im Specu-
lum vorkommen, waren wir bemüht, über dieselben
tums, und vor der Reformation die Bibel kaum gelesen.
Ganz richtig sagt darum der Herausgeber des Mistère du
Vieil Testament (Bd. I, p. ix) : Ce serait mal reconnaître
l’esprit du Moyen âge, que de supposer que les auteurs des
Mystères se sont inspirés directement du texte sacré. Der Ver-
fasser des Speculum humanae salvationis ist nach Art des
Mittelalters ein Compilator, ein Sammler, der sich nicht
für verpflichtet hält, auf die Urschriften zurückzugehen,
jgt, was er in den früheren
bestimmte Auskunft zu geben.
Unsere Tafeln geben die Hs. S in extenso, Text und
Bilder, sowie die Bilderreihe der in der Pariser Biblio-
thèque nationale befindlichen Hs. der Miélotschen Über-
setzung. In dem einen wie im andern dieser Codices steht
bei jedem Bild eine Rubrik, welche dessen Gegenstand
mitteilt und auch die in Betracht kommende Quelle an-
gibt. Diese oft mit Abkürzungen geschriebenen Rubriken
sind nicht immer leicht zu lesen. Wir bringen dieselben
CM
o
5
o
35
Herausgeber des Mistère du
pie Historia scolastica und die
rt, welche für das Mittelalter
lages ne dérivaient pas unique-
œ
CE
c:
s
o
O
□
ra
0)
O)
cü
O
d
CD
in unserm Kommentar am Anfang eines jeden Kapitels.
Man beachte wohl, dass die in den Rubriken stehenden
Quellenangaben nicht immer zutreffend sind ; mitunter
hat man den Eindruck, sie seien aufs Geratewohl hingesetzt
worden. Übrigens begegnen wir auch anderswo, z. B. in
den Gesta Romanorum, unrichtigen Quellenangaben, die
sei es dem Verfasser sei es auch nur den Abschreibern
zur Last zu legen sind4. Die Acribia der heutigen Philo-
logen war den mittelalterlichen Kompilatoren unbekannt;
ja, wir können wohl hinzufügen, sie war ihnen, bei den
unzureichenden ‘Büchereien, die dem einzelnen zur Ver-
fügung standen, eine Sache der Unmöglichkeit.
Schliesslich findet man in unserm Kommentar noch die
Erklärung der in unsern Tafeln abgedruckten Miniaturen,
so oft dieselbe einige Schwierigkeit bietet.
0)
0
o
0
CM
0
0
o
œ
0
2
0
sor an der Universität in Paris, f 1178.
:d. J. de Rothschild, I, p. ix.
Nicolaus von Lira und Luther, im Archiv für wissensch. Erforschung des Alten Testaments, IV (1869).
nd XLII der Ausgabe von Oesterley.
unter denen wohl die Gesta
ie Legenda aurea des Domini-
besonders aber die Historia
pR1 in erster Linie zu nennen
hnps-la, sagt Richard Simon
Nouveau Testament (Bd. II,
estimé pour l’Ecriture Sainte
la été traduit dans plusieurs
nit la “Bible que de la manière
, et avec ses gloses. Cet usage



