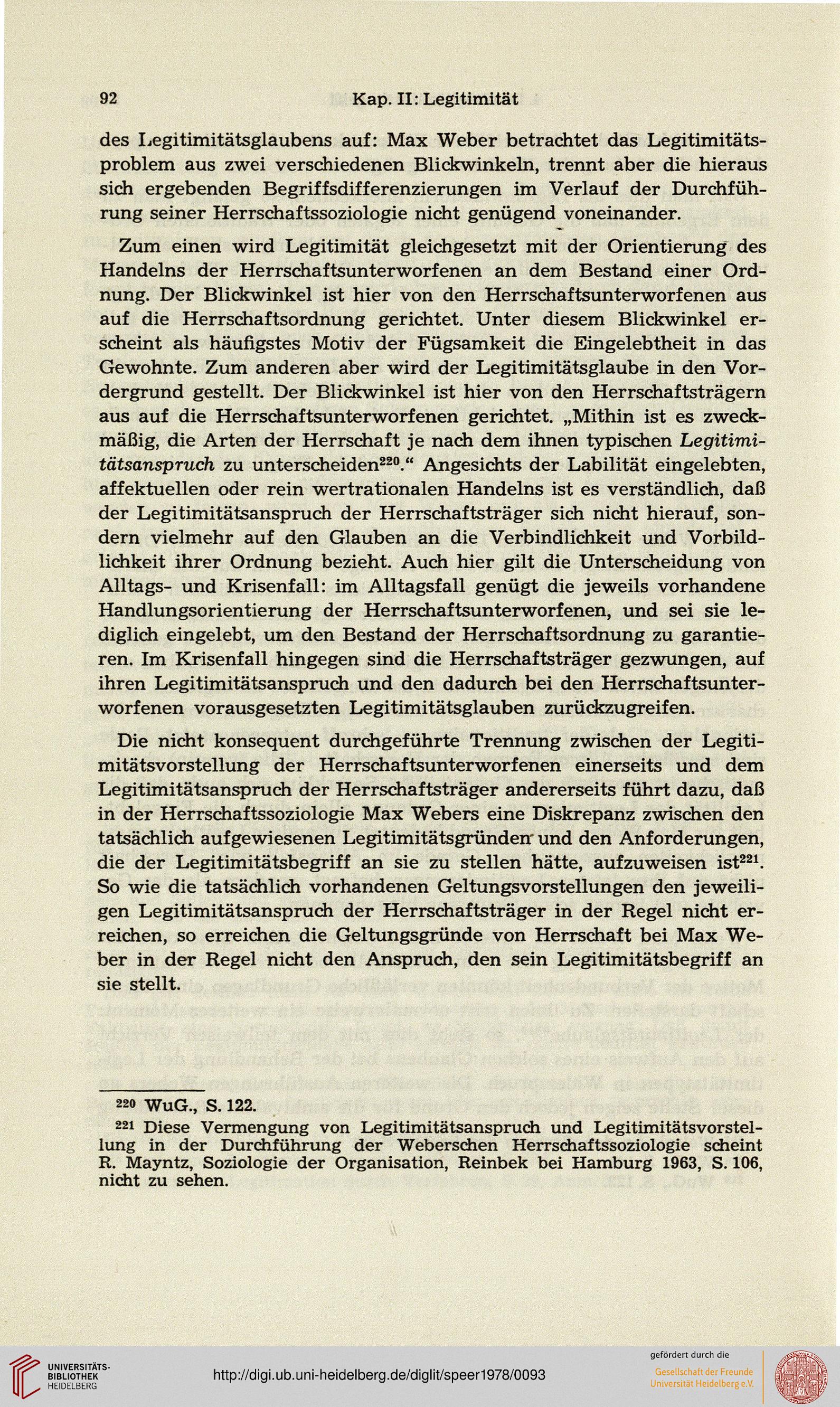92 Kap. II: Legitimität
des Legitimitätsglaubens auf: Max Weber betrachtet das Legitimitäts-
problem aus zwei verschiedenen Blickwinkeln, trennt aber die hieraus
sich ergebenden Begriffsdifferenzierungen im Verlauf der Durchfüh-
rung seiner Herrschaftssoziologie nicht genügend voneinander.
Zum einen wird Legitimität gleichgesetzt mit der Orientierung des
Handelns der Herrschaftsunterworfenen an dem Bestand einer Ord-
nung. Der Blickwinkel ist hier von den Herrschaftsunterworfenen aus
auf die Herrschaftsordnung gerichtet. Unter diesem Blickwinkel er-
scheint als häufigstes Motiv der Fügsamkeit die Eingelebtheit in das
Gewohnte. Zum anderen aber wird der Legitimitätsglaube in den Vor-
dergrund gestellt. Der Blickwinkel ist hier von den Herrschaftsträgern
aus aus die Herrschaftsunterworfenen gerichtet. „Mithin ist es zweck-
mäßig, die Arten der Herrschaft je nach dem ihnen typischen Legitimi-
tätsanspruch zu unterscheiden220." Angesichts der Labilität eingelebten,
affektuellen oder rein wertrationalen Handelns ist es verständlich, daß
der Legitimitätsanspruch der Herrschaftsträger sich nicht hierauf, son-
dern vielmehr auf den Glauben an die Verbindlichkeit und Vorbild-
lichkeit ihrer Ordnung bezieht. Auch hier gilt die Unterscheidung von
Alltags- und Krisenfall: im Alltagsfall genügt die jeweils vorhandene
Handlungsorientierung der Herrschaftsunterworfenen, und sei sie le-
diglich eingelebt, um den Bestand der Herrschaftsordnung zu garantie-
ren. Im Krisenfall hingegen sind die Herrschaftsträger gezwungen, auf
ihren Legitimitätsanspruch und den dadurch bei den Herrschaftsunter-
worfenen vorausgesetzten Legitimitätsglauben zurückzugreisen.
Die nicht konsequent durchgeführte Trennung zwischen der Legiti-
mitätsvorstellung der Herrschaftsunterworfenen einerseits und dem
Legitimitätsanspruch der Herrschaftsträger andererseits führt dazu, daß
in der Herrschaftssoziologie Max Webers eine Diskrepanz zwischen den
tatsächlich aufgewiesenen Legitimitätsgründen' und den Ansorderungen,
die der Legitimitätsbegriff an sie zu stellen hätte, aufzuweisen ist221.
So wie die tatsächlich vorhandenen Geltungsvorstellungen den jeweili-
gen Legitimitätsanspruch der Herrschaftsträger in der Regel nicht er-
reichen, so erreichen die Geltungsgründe von Herrschaft bei Max We-
ber in der Regel nicht den Anspruch, den sein Legitimitätsbegrifs an
sie stellt.
220 WuG., S. 122.
221 Diese Vermengung von Legitimitätsanspruch und Legitimitätsvorstel-
lung in der Durchführung der Weberschen Herrschaftssoziologie scheint
R. Mayntz, Soziologie der Organisation, Reinbek bei Hamburg 1963, S. 106,
nicht zu sehen.
des Legitimitätsglaubens auf: Max Weber betrachtet das Legitimitäts-
problem aus zwei verschiedenen Blickwinkeln, trennt aber die hieraus
sich ergebenden Begriffsdifferenzierungen im Verlauf der Durchfüh-
rung seiner Herrschaftssoziologie nicht genügend voneinander.
Zum einen wird Legitimität gleichgesetzt mit der Orientierung des
Handelns der Herrschaftsunterworfenen an dem Bestand einer Ord-
nung. Der Blickwinkel ist hier von den Herrschaftsunterworfenen aus
auf die Herrschaftsordnung gerichtet. Unter diesem Blickwinkel er-
scheint als häufigstes Motiv der Fügsamkeit die Eingelebtheit in das
Gewohnte. Zum anderen aber wird der Legitimitätsglaube in den Vor-
dergrund gestellt. Der Blickwinkel ist hier von den Herrschaftsträgern
aus aus die Herrschaftsunterworfenen gerichtet. „Mithin ist es zweck-
mäßig, die Arten der Herrschaft je nach dem ihnen typischen Legitimi-
tätsanspruch zu unterscheiden220." Angesichts der Labilität eingelebten,
affektuellen oder rein wertrationalen Handelns ist es verständlich, daß
der Legitimitätsanspruch der Herrschaftsträger sich nicht hierauf, son-
dern vielmehr auf den Glauben an die Verbindlichkeit und Vorbild-
lichkeit ihrer Ordnung bezieht. Auch hier gilt die Unterscheidung von
Alltags- und Krisenfall: im Alltagsfall genügt die jeweils vorhandene
Handlungsorientierung der Herrschaftsunterworfenen, und sei sie le-
diglich eingelebt, um den Bestand der Herrschaftsordnung zu garantie-
ren. Im Krisenfall hingegen sind die Herrschaftsträger gezwungen, auf
ihren Legitimitätsanspruch und den dadurch bei den Herrschaftsunter-
worfenen vorausgesetzten Legitimitätsglauben zurückzugreisen.
Die nicht konsequent durchgeführte Trennung zwischen der Legiti-
mitätsvorstellung der Herrschaftsunterworfenen einerseits und dem
Legitimitätsanspruch der Herrschaftsträger andererseits führt dazu, daß
in der Herrschaftssoziologie Max Webers eine Diskrepanz zwischen den
tatsächlich aufgewiesenen Legitimitätsgründen' und den Ansorderungen,
die der Legitimitätsbegriff an sie zu stellen hätte, aufzuweisen ist221.
So wie die tatsächlich vorhandenen Geltungsvorstellungen den jeweili-
gen Legitimitätsanspruch der Herrschaftsträger in der Regel nicht er-
reichen, so erreichen die Geltungsgründe von Herrschaft bei Max We-
ber in der Regel nicht den Anspruch, den sein Legitimitätsbegrifs an
sie stellt.
220 WuG., S. 122.
221 Diese Vermengung von Legitimitätsanspruch und Legitimitätsvorstel-
lung in der Durchführung der Weberschen Herrschaftssoziologie scheint
R. Mayntz, Soziologie der Organisation, Reinbek bei Hamburg 1963, S. 106,
nicht zu sehen.