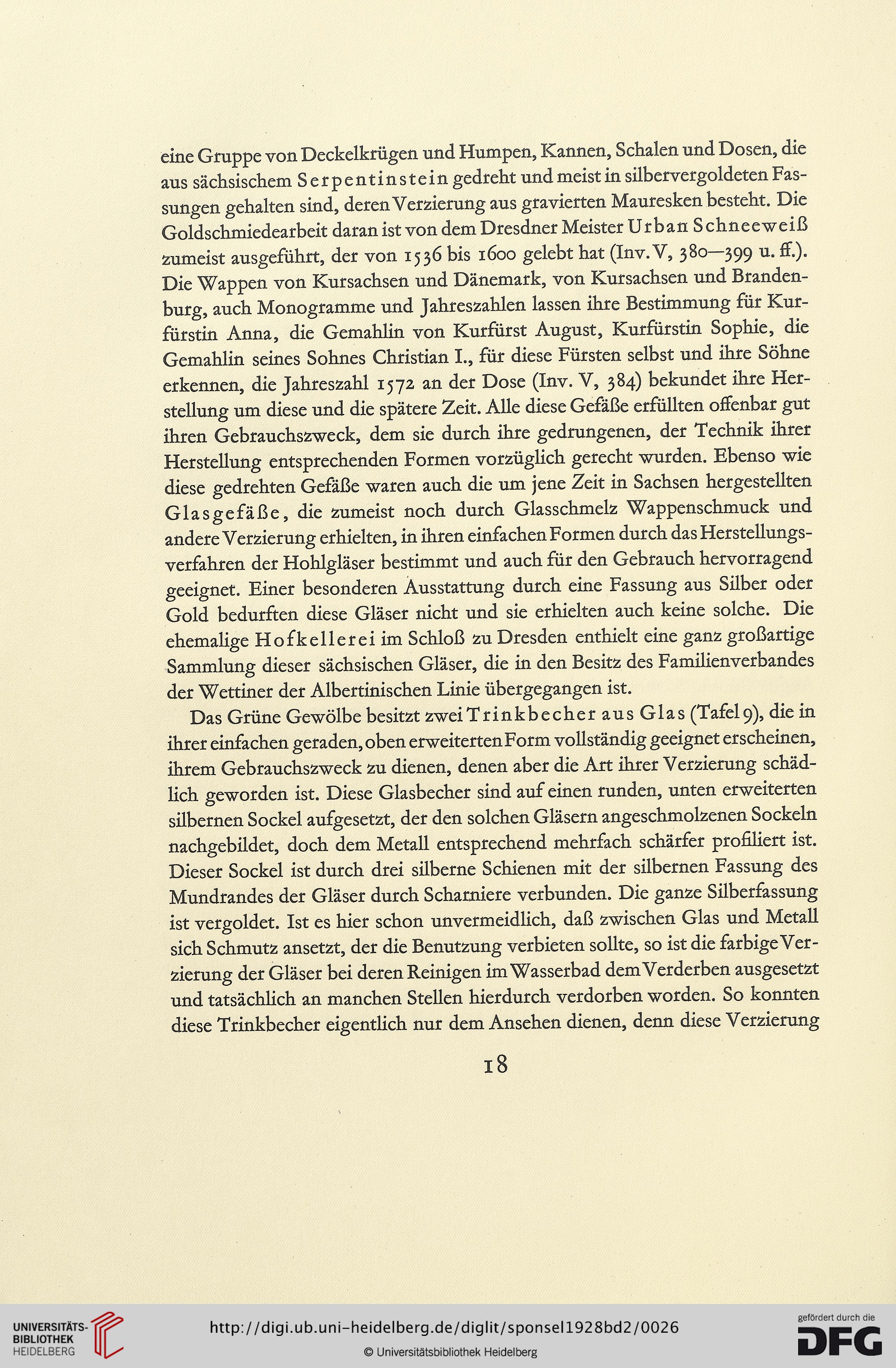eine Gmppe von Deckelkrügen und Humpen, Kannen, Schalen und Dosen, die
aus sächsischem Serpentinstein gedreht und meist in silbervergoldeten Fas-
sungen gehalten sind, deren Verzierung aus gravierten Mauresken besteht. Die
Goldschmiedearbeit daran ist von dem Dresdner Meister Urban Schneeweiß
zumeist ausgeführt, der von 1536 bis 1600 gelebt hat (Inv.V, 380—399 u. ff).
Die Wappen von Kursachsen und Dänemark, von Kursachsen und Branden-
burg, auch Monogramme und Jahreszahlen lassen ihre Bestimmung für Kur-
fürstin Anna, die Gemahlin von Kurfürst August, Kurfürstin Sophie, die
Gemahlin seines Sohnes Christian I., für diese Fürsten selbst und ihre Söhne
erkennen, die Jahreszahl 1572 an der Dose (Inv. V, 384) bekundet ihre Her-
stellung um diese und die spätere Zeit. Alle diese Gefäße erfüllten offenbar gut
ihren Gebrauchszweck, dem sie durch ihre gedrungenen, der Technik ihrer
Herstellung entsprechenden Formen vorzüglich gerecht wurden. Ebenso wie
diese gedrehten Gefäße waren auch die um jene Zeit in Sachsen hergestellten
Glasgefäße, die zumeist noch durch Glasschmelz Wappenschmuck und
andere Verzierung erhielten, in ihren einfachen Formen durch das Herstellungs-
verfahren der Hohlgläser bestimmt und auch für den Gebrauch hervorragend
geeignet. Einer besonderen Ausstattung durch eine Fassung aus Silber oder
Gold bedurften diese Gläser nicht und sie erhielten auch keine solche. Die
ehemalige Hofkellerei im Schloß zu Dresden enthielt eine ganz großartige
Sammlung dieser sächsischen Gläser, die in den Besitz des Familienverbandes
der Wettiner der Albertinischen Linie übergegangen ist.
Das Grüne Gewölbe besitzt zwei Trinkbecher aus Glas (Tafel 9), die in
ihrer einfachen geraden, oben erweiterten Form vollständig geeignet erscheinen,
ihrem Gebrauchszweck zu dienen, denen aber die Art ihrer Verzierung schäd-
lich geworden ist. Diese Glasbecher sind auf einen runden, unten erweiterten
silbernen Sockel aufgesetzt, der den solchen Gläsern angeschmolzenen Sockeln
nachgebildet, doch dem Metall entsprechend mehrfach schärfer profiliert ist.
Dieser Sockel ist durch drei silberne Schienen mit der silbernen Fassung des
Mundrandes der Gläser durch Scharniere verbunden. Die ganze Silberfassung
ist vergoldet. Ist es hier schon unvermeidlich, daß zwischen Glas und Metall
sich Schmutz ansetzt, der die Benutzung verbieten sollte, so ist die farbige Ver-
zierung der Gläser bei deren Reinigen im Wasserbad dem Verderben ausgesetzt
und tatsächlich an manchen Stellen hierdurch verdorben worden. So konnten
diese Trinkbecher eigentlich nur dem Ansehen dienen, denn diese Verzierung
aus sächsischem Serpentinstein gedreht und meist in silbervergoldeten Fas-
sungen gehalten sind, deren Verzierung aus gravierten Mauresken besteht. Die
Goldschmiedearbeit daran ist von dem Dresdner Meister Urban Schneeweiß
zumeist ausgeführt, der von 1536 bis 1600 gelebt hat (Inv.V, 380—399 u. ff).
Die Wappen von Kursachsen und Dänemark, von Kursachsen und Branden-
burg, auch Monogramme und Jahreszahlen lassen ihre Bestimmung für Kur-
fürstin Anna, die Gemahlin von Kurfürst August, Kurfürstin Sophie, die
Gemahlin seines Sohnes Christian I., für diese Fürsten selbst und ihre Söhne
erkennen, die Jahreszahl 1572 an der Dose (Inv. V, 384) bekundet ihre Her-
stellung um diese und die spätere Zeit. Alle diese Gefäße erfüllten offenbar gut
ihren Gebrauchszweck, dem sie durch ihre gedrungenen, der Technik ihrer
Herstellung entsprechenden Formen vorzüglich gerecht wurden. Ebenso wie
diese gedrehten Gefäße waren auch die um jene Zeit in Sachsen hergestellten
Glasgefäße, die zumeist noch durch Glasschmelz Wappenschmuck und
andere Verzierung erhielten, in ihren einfachen Formen durch das Herstellungs-
verfahren der Hohlgläser bestimmt und auch für den Gebrauch hervorragend
geeignet. Einer besonderen Ausstattung durch eine Fassung aus Silber oder
Gold bedurften diese Gläser nicht und sie erhielten auch keine solche. Die
ehemalige Hofkellerei im Schloß zu Dresden enthielt eine ganz großartige
Sammlung dieser sächsischen Gläser, die in den Besitz des Familienverbandes
der Wettiner der Albertinischen Linie übergegangen ist.
Das Grüne Gewölbe besitzt zwei Trinkbecher aus Glas (Tafel 9), die in
ihrer einfachen geraden, oben erweiterten Form vollständig geeignet erscheinen,
ihrem Gebrauchszweck zu dienen, denen aber die Art ihrer Verzierung schäd-
lich geworden ist. Diese Glasbecher sind auf einen runden, unten erweiterten
silbernen Sockel aufgesetzt, der den solchen Gläsern angeschmolzenen Sockeln
nachgebildet, doch dem Metall entsprechend mehrfach schärfer profiliert ist.
Dieser Sockel ist durch drei silberne Schienen mit der silbernen Fassung des
Mundrandes der Gläser durch Scharniere verbunden. Die ganze Silberfassung
ist vergoldet. Ist es hier schon unvermeidlich, daß zwischen Glas und Metall
sich Schmutz ansetzt, der die Benutzung verbieten sollte, so ist die farbige Ver-
zierung der Gläser bei deren Reinigen im Wasserbad dem Verderben ausgesetzt
und tatsächlich an manchen Stellen hierdurch verdorben worden. So konnten
diese Trinkbecher eigentlich nur dem Ansehen dienen, denn diese Verzierung