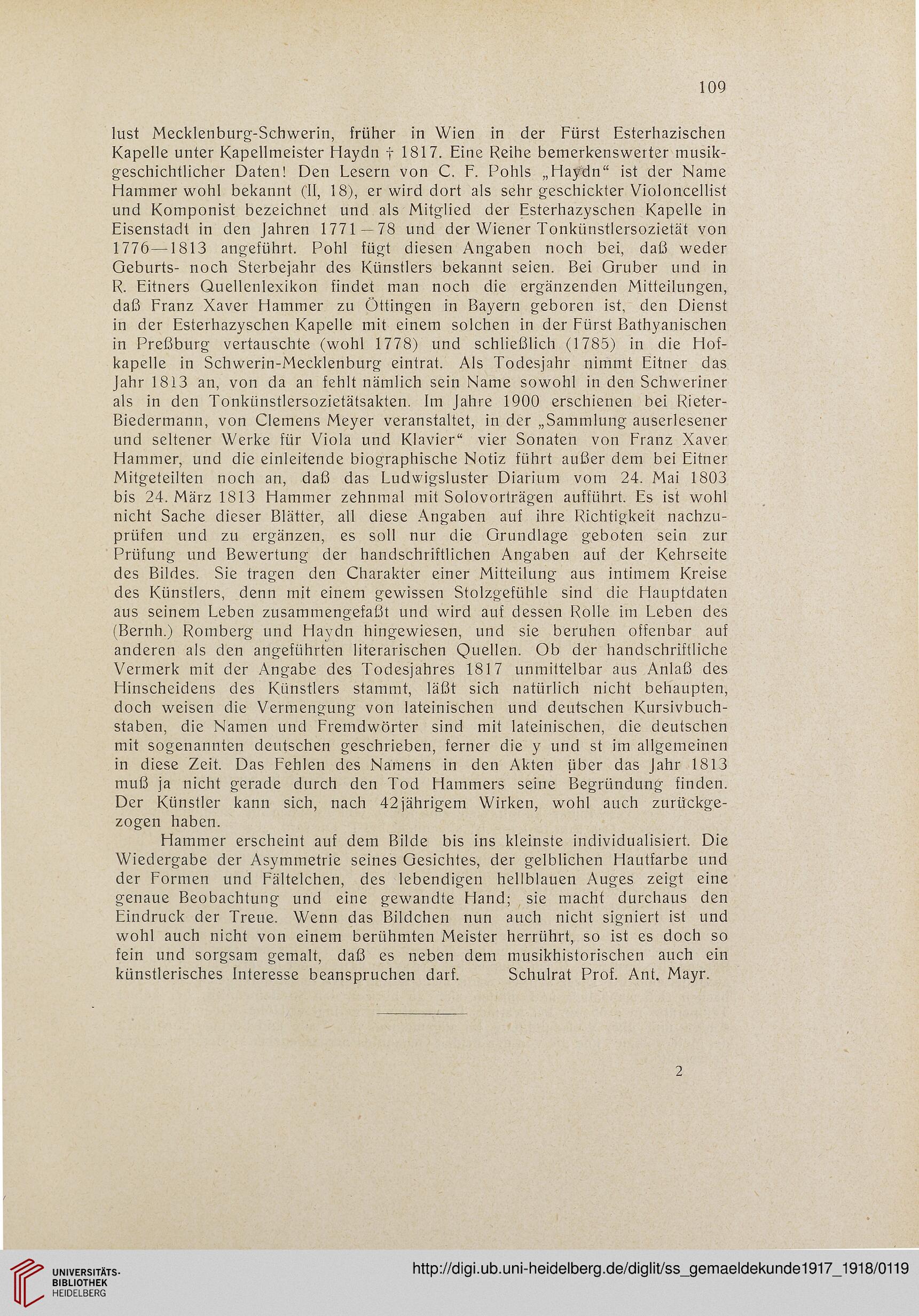109
lust Mecklenburg-Schwerin, früher in Wien in der Fürst Esterhazischen
Kapelle unter Kapellmeister Haydn f 1817. Eine Reihe bemerkenswerter musik-
geschichtlicher Daten! Den Lesern von C. F. Pohls „Haydn“ ist der Name
Hammer wohl bekannt (II, 18), er wird dort als sehr geschickter Violoncellist
und Komponist bezeichnet und als Mitglied der Esterhazyschen Kapelle in
Eisenstadt in den Jahren 1771 — 78 und der Wiener Tonkünstlersozietät von
1776—1813 angeführt. Pohl fügt diesen Angaben noch bei, daß weder
Geburts- noch Sterbejahr des Künstlers bekannt seien. Bei Gruber und in
R. Eitners Quellenlexikon findet man noch die ergänzenden Mitteilungen,
daß Franz Xaver Hammer zu Öttingen in Bayern geboren ist, den Dienst
in der Esterhazyschen Kapelle mit einem solchen in der Fürst Bathyanischen
in Preßburg vertauschte (wohl 1778) und schließlich (1785) in die Hof-
kapelle in Schwerin-Mecklenburg eintrat. Als Todesjahr nimmt Eitner das
Jahr 1813 an, von da an fehlt nämlich sein Name sowohl in den Schweriner
als in den Tonkünstlersozietätsakten. Im Jahre 1900 erschienen bei Rieter-
Biedermann, von Clemens Meyer veranstaltet, in der „Sammlung auserlesener
und seltener Werke für Viola und Klavier“ vier Sonaten von Franz Xaver
Hammer, und die einleitende biographische Notiz führt außer dem bei Eitner
Mitgeteilten noch an, daß das Ludwigsluster Diarium vom 24. Mai 1803
bis 24. März 1813 Hammer zehnmal mit Solovorträgen aufführt. Es ist wohl
nicht Sache dieser Blätter, all diese Angaben auf ihre Richtigkeit nachzu-
prüfen und zu ergänzen, es soll nur die Grundlage geboten sein zur
Prüfung und Bewertung der handschriftlichen Angaben auf der Kehrseite
des Bildes. Sie tragen den Charakter einer Mitteilung aus intimem Kreise
des Künstlers, denn mit einem gewissen Stolzgefühle sind die Hauptdaten
aus seinem Leben zusammengefaßt und wird auf dessen Rolle im Leben des
(Bernh.) Romberg und Haydn hingewiesen, und sie beruhen offenbar auf
anderen als den angeführten literarischen Quellen. Ob der handschriftliche
Vermerk mit der Angabe des Todesjahres 1817 unmittelbar aus Anlaß des
Hinscheidens des Künstlers stammt, läßt sich natürlich nicht behaupten,
doch weisen die Vermengung von lateinischen und deutschen Kursivbuch-
staben, die Namen und Fremdwörter sind mit lateinischen, die deutschen
mit sogenannten deutschen geschrieben, ferner die y und st im allgemeinen
in diese Zeit. Das Fehlen des Namens in den Akten über das Jahr 1813
muß ja nicht gerade durch den Tod Hammers seine Begründung finden.
Der Künstler kann sich, nach 42jährigem Wirken, wohl auch zurückge-
zogen haben.
Hammer erscheint auf dem Bilde bis ins kleinste individualisiert. Die
Wiedergabe der Asymmetrie seines Gesichtes, der gelblichen Hautfarbe und
der Formen und Fältelchen, des lebendigen hellblauen Auges zeigt eine
genaue Beobachtung und eine gewandte Hand; sie macht durchaus den
Eindruck der Treue. Wenn das Bildchen nun auch nicht signiert ist und
wohl auch nicht von einem berühmten Meister herrührt, so ist es doch so
fein und sorgsam gemalt, daß es neben dem musikhistorischen auch ein
künstlerisches Interesse beanspruchen darf. Schulrat Prof. Ant. Mayr.
2
lust Mecklenburg-Schwerin, früher in Wien in der Fürst Esterhazischen
Kapelle unter Kapellmeister Haydn f 1817. Eine Reihe bemerkenswerter musik-
geschichtlicher Daten! Den Lesern von C. F. Pohls „Haydn“ ist der Name
Hammer wohl bekannt (II, 18), er wird dort als sehr geschickter Violoncellist
und Komponist bezeichnet und als Mitglied der Esterhazyschen Kapelle in
Eisenstadt in den Jahren 1771 — 78 und der Wiener Tonkünstlersozietät von
1776—1813 angeführt. Pohl fügt diesen Angaben noch bei, daß weder
Geburts- noch Sterbejahr des Künstlers bekannt seien. Bei Gruber und in
R. Eitners Quellenlexikon findet man noch die ergänzenden Mitteilungen,
daß Franz Xaver Hammer zu Öttingen in Bayern geboren ist, den Dienst
in der Esterhazyschen Kapelle mit einem solchen in der Fürst Bathyanischen
in Preßburg vertauschte (wohl 1778) und schließlich (1785) in die Hof-
kapelle in Schwerin-Mecklenburg eintrat. Als Todesjahr nimmt Eitner das
Jahr 1813 an, von da an fehlt nämlich sein Name sowohl in den Schweriner
als in den Tonkünstlersozietätsakten. Im Jahre 1900 erschienen bei Rieter-
Biedermann, von Clemens Meyer veranstaltet, in der „Sammlung auserlesener
und seltener Werke für Viola und Klavier“ vier Sonaten von Franz Xaver
Hammer, und die einleitende biographische Notiz führt außer dem bei Eitner
Mitgeteilten noch an, daß das Ludwigsluster Diarium vom 24. Mai 1803
bis 24. März 1813 Hammer zehnmal mit Solovorträgen aufführt. Es ist wohl
nicht Sache dieser Blätter, all diese Angaben auf ihre Richtigkeit nachzu-
prüfen und zu ergänzen, es soll nur die Grundlage geboten sein zur
Prüfung und Bewertung der handschriftlichen Angaben auf der Kehrseite
des Bildes. Sie tragen den Charakter einer Mitteilung aus intimem Kreise
des Künstlers, denn mit einem gewissen Stolzgefühle sind die Hauptdaten
aus seinem Leben zusammengefaßt und wird auf dessen Rolle im Leben des
(Bernh.) Romberg und Haydn hingewiesen, und sie beruhen offenbar auf
anderen als den angeführten literarischen Quellen. Ob der handschriftliche
Vermerk mit der Angabe des Todesjahres 1817 unmittelbar aus Anlaß des
Hinscheidens des Künstlers stammt, läßt sich natürlich nicht behaupten,
doch weisen die Vermengung von lateinischen und deutschen Kursivbuch-
staben, die Namen und Fremdwörter sind mit lateinischen, die deutschen
mit sogenannten deutschen geschrieben, ferner die y und st im allgemeinen
in diese Zeit. Das Fehlen des Namens in den Akten über das Jahr 1813
muß ja nicht gerade durch den Tod Hammers seine Begründung finden.
Der Künstler kann sich, nach 42jährigem Wirken, wohl auch zurückge-
zogen haben.
Hammer erscheint auf dem Bilde bis ins kleinste individualisiert. Die
Wiedergabe der Asymmetrie seines Gesichtes, der gelblichen Hautfarbe und
der Formen und Fältelchen, des lebendigen hellblauen Auges zeigt eine
genaue Beobachtung und eine gewandte Hand; sie macht durchaus den
Eindruck der Treue. Wenn das Bildchen nun auch nicht signiert ist und
wohl auch nicht von einem berühmten Meister herrührt, so ist es doch so
fein und sorgsam gemalt, daß es neben dem musikhistorischen auch ein
künstlerisches Interesse beanspruchen darf. Schulrat Prof. Ant. Mayr.
2