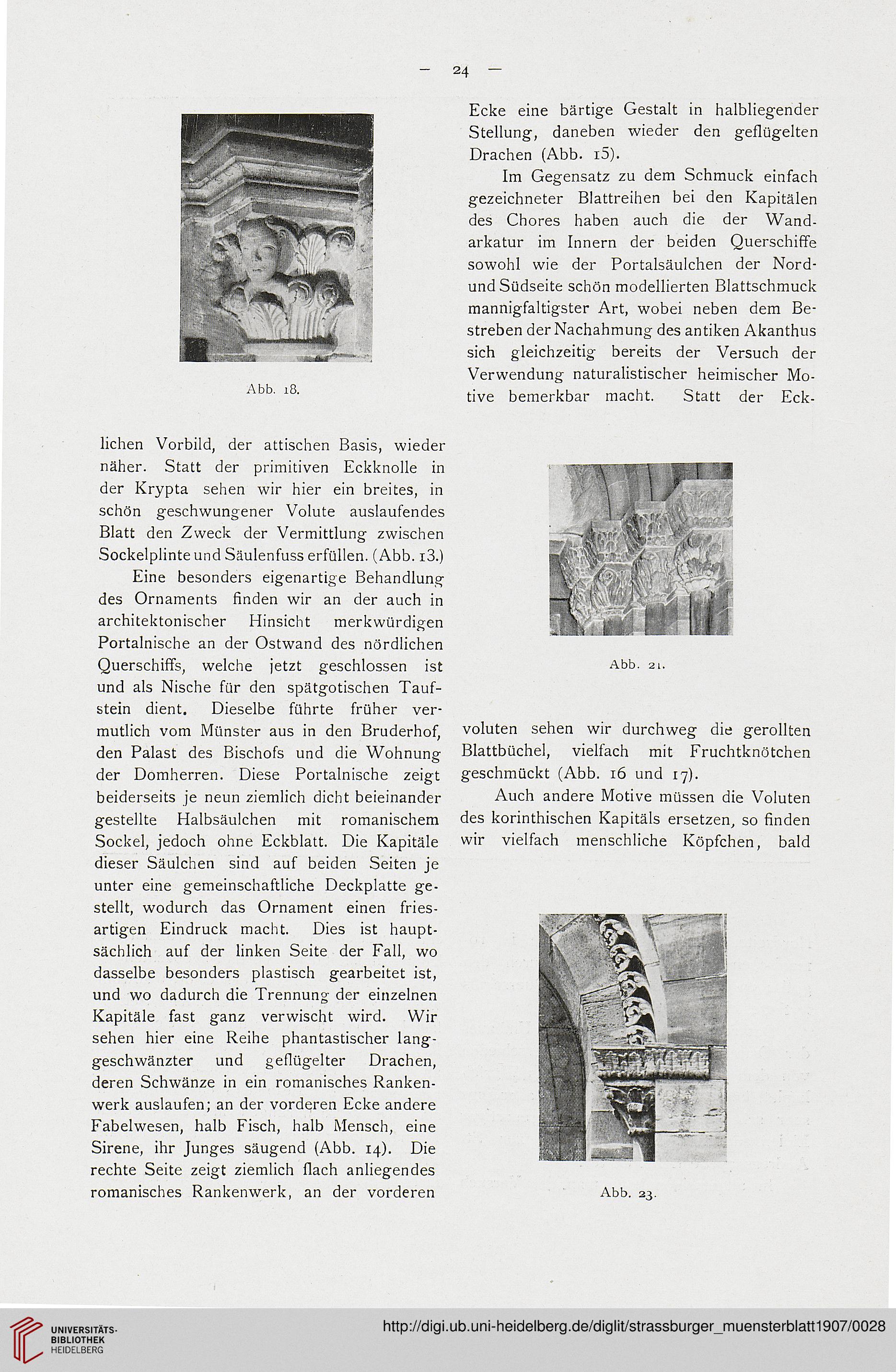24
Abb. 18.
liehen Vorbild, der attischen Basis, wieder
näher. Statt der primitiven Eckknolle in
der Krypta sehen wir hier ein breites, in
schön geschwungener Volute auslaufendes
Blatt den Zweck der Vermittlung zwischen
Sockelplinte und Säulenfuss erfüllen. (Abb. i3.)
Eine besonders eigenartige Behandlung
des Ornaments finden wir an der auch in
architektonischer Hinsicht merkwürdigen
Portalnische an der Ostwand des nördlichen
Querschiffs, welche jetzt geschlossen ist
und als Nische für den spätgotischen Tauf-
stein dient. Dieselbe führte früher ver-
mutlich vom Münster aus in den Bruderhof,
den Palast des Bischofs und die Wohnung
der Domherren. Diese Portalnische zeigt
beiderseits je neun ziemlich dicht beieinander
gestellte Halbsäulchen mit romanischem
Sockel, jedoch ohne Eckblatt. Die Kapitale
dieser Säulchen sind auf beiden Seiten je
unter eine gemeinschaftliche Deckplatte ge-
stellt, wodurch das Ornament einen fries-
artigen Eindruck macht. Dies ist haupt-
sächlich auf der linken Seite der Fall, wo
dasselbe besonders plastisch gearbeitet ist,
und wo dadurch die Trennung der einzelnen
Kapitale fast ganz verwischt wird. Wir
sehen hier eine Reihe phantastischer lang-
geschwänzter und geflügelter Drachen,
deren Schwänze in ein romanisches Ranken-
werk auslaufen; an der vorderen Ecke andere
Fabelwesen, halb Fisch, halb Mensch, eine
Sirene, ihr Junges säugend (Abb. 14). Die
rechte Seite zeigt ziemlich flach anliegendes
romanisches Rankenwerk, an der vorderen
Ecke eine bärtige Gestalt in halbliegender
Stellung, daneben wieder den geflügelten
Drachen (Abb. i5).
Im Gegensatz zu dem Schmuck einfach
gezeichneter Blattreihen bei den Kapitalen
des Chores haben auch die der Wand-
arkatur im Innern der beiden Querschiffe
sowohl wie der Portalsäulchen der Nord-
und Südseite schön modellierten Blattschmuck
mannigfaltigster Art, wobei neben dem Be-
streben der Nachahmung des antiken Akanthus
sich gleichzeitig bereits der Versuch der
Verwendung naturalistischer heimischer Mo-
tive bemerkbar macht. Statt der Eck-
Abb. 2i.
voluten sehen wir durchweg die gerollten
Blattbüchel, vielfach mit Fruchtknötchen
geschmückt (Abb. 16 und 17).
Auch andere Motive müssen die Voluten
des korinthischen Kapitals ersetzen, so finden
wir vielfach menschliche Köpfchen, bald
Abb. 23.
Abb. 18.
liehen Vorbild, der attischen Basis, wieder
näher. Statt der primitiven Eckknolle in
der Krypta sehen wir hier ein breites, in
schön geschwungener Volute auslaufendes
Blatt den Zweck der Vermittlung zwischen
Sockelplinte und Säulenfuss erfüllen. (Abb. i3.)
Eine besonders eigenartige Behandlung
des Ornaments finden wir an der auch in
architektonischer Hinsicht merkwürdigen
Portalnische an der Ostwand des nördlichen
Querschiffs, welche jetzt geschlossen ist
und als Nische für den spätgotischen Tauf-
stein dient. Dieselbe führte früher ver-
mutlich vom Münster aus in den Bruderhof,
den Palast des Bischofs und die Wohnung
der Domherren. Diese Portalnische zeigt
beiderseits je neun ziemlich dicht beieinander
gestellte Halbsäulchen mit romanischem
Sockel, jedoch ohne Eckblatt. Die Kapitale
dieser Säulchen sind auf beiden Seiten je
unter eine gemeinschaftliche Deckplatte ge-
stellt, wodurch das Ornament einen fries-
artigen Eindruck macht. Dies ist haupt-
sächlich auf der linken Seite der Fall, wo
dasselbe besonders plastisch gearbeitet ist,
und wo dadurch die Trennung der einzelnen
Kapitale fast ganz verwischt wird. Wir
sehen hier eine Reihe phantastischer lang-
geschwänzter und geflügelter Drachen,
deren Schwänze in ein romanisches Ranken-
werk auslaufen; an der vorderen Ecke andere
Fabelwesen, halb Fisch, halb Mensch, eine
Sirene, ihr Junges säugend (Abb. 14). Die
rechte Seite zeigt ziemlich flach anliegendes
romanisches Rankenwerk, an der vorderen
Ecke eine bärtige Gestalt in halbliegender
Stellung, daneben wieder den geflügelten
Drachen (Abb. i5).
Im Gegensatz zu dem Schmuck einfach
gezeichneter Blattreihen bei den Kapitalen
des Chores haben auch die der Wand-
arkatur im Innern der beiden Querschiffe
sowohl wie der Portalsäulchen der Nord-
und Südseite schön modellierten Blattschmuck
mannigfaltigster Art, wobei neben dem Be-
streben der Nachahmung des antiken Akanthus
sich gleichzeitig bereits der Versuch der
Verwendung naturalistischer heimischer Mo-
tive bemerkbar macht. Statt der Eck-
Abb. 2i.
voluten sehen wir durchweg die gerollten
Blattbüchel, vielfach mit Fruchtknötchen
geschmückt (Abb. 16 und 17).
Auch andere Motive müssen die Voluten
des korinthischen Kapitals ersetzen, so finden
wir vielfach menschliche Köpfchen, bald
Abb. 23.