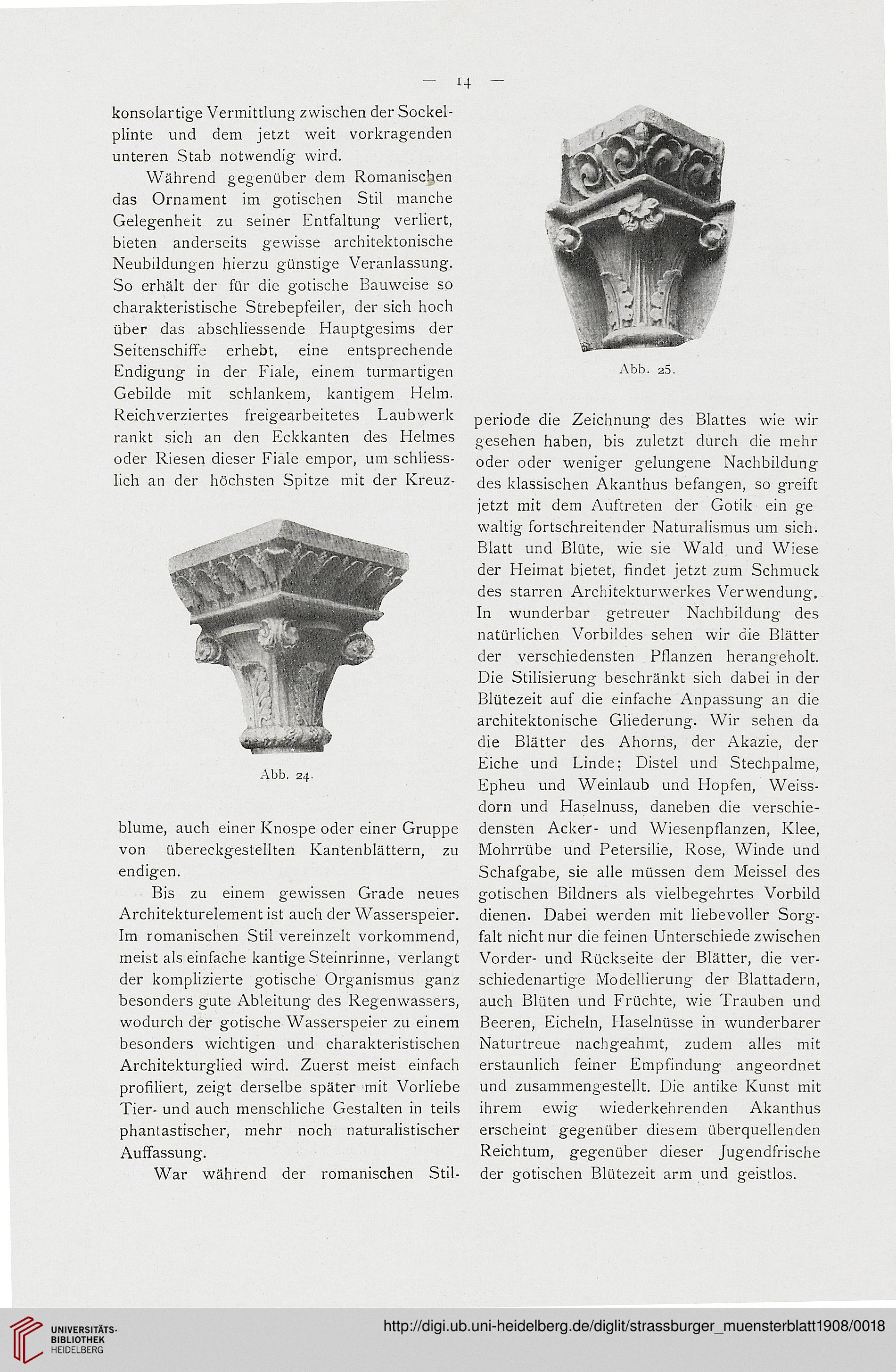14
konsolartige Vermittlung zwischen der Sockel-
plinte und dem jetzt weit vorkragenden
unteren Stab notwendig wird.
Während gegenüber dem Romanischen
das Ornament im gotischen Stil manche
Gelegenheit zu seiner Entfaltung verliert,
bieten anderseits gewisse architektonische
Neubildungen hierzu günstige Veranlassung.
So erhält der für die gotische Bauweise so
charakteristische Strebepfeiler, der sich hoch
über das abschliessende Hauptgesims der
Seitenschiffe erhebt, eine entsprechende
Endigung in der Fiale, einem turmartigen
Gebilde mit schlankem, kantigem Helm.
Reichverziertes freigearbeitetes Laubwerk
rankt sich an den Eckkanten des Helmes
oder Riesen dieser Fiale empor, um schliess-
lich an der höchsten Spitze mit der Kreuz-
Abb. 24.
blume, auch einer Knospe oder einer Gruppe
von übereckgestellten Kantenblättern, zu
endigen.
Bis zu einem gewissen Grade neues
Architekturelement ist auch der Wasserspeier.
Im romanischen Stil vereinzelt vorkommend,
meist als einfache kantige Steinrinne, verlangt
der komplizierte gotische Organismus ganz
besonders gute Ableitung des Regenwassers,
wodurch der gotische Wasserspeier zu einem
besonders wichtigen und charakteristischen
Architekturglied wird. Zuerst meist einfach
profiliert, zeigt derselbe später mit Vorliebe
Tier- und auch menschliche Gestalten in teils
phantastischer, mehr noch naturalistischer
Auffassung.
War während der romanischen Stil-
Abb. 2.5.
periode die Zeichnung des Blattes wie wir
gesehen haben, bis zuletzt durch die mehr
oder oder weniger gelungene Nachbildung
des klassischen Akanthus befangen, so greift
jetzt mit dem Auftreten der Gotik ein ge
waltig fortschreitender Naturalismus um sich.
Blatt und Blüte, wie sie Wald und Wiese
der Heimat bietet, findet jetzt zum Schmuck
des starren Architekturwerkes Verwendung,
In wunderbar getreuer Nachbildung des
natürlichen Vorbildes sehen wir die Blätter
der verschiedensten Pflanzen herangeholt.
Die Stilisierung beschränkt sich dabei in der
Blütezeit auf die einfache Anpassung an die
architektonische Gliederung. Wir sehen da
die Blätter des Ahorns, der Akazie, der
Eiche und Linde; Distel und Stechpalme,
Epheu und Weinlaub und Hopfen, Weiss-
dorn und Haselnuss, daneben die verschie-
densten Acker- und Wiesenpflanzen, Klee,
Mohrrübe und Petersilie, Rose, Winde und
Schafgabe, sie alle müssen dem Meissei des
gotischen Bildners als vielbegehrtes Vorbild
dienen. Dabei werden mit liebevoller Sorg-
falt nicht nur die feinen Unterschiede zwischen
Vorder- und Rückseite der Blätter, die ver-
schiedenartige Modellierung der Blattadern,
auch Blüten und Früchte, wie Trauben und
Beeren, Eicheln, Haselnüsse in wunderbarer
Naturtreue nachgeahmt, zudem alles mit
erstaunlich feiner Empfindung angeordnet
und zusammengestellt. Die antike Kunst mit
ihrem ewig wiederkehrenden Akanthus
erscheint gegenüber diesem überquellenden
Reichtum, gegenüber dieser Jugendfrische
der gotischen Blütezeit arm und geistlos.
konsolartige Vermittlung zwischen der Sockel-
plinte und dem jetzt weit vorkragenden
unteren Stab notwendig wird.
Während gegenüber dem Romanischen
das Ornament im gotischen Stil manche
Gelegenheit zu seiner Entfaltung verliert,
bieten anderseits gewisse architektonische
Neubildungen hierzu günstige Veranlassung.
So erhält der für die gotische Bauweise so
charakteristische Strebepfeiler, der sich hoch
über das abschliessende Hauptgesims der
Seitenschiffe erhebt, eine entsprechende
Endigung in der Fiale, einem turmartigen
Gebilde mit schlankem, kantigem Helm.
Reichverziertes freigearbeitetes Laubwerk
rankt sich an den Eckkanten des Helmes
oder Riesen dieser Fiale empor, um schliess-
lich an der höchsten Spitze mit der Kreuz-
Abb. 24.
blume, auch einer Knospe oder einer Gruppe
von übereckgestellten Kantenblättern, zu
endigen.
Bis zu einem gewissen Grade neues
Architekturelement ist auch der Wasserspeier.
Im romanischen Stil vereinzelt vorkommend,
meist als einfache kantige Steinrinne, verlangt
der komplizierte gotische Organismus ganz
besonders gute Ableitung des Regenwassers,
wodurch der gotische Wasserspeier zu einem
besonders wichtigen und charakteristischen
Architekturglied wird. Zuerst meist einfach
profiliert, zeigt derselbe später mit Vorliebe
Tier- und auch menschliche Gestalten in teils
phantastischer, mehr noch naturalistischer
Auffassung.
War während der romanischen Stil-
Abb. 2.5.
periode die Zeichnung des Blattes wie wir
gesehen haben, bis zuletzt durch die mehr
oder oder weniger gelungene Nachbildung
des klassischen Akanthus befangen, so greift
jetzt mit dem Auftreten der Gotik ein ge
waltig fortschreitender Naturalismus um sich.
Blatt und Blüte, wie sie Wald und Wiese
der Heimat bietet, findet jetzt zum Schmuck
des starren Architekturwerkes Verwendung,
In wunderbar getreuer Nachbildung des
natürlichen Vorbildes sehen wir die Blätter
der verschiedensten Pflanzen herangeholt.
Die Stilisierung beschränkt sich dabei in der
Blütezeit auf die einfache Anpassung an die
architektonische Gliederung. Wir sehen da
die Blätter des Ahorns, der Akazie, der
Eiche und Linde; Distel und Stechpalme,
Epheu und Weinlaub und Hopfen, Weiss-
dorn und Haselnuss, daneben die verschie-
densten Acker- und Wiesenpflanzen, Klee,
Mohrrübe und Petersilie, Rose, Winde und
Schafgabe, sie alle müssen dem Meissei des
gotischen Bildners als vielbegehrtes Vorbild
dienen. Dabei werden mit liebevoller Sorg-
falt nicht nur die feinen Unterschiede zwischen
Vorder- und Rückseite der Blätter, die ver-
schiedenartige Modellierung der Blattadern,
auch Blüten und Früchte, wie Trauben und
Beeren, Eicheln, Haselnüsse in wunderbarer
Naturtreue nachgeahmt, zudem alles mit
erstaunlich feiner Empfindung angeordnet
und zusammengestellt. Die antike Kunst mit
ihrem ewig wiederkehrenden Akanthus
erscheint gegenüber diesem überquellenden
Reichtum, gegenüber dieser Jugendfrische
der gotischen Blütezeit arm und geistlos.