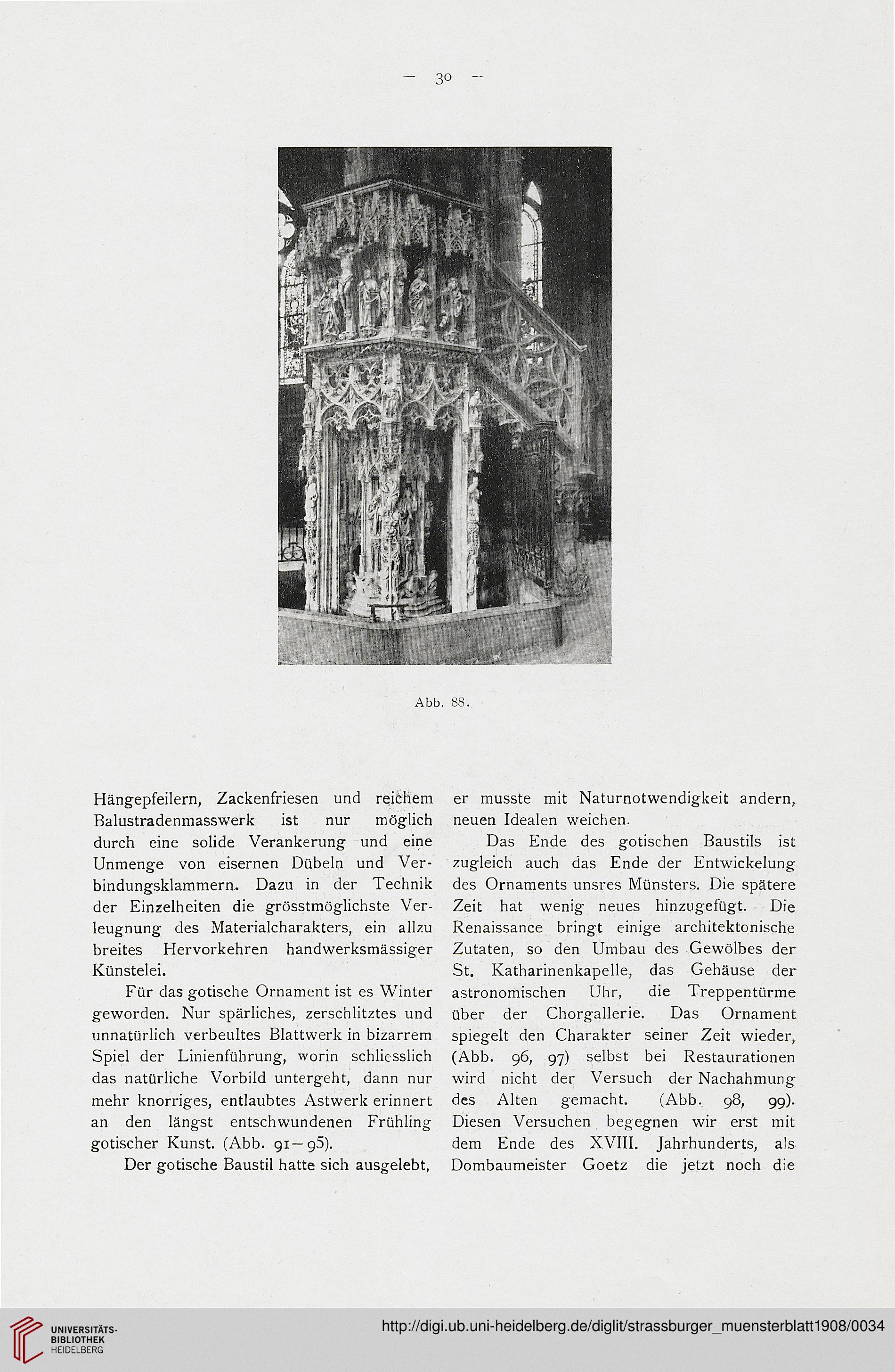30
Abb. 88.
Hängepfeilern, Zackenfriesen und reichem
Balustradenmasswerk ist nur möglich
durch eine solide Verankerung und eine
Unmenge von eisernen Dübeln und Ver-
bindungsklammern. Dazu in der Technik
der Einzelheiten die grösstmöglichste Ver-
leugnung des Materialcharakters, ein allzu
breites Hervorkehren handwerksmässiger
Künstelei.
Für das gotische Ornament ist es Winter
geworden. Nur spärliches, zerschlitztes und
unnatürlich verbeultes Blattwerk in bizarrem
Spiel der Linienführung, worin schliesslich
das natürliche Vorbild untergeht, dann nur
mehr knorriges, entlaubtes Astwerk erinnert
an den längst entschwundenen Frühling
gotischer Kunst. (Abb. 91—95).
Der gotische Baustil hatte sich ausgelebt,
er musste mit Naturnotwendigkeit andern,
neuen Idealen weichen.
Das Ende des gotischen Baustils ist
zugleich auch das Ende der Entwickelung
des Ornaments unsres Münsters. Die spätere
Zeit hat wenig neues hinzugefügt. Die
Renaissance bringt einige architektonische
Zutaten, so den Umbau des Gewölbes der
St. Katharinenkapelle, das Gehäuse der
astronomischen Uhr, die Treppentürme
über der Chorgallerie. Das Ornament
spiegelt den Charakter seiner Zeit wieder,
(Abb. 96, 97) selbst bei Restaurationen
wird nicht der Versuch der Nachahmung
des Alten gemacht. (Abb. 98, 99).
Diesen Versuchen begegnen wir erst mit
dem Ende des XVIII. Jahrhunderts, als
Dombaumeister Goetz die jetzt noch die
Abb. 88.
Hängepfeilern, Zackenfriesen und reichem
Balustradenmasswerk ist nur möglich
durch eine solide Verankerung und eine
Unmenge von eisernen Dübeln und Ver-
bindungsklammern. Dazu in der Technik
der Einzelheiten die grösstmöglichste Ver-
leugnung des Materialcharakters, ein allzu
breites Hervorkehren handwerksmässiger
Künstelei.
Für das gotische Ornament ist es Winter
geworden. Nur spärliches, zerschlitztes und
unnatürlich verbeultes Blattwerk in bizarrem
Spiel der Linienführung, worin schliesslich
das natürliche Vorbild untergeht, dann nur
mehr knorriges, entlaubtes Astwerk erinnert
an den längst entschwundenen Frühling
gotischer Kunst. (Abb. 91—95).
Der gotische Baustil hatte sich ausgelebt,
er musste mit Naturnotwendigkeit andern,
neuen Idealen weichen.
Das Ende des gotischen Baustils ist
zugleich auch das Ende der Entwickelung
des Ornaments unsres Münsters. Die spätere
Zeit hat wenig neues hinzugefügt. Die
Renaissance bringt einige architektonische
Zutaten, so den Umbau des Gewölbes der
St. Katharinenkapelle, das Gehäuse der
astronomischen Uhr, die Treppentürme
über der Chorgallerie. Das Ornament
spiegelt den Charakter seiner Zeit wieder,
(Abb. 96, 97) selbst bei Restaurationen
wird nicht der Versuch der Nachahmung
des Alten gemacht. (Abb. 98, 99).
Diesen Versuchen begegnen wir erst mit
dem Ende des XVIII. Jahrhunderts, als
Dombaumeister Goetz die jetzt noch die