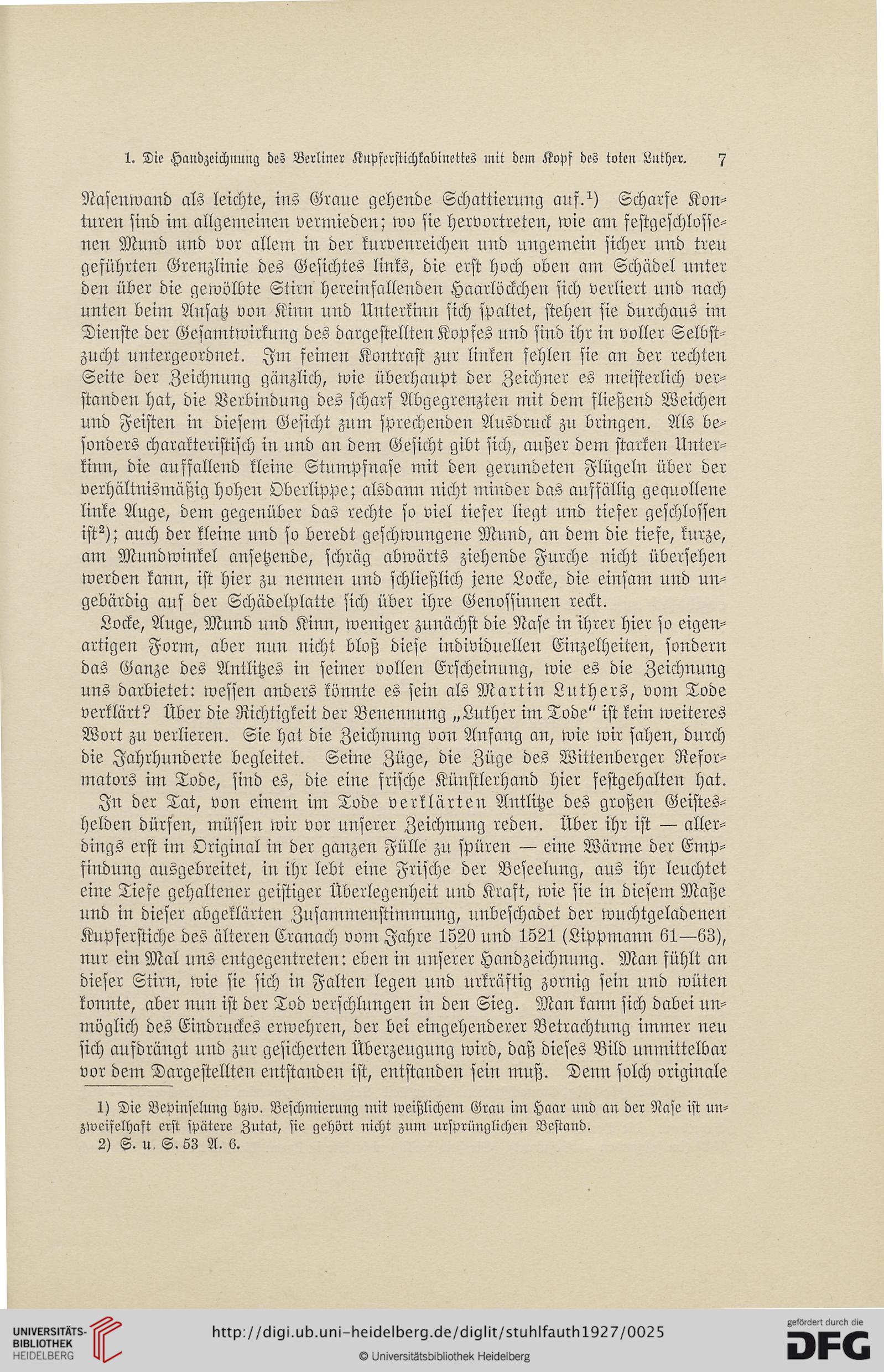1. Die Handzeichnung des Berliner Kupferstichkabincttes mit dcm Kopf des toteu Luther. 7
Nasenwand als leichte, ins Graue gehende Schattierung auf?) Scharfe Kon-
turen sind im allgemeinen vermieden; wo sie hervvrtreten, wie am feftgeschlosse-
nen Mund irnd vor allem in der kurvenreichen und ungemein sicher und treu
geführten Grenzlinie des Gesichtes links, die erft hoch oben am Schädel unter
den über die gewölbte Stirn hereinfallenden Haarlöckchen sich verliert nnd nach
unten beim Ansatz von Kinn und Unterkinn sich spaltet, stehen sie durchaus im
Dienste der Gesamtwirkung des dargestellten Kopfes nnd sind ihr in voller Selbst-
zucht untergeordnet. Jm feinen Kontrast zur linken fehlen sie an der rechten
Seite der Zeichnung gänzlich, wie überhaupt der Zeichner es meisterlich ver-
standen hat, die Berbindung des scharf Abgegrenzten mit dem fließend Weichen
und Feisten in diesem Gesicht zum sprechenden Ausdruck zu bringen. Äls be-
sonders charakteristisch in und an dem Gesicht gibt sich, außer dem starken Unter-
kinn, die auffallend kleine Stnmpfnase mit den gerundeten Flügeln über der
verhältnismäßig hohen Oberlippe; alsdann nicht minder das auffüllig geguollene
linke Auge, dem gegenüber das rechte so viel tiefer liegt und tiefer geschlossen
ist^); auch der kleine und so beredt geschwungene Mund, an dem die tiefe, kurze,
am Mundwinkel ansetzende, schräg abwärts ziehende Furche nicht übersehen
werden kann, ist hier zu nennen und schließlich jene Locke, die einsam und nn-
gebärdig auf der Schädelplatte sich über ihre Genossinnen reckt.
Locke, Auge, Mund und Kinn, weniger zunächst die Nase in ihrer hier so eigen-
artigen Form, aber nun nicht bloß diese individuellen Einzelheiten, sondern
das Ganze des Antlitzes in seiner vollen Erscheinung, wie es die Zeichnung
uns darbietet: wessen anders könnte es sein als Martin Luthers, vom Tode
verklärt? Über die Richtigkeit der Benennung „Luther im Tode" ist kein weiteres
Wort zu verlieren. Sie hat die Zeichnung von Anfang an, wie wir sahen, durch
die Jahrhunderte begleitet. Seine Züge, die Züge des Wittenberger Refor-
mators im Tode, sind es, die eine frische Künstlerhand hier festgehalten hat.
Jn der Tat, von einem im Tode verklärten Antlitze des großen Geistes-
helden dürfen, müssen wir vor unserer Zeichnung reden. ltber ihr ist — aller-
dings erst im Original in der ganzen Fülle zu spüren — eine Wärme der Emp-
findung ausgebreitet, in ihr lebi eine Frische der Beseelung, aus ihr leuchtet
eine Tiefe gehaltener geistiger Überlegenheit und Kraft, wie sie in diesem Maße
und in dieser abgeklärten Zusammenftimmung, nnbeschadet der wuchtgeladenen
Kupferstiche des ülteren Cranach vom Jahre 1330 und 1831 (Lippmann 61—63),
nur ein Mal uns entgegentreten: eben in unserer Handzeichnung. Man fühlt an
dieser Stirn, wie sie sich in Falten legen und urkräftig zornig sein und wüten
konnte, aber nun ist der Tod verschlungen in den Sieg. Man kann sich dabei un-
möglich des Eindruckes erwehren, der bei eingehenderer Betrachtung immer neu
sich aufdrängt und zur gesicherten Überzeugung wird, daß dieses Bild unmittelbar
vor dem Dargestellten entstanden ist, entstanden sein muß. Denn solch originale
1) Die Bepmselung bzw. Beschmierimg mit weWchem Grau im Haar uiid an der Nase ist un-
zweifelhaft erst fpätere Zutat, sie gehört nicht zum ursprünglichen Bestand.
2) S. U. S.53 A. 6.
Nasenwand als leichte, ins Graue gehende Schattierung auf?) Scharfe Kon-
turen sind im allgemeinen vermieden; wo sie hervvrtreten, wie am feftgeschlosse-
nen Mund irnd vor allem in der kurvenreichen und ungemein sicher und treu
geführten Grenzlinie des Gesichtes links, die erft hoch oben am Schädel unter
den über die gewölbte Stirn hereinfallenden Haarlöckchen sich verliert nnd nach
unten beim Ansatz von Kinn und Unterkinn sich spaltet, stehen sie durchaus im
Dienste der Gesamtwirkung des dargestellten Kopfes nnd sind ihr in voller Selbst-
zucht untergeordnet. Jm feinen Kontrast zur linken fehlen sie an der rechten
Seite der Zeichnung gänzlich, wie überhaupt der Zeichner es meisterlich ver-
standen hat, die Berbindung des scharf Abgegrenzten mit dem fließend Weichen
und Feisten in diesem Gesicht zum sprechenden Ausdruck zu bringen. Äls be-
sonders charakteristisch in und an dem Gesicht gibt sich, außer dem starken Unter-
kinn, die auffallend kleine Stnmpfnase mit den gerundeten Flügeln über der
verhältnismäßig hohen Oberlippe; alsdann nicht minder das auffüllig geguollene
linke Auge, dem gegenüber das rechte so viel tiefer liegt und tiefer geschlossen
ist^); auch der kleine und so beredt geschwungene Mund, an dem die tiefe, kurze,
am Mundwinkel ansetzende, schräg abwärts ziehende Furche nicht übersehen
werden kann, ist hier zu nennen und schließlich jene Locke, die einsam und nn-
gebärdig auf der Schädelplatte sich über ihre Genossinnen reckt.
Locke, Auge, Mund und Kinn, weniger zunächst die Nase in ihrer hier so eigen-
artigen Form, aber nun nicht bloß diese individuellen Einzelheiten, sondern
das Ganze des Antlitzes in seiner vollen Erscheinung, wie es die Zeichnung
uns darbietet: wessen anders könnte es sein als Martin Luthers, vom Tode
verklärt? Über die Richtigkeit der Benennung „Luther im Tode" ist kein weiteres
Wort zu verlieren. Sie hat die Zeichnung von Anfang an, wie wir sahen, durch
die Jahrhunderte begleitet. Seine Züge, die Züge des Wittenberger Refor-
mators im Tode, sind es, die eine frische Künstlerhand hier festgehalten hat.
Jn der Tat, von einem im Tode verklärten Antlitze des großen Geistes-
helden dürfen, müssen wir vor unserer Zeichnung reden. ltber ihr ist — aller-
dings erst im Original in der ganzen Fülle zu spüren — eine Wärme der Emp-
findung ausgebreitet, in ihr lebi eine Frische der Beseelung, aus ihr leuchtet
eine Tiefe gehaltener geistiger Überlegenheit und Kraft, wie sie in diesem Maße
und in dieser abgeklärten Zusammenftimmung, nnbeschadet der wuchtgeladenen
Kupferstiche des ülteren Cranach vom Jahre 1330 und 1831 (Lippmann 61—63),
nur ein Mal uns entgegentreten: eben in unserer Handzeichnung. Man fühlt an
dieser Stirn, wie sie sich in Falten legen und urkräftig zornig sein und wüten
konnte, aber nun ist der Tod verschlungen in den Sieg. Man kann sich dabei un-
möglich des Eindruckes erwehren, der bei eingehenderer Betrachtung immer neu
sich aufdrängt und zur gesicherten Überzeugung wird, daß dieses Bild unmittelbar
vor dem Dargestellten entstanden ist, entstanden sein muß. Denn solch originale
1) Die Bepmselung bzw. Beschmierimg mit weWchem Grau im Haar uiid an der Nase ist un-
zweifelhaft erst fpätere Zutat, sie gehört nicht zum ursprünglichen Bestand.
2) S. U. S.53 A. 6.