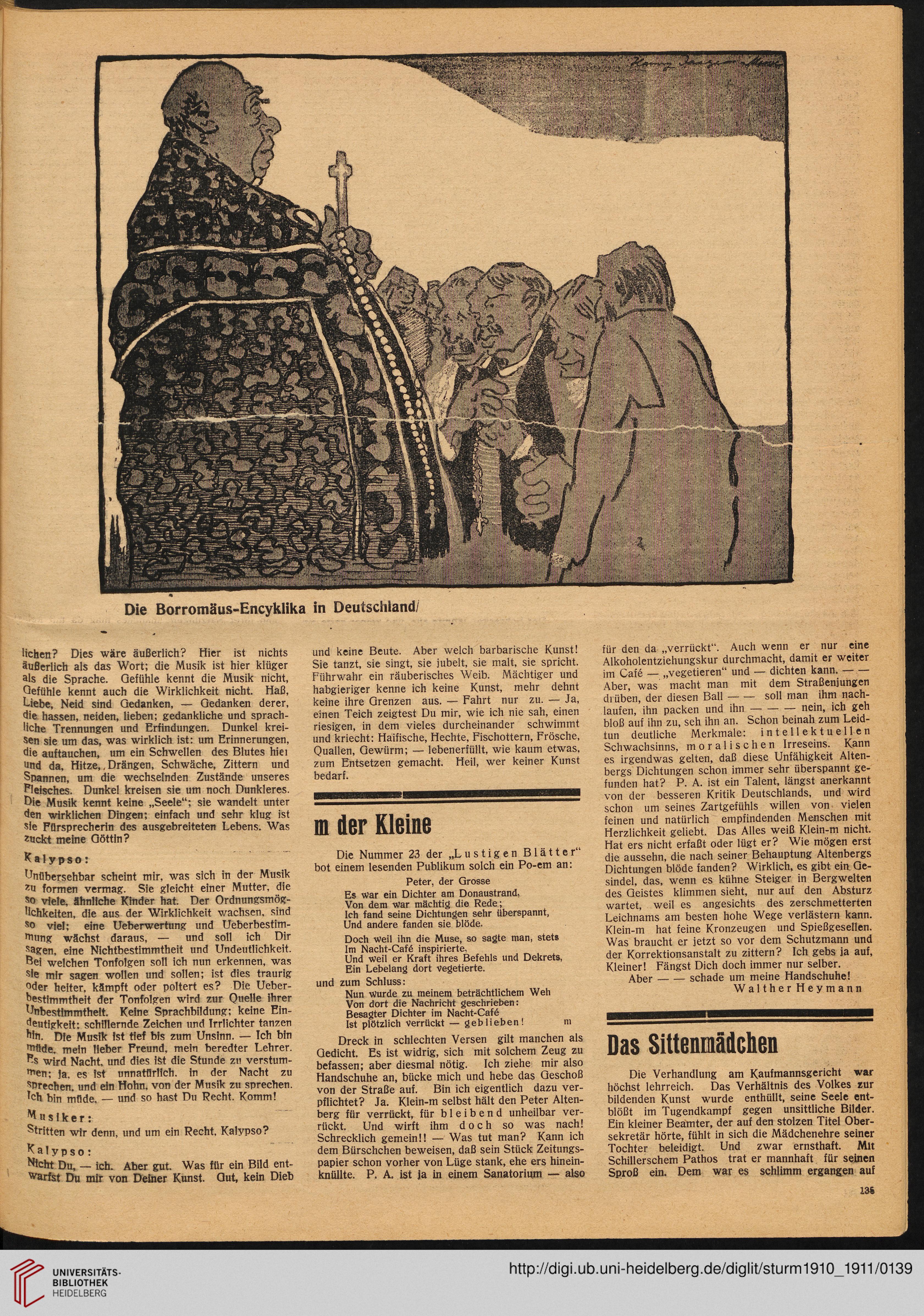Die Borromäus-Encyklika in Deutschiand/
üchen? Dies wäre äußerlich? Hier ist nichts
äußerlich als das Wort; die Musik ist hier klüger
als die Sprache. Qefiihle kennt die Musik nicht,
Gefiihle kennt auch die Wirklichkeit nicht. Haß,
Uebe, Neid sind Qedanken, — Qedanken derer,
die hassen, neiden, lieben; gedankliche und sprach-
•iche Trennungen und Erfindungen. Dunkel krei-
sen sie um das, was wirklich ist: um Erinnerungen,
die auftauchen, um ein Schwellen des Blutes hiei
und da, Hitze,. Drängen, Schwäche, Zittern und
Spannen, um die wechselnden Zustände unseres
Pleisches. Dunkel kreisen sie um noch Dunkleres.
Die Musik kennt keine „Seele“; sie wandelt unter
den wirklichen Dingen; einfach und sehr klug ist
sie Fürsprecherin des ausgebreiteten Lebens. Was
^uckt meine Qöttin?
^aly pso:
Dnübersehbar scheint mir, was sich in der Musik
formen vermag. Sie gleicht einer Mutter, die
viele, ähnliche Kinder hat. Der Ordnungsmög-
•ichkeiten, die aus der Wirklichkeit v/achsen, sind
so viel; eine Ueberwertung und Ueberbestim-
^ung wächst daraus, — und soll ich Dir
sugen, eine Nichtbestimmtheit und Undeutlichkeit.
Dei welchen Tonfolgen soll ich nun erkennen, was
sfe mir sagen wollen und sollen; ist dies traurig
°der heiter, kämpft oder poltert es? Die Ueber-
J’estimmtheit der Tonfolgen wird zur Quelle ihrer
Dnbestlmmtheit. Kelne Sprachbildung; keine Ein-
deutigkeit: schillernde Zeichen und Trrlichter tanzen
"in. Dle Musik Ist tlef bis zum Unsinn. — Ich bin
'Jhde, meln Heber Freund, mein beredter Lehrer.
wird Nacht, und dies iSt die Stunde zu verstum-
men; la, es ist unnatflrlich. in der Nacht zu
sprechen. und ein Hohn. von der Musik zu sprechen.
* ch bin mflde. — und so hast Du Recht. Komm!
^ u s I k e r ;
^tritten wlr denn, und um ein Recht, Kalypso?
^ a I y p s o :
Nicht Du, — ich. Aber gut. Was für ein Bild ent-
^arfst Du mlr von Deiner Kunst. Qut, kein Dieb
und keine Beute. Aber welch barbarische Kunst!
Sie tanzt, sie singt, sie jubelt, sie malt, sie spricht.
Fiihrwahr ein räuberisches Weib. Mächtiger und
habgieriger kenne ich keine Kunst, mehr dehnt
keine ihre Grenzen aus. — Fahrt nur zu. — Ja,
einen Teich zeigtest Du mir, wie ich nie sah, einen
riesigen, in dem vieles durcheinander schwimmt
und kriecht: Haifische, Hechte, Fischottern, Frösche,
Quallen, Gewürm; — lebenerfüllt, wie kaum etwas,
zum Entsetzen gemacht. Heil, wer keiner Kunst
bedarf.
m der Kleine
Die Nummer 23 der „L u s t i g e n B1 ä 11 e r“
bot einem lesenden Publikum solch ein Po-em an:
Peter, der Grosse
Es war ein Dichter am Donaustrand,
Von dem war mächtig die Rede;
Ich fand seine Dichtungen sehr überspannt,
Und andere fanden sie blöde.
Doch weil ihn die Muse, so sagte man, stets
Im Nacht-Cafö inspirierte,
Und weil er Kraft ihres Befehls und Dekrets,
Ein Lebelang dort vegetierte.
und zum Schluss:
Nun Wurde zu meinem beträchtlichem Weh
Von dort die Nachricht geschrieben:
Besagter Dichter im Nacht-Cafe
Ist plötzlich Verrückt — geblieben! m
Dreck in schlechten Versen gilt manchen als
Qedicht. Es ist widrig, sich mit solchem Zeug zu
befassen; aber diesmal nötig. Ich ziehe mir aiso
Handschuhe an, bücke mich und hebe das Geschoß
von der Straße auf. Bin ich eigentlich dazu ver-
pflichtet? Ja. Klein-m selbst hält den Peter Alten-
berg für verrückt, für b 1 e i b e n d unheilbar ver-
rückt. Und v/irft ihm doch so was nach!
Schrecklich gemein!! — Was tut man? Kann ich
dem Bürschchen beweisen, daß sein Stück Zeitungs-
papier schon vorher von Lüge stank, ehe ers hinein-
knüllte. P. A. ist ja in einem Sanatorium — also
für den da „verrückt“. Auch wenn er nur eine
Alkoholentziehungskur durchmacht, damit er weiter
im Cafe — „vegetieren“ und — dichten kann.-
Aber, was macht man mit dem Straßenjungen
drüben, der diesen Ball-soll man ihm nach-
laufen, ihn packen und ihn-nein, ich geh
bloß auf ihn zu, seh ihn an. Schon beinah zum Leid-
tun deutliche Merkmale: intellektuellen
Schwachsinns, moralischen Irreseins. Kann
es irgendwas gelten, daß diese Unfähigkeit Alten-
bergs Dichtungen schon immer sehr überspannt ge-
funden hat? P. A. ist ein Talent, längst anerkannt
von der besseren Kritik Deutschlands, und wird
schon um seines Zartgefühls willen von vielen
feinen und natürlich empfindenden Menschen mit
Herzlichkeit geliebt. Das Alles weiß Klein-m nicht.
Hat ers nicht erfaßt oder lügt er? Wie mögen erst
die aussehn, die nach seiner Behauptung Altenbergs
Dichtungen blöde fanden? Wirklich, es gibt ein Qe-
sindel, das, wenn es kühne Steiger in Bergwelten
des Qeistes klimmen sieht, nur auf den Absturz
wartet, weil es angesichts des zerschmetterten
Leichnams am besten hohe Wege verlästern kann.
Klein-m hat feine Kronzeugen und Spießgesellen.
Was braucht er jetzt so vor dem Schutzmann und
der Korrektionsanstalt zu zittern? Ich gebs ja auf,
Kleiner! Fängst Dich doch immer nur selber.
Aber-schade um meine Handschuhe!
Walther Heymann
Das Sittenmädchen
Die Verhandlung am Kaufmannsgericht war
höchst lehrreich. Das Verhältnis des Volkes zur
bildenden Kunst wurde enthüllt, seine Seele ent-
blößt im Tugendkampf gegen unsittliche Bilder.
Ein kieiner Beamter, der auf den stolzen Titel Ober-
sekretär hörte, fühlt in sich die Mädchenehre seiner
Tochter beleidigt. Und zwar ernsthaft. Mlt
Schillerschem Pathos trat er mannhaft für seinen
Sproß ein. Dem war es schlimm ergangen auf
136
üchen? Dies wäre äußerlich? Hier ist nichts
äußerlich als das Wort; die Musik ist hier klüger
als die Sprache. Qefiihle kennt die Musik nicht,
Gefiihle kennt auch die Wirklichkeit nicht. Haß,
Uebe, Neid sind Qedanken, — Qedanken derer,
die hassen, neiden, lieben; gedankliche und sprach-
•iche Trennungen und Erfindungen. Dunkel krei-
sen sie um das, was wirklich ist: um Erinnerungen,
die auftauchen, um ein Schwellen des Blutes hiei
und da, Hitze,. Drängen, Schwäche, Zittern und
Spannen, um die wechselnden Zustände unseres
Pleisches. Dunkel kreisen sie um noch Dunkleres.
Die Musik kennt keine „Seele“; sie wandelt unter
den wirklichen Dingen; einfach und sehr klug ist
sie Fürsprecherin des ausgebreiteten Lebens. Was
^uckt meine Qöttin?
^aly pso:
Dnübersehbar scheint mir, was sich in der Musik
formen vermag. Sie gleicht einer Mutter, die
viele, ähnliche Kinder hat. Der Ordnungsmög-
•ichkeiten, die aus der Wirklichkeit v/achsen, sind
so viel; eine Ueberwertung und Ueberbestim-
^ung wächst daraus, — und soll ich Dir
sugen, eine Nichtbestimmtheit und Undeutlichkeit.
Dei welchen Tonfolgen soll ich nun erkennen, was
sfe mir sagen wollen und sollen; ist dies traurig
°der heiter, kämpft oder poltert es? Die Ueber-
J’estimmtheit der Tonfolgen wird zur Quelle ihrer
Dnbestlmmtheit. Kelne Sprachbildung; keine Ein-
deutigkeit: schillernde Zeichen und Trrlichter tanzen
"in. Dle Musik Ist tlef bis zum Unsinn. — Ich bin
'Jhde, meln Heber Freund, mein beredter Lehrer.
wird Nacht, und dies iSt die Stunde zu verstum-
men; la, es ist unnatflrlich. in der Nacht zu
sprechen. und ein Hohn. von der Musik zu sprechen.
* ch bin mflde. — und so hast Du Recht. Komm!
^ u s I k e r ;
^tritten wlr denn, und um ein Recht, Kalypso?
^ a I y p s o :
Nicht Du, — ich. Aber gut. Was für ein Bild ent-
^arfst Du mlr von Deiner Kunst. Qut, kein Dieb
und keine Beute. Aber welch barbarische Kunst!
Sie tanzt, sie singt, sie jubelt, sie malt, sie spricht.
Fiihrwahr ein räuberisches Weib. Mächtiger und
habgieriger kenne ich keine Kunst, mehr dehnt
keine ihre Grenzen aus. — Fahrt nur zu. — Ja,
einen Teich zeigtest Du mir, wie ich nie sah, einen
riesigen, in dem vieles durcheinander schwimmt
und kriecht: Haifische, Hechte, Fischottern, Frösche,
Quallen, Gewürm; — lebenerfüllt, wie kaum etwas,
zum Entsetzen gemacht. Heil, wer keiner Kunst
bedarf.
m der Kleine
Die Nummer 23 der „L u s t i g e n B1 ä 11 e r“
bot einem lesenden Publikum solch ein Po-em an:
Peter, der Grosse
Es war ein Dichter am Donaustrand,
Von dem war mächtig die Rede;
Ich fand seine Dichtungen sehr überspannt,
Und andere fanden sie blöde.
Doch weil ihn die Muse, so sagte man, stets
Im Nacht-Cafö inspirierte,
Und weil er Kraft ihres Befehls und Dekrets,
Ein Lebelang dort vegetierte.
und zum Schluss:
Nun Wurde zu meinem beträchtlichem Weh
Von dort die Nachricht geschrieben:
Besagter Dichter im Nacht-Cafe
Ist plötzlich Verrückt — geblieben! m
Dreck in schlechten Versen gilt manchen als
Qedicht. Es ist widrig, sich mit solchem Zeug zu
befassen; aber diesmal nötig. Ich ziehe mir aiso
Handschuhe an, bücke mich und hebe das Geschoß
von der Straße auf. Bin ich eigentlich dazu ver-
pflichtet? Ja. Klein-m selbst hält den Peter Alten-
berg für verrückt, für b 1 e i b e n d unheilbar ver-
rückt. Und v/irft ihm doch so was nach!
Schrecklich gemein!! — Was tut man? Kann ich
dem Bürschchen beweisen, daß sein Stück Zeitungs-
papier schon vorher von Lüge stank, ehe ers hinein-
knüllte. P. A. ist ja in einem Sanatorium — also
für den da „verrückt“. Auch wenn er nur eine
Alkoholentziehungskur durchmacht, damit er weiter
im Cafe — „vegetieren“ und — dichten kann.-
Aber, was macht man mit dem Straßenjungen
drüben, der diesen Ball-soll man ihm nach-
laufen, ihn packen und ihn-nein, ich geh
bloß auf ihn zu, seh ihn an. Schon beinah zum Leid-
tun deutliche Merkmale: intellektuellen
Schwachsinns, moralischen Irreseins. Kann
es irgendwas gelten, daß diese Unfähigkeit Alten-
bergs Dichtungen schon immer sehr überspannt ge-
funden hat? P. A. ist ein Talent, längst anerkannt
von der besseren Kritik Deutschlands, und wird
schon um seines Zartgefühls willen von vielen
feinen und natürlich empfindenden Menschen mit
Herzlichkeit geliebt. Das Alles weiß Klein-m nicht.
Hat ers nicht erfaßt oder lügt er? Wie mögen erst
die aussehn, die nach seiner Behauptung Altenbergs
Dichtungen blöde fanden? Wirklich, es gibt ein Qe-
sindel, das, wenn es kühne Steiger in Bergwelten
des Qeistes klimmen sieht, nur auf den Absturz
wartet, weil es angesichts des zerschmetterten
Leichnams am besten hohe Wege verlästern kann.
Klein-m hat feine Kronzeugen und Spießgesellen.
Was braucht er jetzt so vor dem Schutzmann und
der Korrektionsanstalt zu zittern? Ich gebs ja auf,
Kleiner! Fängst Dich doch immer nur selber.
Aber-schade um meine Handschuhe!
Walther Heymann
Das Sittenmädchen
Die Verhandlung am Kaufmannsgericht war
höchst lehrreich. Das Verhältnis des Volkes zur
bildenden Kunst wurde enthüllt, seine Seele ent-
blößt im Tugendkampf gegen unsittliche Bilder.
Ein kieiner Beamter, der auf den stolzen Titel Ober-
sekretär hörte, fühlt in sich die Mädchenehre seiner
Tochter beleidigt. Und zwar ernsthaft. Mlt
Schillerschem Pathos trat er mannhaft für seinen
Sproß ein. Dem war es schlimm ergangen auf
136