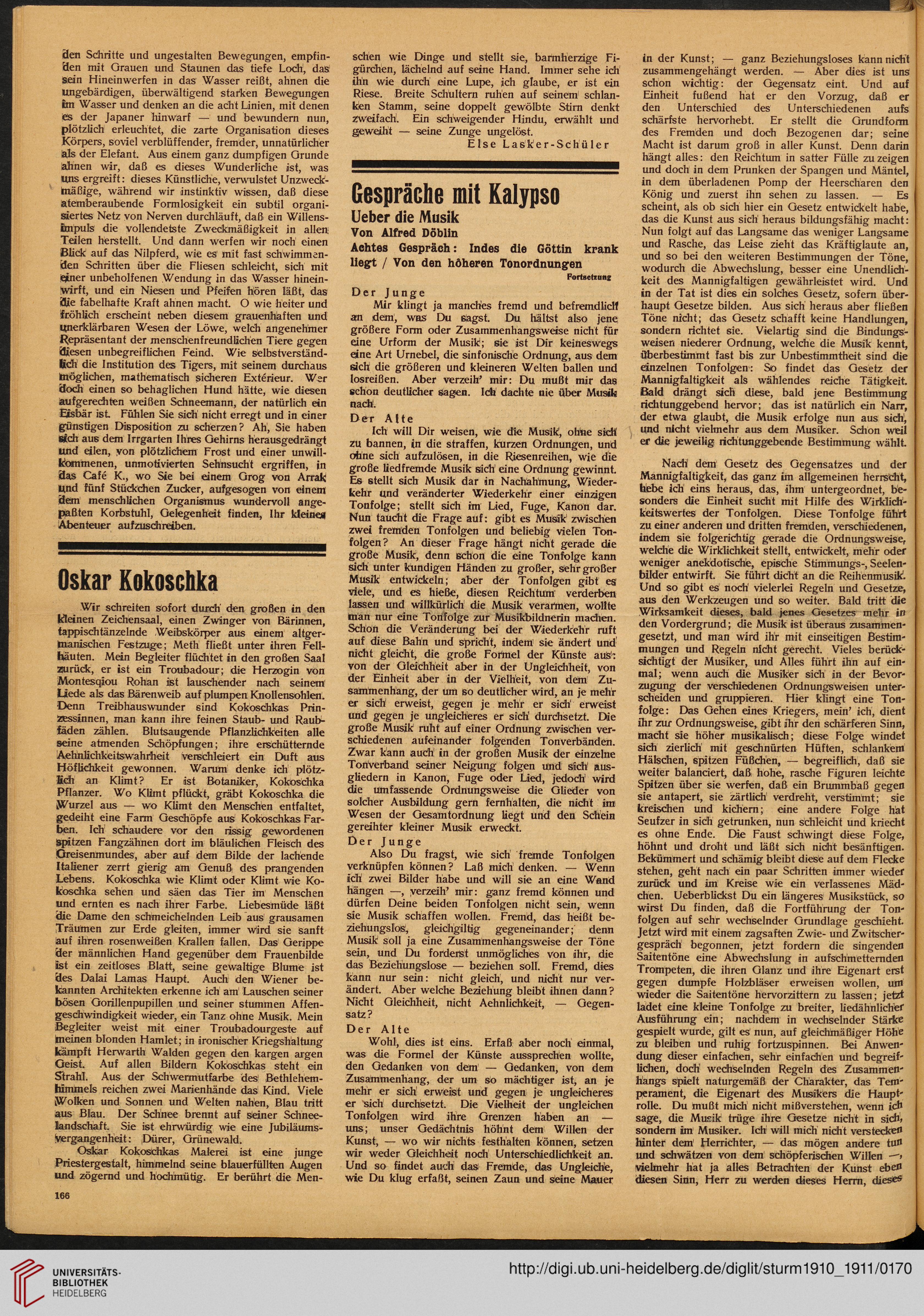den Schritte und ungestalten Bewegungen, empfin-
den mit Grauen und Staunen das tiefe Loch, daS
sein Hineinwerfen in das Wasser reißt, ahnen die
ungebärdigen, überwältigend starken Bewegungen
tm Wasser und denken an die acht Linien, mit denen
es der Japaner hinwärf — und bewundern nun,
plötzlich erleuchtet, die zarte Organisation dieses
Körpers, söviel verblüffender, fremder, unnatürlicher
äjs der Elefant. Aus einem ganz dumpfigen Grunde
ahnen wir, daß es dieses Wunderliche ist, was
uns ergreift: dieses KünstliChe, verwulstet Unzweck-
Imäßige, während wir instinktiv wissen, daß diese
atemberaubende Formlosigkeit ein subtil organi-
siertes Netz von Nerven durchläuft, daß ein Willens-
Impuls die vollendetste Zweckmäßigkeit in allen;
Teilen herstellt. Und dann werfen wir noch einen
BliCk auf das Nilpferd, wie es mit fast schwimmen-
den Schritten über die Fliesen schleicht, sich mit
S»ner unbeholfenen Wendung in das Wasser hinein-
wirft, und ein Niesen und Pfeifen hören läßt, das
<3ie fabelhafte Kraft ahnen mächt. O wie heiter und
fröhlich erscheint neben diesem grauenhaften und
Uneridärbaren Wesen der Löwe, welch angenehmer
Pepräsentant der menschenfreundlichen Tiere gegen
diesen unbegreiflichen Feind. Wie selbstverständ-
Kch die Institution des Tigers, mit seinem durchaus
inöglichen, mathematisch sicheren Exterieur. Wer
doch einen so behaglichen Hund hätte, wie diesen
aufgerechten weißen Schneemann, der natürlich eüi
Eisbär isL Fühlen Sie sich nicht erregt und in ciner
giinstigen Disposition zu scherzen? Ah, Sie haben
Sich aus dem Irrgarten Ihres Gehirns herausgedrängt
und eilen, yon plötzlichem Frost und einer unwill-
kommenen, unmotivierten Sehnsucht ergriffen, in
das Cafe K., wo Sie bei einem Grog von Arrak
Und fünf Stückdien Zucker, aufgesogen von einem
dem menschlichen Organismus wundervoll ange-
paßten Korbstuhl, Gelegenheit finden, Ihr kleinea
Abenteuer aufzuschretben.
Oskar Kokoschka
Wir schreiten sofort durch den großen in den
kleinen Zeichensaal, einen Zwinger von Bärinnen,
tappischtänzelnde Weibskörper aus einem altger-
tnanischen Festzuge; Meth fließt unter ihren Fell-
häuten. Mein Begleiter flüchtet in den großen Saal
zurück, er ist ein Troubadour; die Herzogin von
Montesqiou Rohan ist lauschender nach seinem
Liede als das Bärenweib auf plumpen Knollensohlen.
Denn Treibhauswunder 6ind KokosChkas Prin-
zessinnen, man kann ihre feinen Staub- und Raub-
fäden zählen. Blutsaugende Pflanzlichkeiten alle
seine atmenden Schöpfungen; ihre erschütternde
Aehnlichkeitswahrheit verschleiert ein Duft aus
Höflkhkeit gewonnen. Warum denke ich plötz-
Edi an Klimt? Er ist Botaniker, Kokoschka
Pflanzer. Wo Klimt pflückt, gräbt Kokoschka die
MFurzel aus — wo Klimt den Menschen entfaltet,
gedeiht eine Farm Geschöpfe aus Kokoschkas Far-
ben. Ich schaudere vor den rissig gewordenen
Spitzen Fangzähnen dort im bläulichen Fleisch des
Greisenmundes, aber auf dem Bilde der lachende
Italiener zerrt gierig am Genuß des prangenden
Lebens. KokosChka wie Klimt oder Klimt wie Ko-
kosChka sehen und säen das Tier im Menschen
und ernten es naCh ihrer Farbe. Liebesmüde läßt
die Dame den schmeichelnden Leib aus grausamen
Träumen zur Erde gleiten, immer wird sie Sanft
auf ihren rosenweißen Krallen fallen. Das Gerippe
der männlichen Hand gegenüber dem Frauenbilde
äst ein zeitloses Blatt, seine gewaltige Blume ist
des Dalai Lamas Haupt. Auch den Wiener be-
kannten Architekten erkenne ich am Lauschen seiner
bösen Gorillenpupillen und seiner stummen Affen-
gesChwindigkeit wieder, ein Tanz ohne Musik. Mein
Begleiter weist mit einer Troubadourgeste auf
Imeinen blonden Hamlet; in ironischer Kriegshältung
kämpft Herwarth Walden gegen den kargen argen
Geist. Auf allen Bildern KokösChkas steht ein
S'trahl. Aus der Schwermutfarbe des Bethlehem-
himmels reichen zwei Marienhände das Kind. Viele
iWolken und Sonnen und Welten nahen, Blau tritt
aus Blau. Der Schnee brennt auf seiner Schnee-
llandschaft. Sie ist ehrwürdig wie eine Jubiläums-
vergangenheit: Dürer, Grünewald.
Oskar Kokoschkas Malerei ist eine junge
Priestergestalt, himmelnd seine blauerfüllten Augen
und zögernd und hochmütig. Er berührt die Men-
schen wie Dinge und stellt sie, barmherzige Fi-
gürchen, lächelnd auf seine Hand. Iminer sehe ich
ih’n wie durCh eine Lupe, jch glaube, er ist ein
Riese. Breite Schültern ruhen auf seinem schlan-
ken Stamm, seine doppelt gewölbte Stim denkt
zweifach. Ein schweigender Hindu, erwählt und
geweiht — seine Zunge xmgelöst.
Else Lasker-SChüler
Gespräche mit Kalypso
Ueber die Musik
Von Alfred Döblln
Achtes Gespräch: Indes die Göttin krank
llegt / Von den höheren Tonordnungen
Portsetionc
Der Junge
Mir klingt ja manches fremd und befremdlicH
an dem, was Du eägst. Du hältst also jene
größere Form oder Zusammenhangsweise nicht für
eine Urform der Musik; sie jst Dir keineswegs
eine Art Urnebel, die sinfonische Ordnung, aus dem
sich die größeren und kleineren Welten ballen und
Iosreißen. Aber vcrzeih’ mir: Du mußt mir das
schon deutlicher sagen. Ich dachte nie über Musik
nach.
D e r A11 e
Ich will Dir weisen, wie dle Musik, ohne sich
zu bannen, tn die straffen, kurzen Ordnungen, und
ohne sich aufzulösen, in die Riesenreihen, wie die
große liedfremde Musik sich' eine Ordnung gewinnt.
Es stellt sich Musik dar in Nachähmung, Wieder-
kehr und veränderter Wiederkehr einer einzigen
Tonfolge; stellt sich im Lied, Fuge, Kanon dar.
Nun taucht die Frage auf: gibt es Musik zwischen
zwei fremden Tonfolgen und beliebig vielen Ton-
folgen? An dieser Frage hängt nicht gerade die
große Musik, denn schon die eine Tonfolge kann
sich unter kundigen Händen zu großer, sehr großer
Musik entwickeln; aber der Tonfolgen gibt es
viele, und es hieße, diesen Reichtum verdeihen
lassen und willkürlich die Musik verarmen, wollte
män nur eine Tonfolge zur Musikbildnerin madien.
Schön die Veränderung bei der Wiederkehr ruft
auf diese Bahn und spricht, indem sie ändert und
nicht gleicht, die große Formel der Künste aus:
von der Gleichheit aber in der Ungleichheit, von
der Einheit aber in der Vielheit, von dem Zu-
sammenhäng, der um so deutlicher wird, an je mehr
er sich erweist, gegen je mehr er sich' erweist
und gegen je ungleicheres er sich’ durchsetzt. Dde
große Musik ruht auf einer Ordnung zwischen ver-
schiedenen aufeinander folgenden Tonverbänden.
Zwar kann auch in der großen Musik der einzelne
TonVerband seiner Neigung folgen und slich aus-
gliedern in Kanon, Fuge oder lied, jedoch' wird
die umfassende Ordnungsweise die Glieder von
solcher Ausbildung gern fernhalten, die nicht im
Wesen der Gesamtordnung liegt und den Schein
gereihter kleiner Musik erweckt.
Der Junge
Also Du fragst, wie sich fremde Tonfolgen
verknüpfen können? Laß mich denken. — Wenn
ich zwei Bilder habe und will sie an eine Wand
hängen —, yerzeih’ mir: ganz fremd können und
dürfen Deine beiden Tonfolgen nicht sein, wenn
sie Musik schaffen wollen. Fremd, das heißt be-
ziehungsloß, gleichgiltig gegeneinander; denn
Musik soll ja eine Zusaminenhängsweise der Töne
sein, und Du forderst unmögliches von ihr, die
das Beziehüngslose — beziehen Soll. Fremd, dies
kann nur sein: nicht gleich, und nicht nur ver-
ändert. Aber welche Beziehüng bleibt ihnen dann?
Nicht Gleichheit, nicht Aehnlichkeit, — Gegen-
satz?
Der Alte
Wohl, dies ist eins. Erfaß aber noch einmal,
was die Formel der Künste aussprechen wollte,
den Gedanken von dem — Gedanken, von dem
Zusammenhang, der um So mächtiger ist, an je
mehr er sich erweist und gegen je ungleicheres
er sich durchSetzt. Die Vielheit der ungleichen
Tonfolgen wird ihre Grenzen häben an —
uns; unser Gedächtnis höhnt dem Willen der
Kunst, — wo wir nichts festhälten können, setzen
wir weder Gleichheit noch Unterschiedlichkeit an.
Und so findet aueh das Fremde, das Ungleiche,
wie Du klug erfaßt, seinen Zaun und seine Mauer
in der Kunst; — ganz Beziehungsloses kann nicht
zusammengehängt werden. — Aber dies ist uns
schön wichtig: der Gegensatz eint. Und auf
Einheit fußend hat er den Vorzug, daß er
den Unterschied des Unterschiedenen aufs
schärfste hervorhebt. Er stellt die Grundform
des Fremden und doch Bezogenen dar; seine
Macht ist darum groß in aller Kunst. Denn darin
hängt alles: den Reichtum in satter Fülle zuzeigen
und doch in dem Prunken der Spangen und Mäntel,
in dem überladenen Pomp der Heerschären den
König und zuerst ihn sehen zu lassen. — Es
scheint, als ob sich hier ein Gesetz entwiCkelt habe,
das die Kunst aus sich heraus bildungsfähig macht:
Nun folgt auf das Langsame das weniger Langsame
und Rasche, das Leise zieht das Kräftiglaute an,
und so bei den weiteren Bestimmungen der Töne,
wodurch die Abwechslung, besser eine Unendlich-
keit des Mannigfaltigen gewährleistet wird. Und
in der Tat ist dies ein solches Gesetz, sofem über-
haupt Gesetze bilden. Aus sich heraus aber fließen
Töne nicht; das Gesetz schafft keine Handlungen,
sondern richtet sie. Vielartig sind die Bindungs-
weisen niederer Ordnung, welChe die Musik kennt,
überbestimmt fast bis zur Unbestimmtheit sind die
einzelnen Tonfolgen : So findet das Gesetz der
Mannigfaltigkeit als wählendes reiche Tätigkeit.
Bäld drängt sich diese, bald jene Bestimmung
richtunggebend hervor; das ist natürlich ein Narr,
der etwa glaubt, die Musik erfolge nun aus sich',
und nicht vielmehr aus dem Musiker. Schon weil
er die jeweilig richtunggebende Bestimmung wählL
NaCh dem Gesetz des Gegensatzes und der
Mannigfaltigkeit, das ganz im allgemeinen herreCht,
hebe ich eins heraus, das, ihm untergeordnet, be-
sondere die Einheit sucht mit Hilfe des Wirklich-
keitswertes der Tonfolgen. Diese Tonfolge füh'rt
zu einer anderen und dritten fremden, vereChiedenen,
indem sie folgerichtig gerade die Ordnungsweise,
welche die Wirklichkeit stellt, entwickelt, mehr oder
weniger anekdotische, epische Stimmungs-, Seelen-
bilder entwirft. Sie führt dicht an die Reihenmusik 1.
Und so gibt es noCh' vielerlei Regeln und Gesetze,
aus den Werkzeugen und so weiter. Bald tritt die
Wirksamkeit dieses, bald jenes Gesetzes mehr iri
den Vordergrund; die Musik ist überaus zusammen-
gesetzt, und man wird ihr mit einsCitigen Bestim-
mungen und Regeln nicht gerecht. Vieles berück-
sichtigt der Musiker, und Alles führt ihn auf ein-
mal; wenn auch die Musiker sich in der Bevor-
zugung der verschiedenen Ordnungsweisen unter-
scheiden und gruppieren. Hier klingt eine Ton-
folge: Das Gehen eines Kriegers, mein’ ich, dient
ihr zur Ordnungsweise, gibt ihr den schärferen Sinn,
macht sie höher musikaMsch; diese Folge windet
sich zierhch mit geschnürten Hüften, schlankem
Hälschen, spitzen Füßchen, — begreifliCh, daß sie
weiter balanciert, daß hohe, rasche Figuren leichte
Spitzen über sie werfen, daß ein Brummbäß gegen
sie antapert, sie zärtMch verdreht, verstimüit; sie
kreischen und kichem; eine andere Folge hät
Seufzer in sich getmnken, nun schleicht und kriecht
es ohne Ende. Die Faust schwingt diese Folge,
höhnt und droht und läßt sich nicht besänftigen.
Bekümmert und schämig bleibt dieSfe auf dem Flecke
stehen, geht nach ein paar Schritten immer wiedef
zurüdk und im Kreise wie ein verlassenes Mäd-
chen. UeberbMckst Du ein längeres Musikstück, so
wiret Du finden, daß die Fortführung der Ton-
folgen auf sehr wechselnder Grundlage geschieht.
Jetzt wird mit einem zagsaften Zwie- und Zwitscher-
gespräch begonnen, jetzt fordem die singendefl
Saitentöne eine Abwechslung in aufschmettemdefl
Trompeten, die ihren Glanz und ihre Eigenart erst
gegen dumpfe Holzbläser erweisen wollen, um
wieder die Saitentöne hervorzittern zu lassfen; jetzt
ladet eine kleine Tonfolge zu breiter, liedähnlichef
Ausfühmng ein; nachdem in wechselnder Stärke
gespielt wurde, gilt es nun, auf gleichmiäßiger Höhe
zu bleiben und mhig fortzuspinnen. Bei Anwen-
dung dieser einfaChen, sehr einfachen und begreif-
MChen, doch' wechselnden Regeln des Zusammefl'
hängs spielt naturgemäßi der Chärakter, das Tem'
perament, die Eigenart des Musikere die Haupt-
rolle. Du mußt mich nicht mißverstehfen, wfenn ich
sage, die Musik trüge ihre Gesetze nicht in sich»
sondern im Musiker. Ich will mich nicht versteckefl
hinter dem ! Herrifehter, — das mögen andere tufl
und schwätzen von dem schöpferischen Willen —>
vielmehr hat ja alles Betrachten der Kunst ebefl
diesen Sinn, Herr zu werden dieses Herm, diese*
166
den mit Grauen und Staunen das tiefe Loch, daS
sein Hineinwerfen in das Wasser reißt, ahnen die
ungebärdigen, überwältigend starken Bewegungen
tm Wasser und denken an die acht Linien, mit denen
es der Japaner hinwärf — und bewundern nun,
plötzlich erleuchtet, die zarte Organisation dieses
Körpers, söviel verblüffender, fremder, unnatürlicher
äjs der Elefant. Aus einem ganz dumpfigen Grunde
ahnen wir, daß es dieses Wunderliche ist, was
uns ergreift: dieses KünstliChe, verwulstet Unzweck-
Imäßige, während wir instinktiv wissen, daß diese
atemberaubende Formlosigkeit ein subtil organi-
siertes Netz von Nerven durchläuft, daß ein Willens-
Impuls die vollendetste Zweckmäßigkeit in allen;
Teilen herstellt. Und dann werfen wir noch einen
BliCk auf das Nilpferd, wie es mit fast schwimmen-
den Schritten über die Fliesen schleicht, sich mit
S»ner unbeholfenen Wendung in das Wasser hinein-
wirft, und ein Niesen und Pfeifen hören läßt, das
<3ie fabelhafte Kraft ahnen mächt. O wie heiter und
fröhlich erscheint neben diesem grauenhaften und
Uneridärbaren Wesen der Löwe, welch angenehmer
Pepräsentant der menschenfreundlichen Tiere gegen
diesen unbegreiflichen Feind. Wie selbstverständ-
Kch die Institution des Tigers, mit seinem durchaus
inöglichen, mathematisch sicheren Exterieur. Wer
doch einen so behaglichen Hund hätte, wie diesen
aufgerechten weißen Schneemann, der natürlich eüi
Eisbär isL Fühlen Sie sich nicht erregt und in ciner
giinstigen Disposition zu scherzen? Ah, Sie haben
Sich aus dem Irrgarten Ihres Gehirns herausgedrängt
und eilen, yon plötzlichem Frost und einer unwill-
kommenen, unmotivierten Sehnsucht ergriffen, in
das Cafe K., wo Sie bei einem Grog von Arrak
Und fünf Stückdien Zucker, aufgesogen von einem
dem menschlichen Organismus wundervoll ange-
paßten Korbstuhl, Gelegenheit finden, Ihr kleinea
Abenteuer aufzuschretben.
Oskar Kokoschka
Wir schreiten sofort durch den großen in den
kleinen Zeichensaal, einen Zwinger von Bärinnen,
tappischtänzelnde Weibskörper aus einem altger-
tnanischen Festzuge; Meth fließt unter ihren Fell-
häuten. Mein Begleiter flüchtet in den großen Saal
zurück, er ist ein Troubadour; die Herzogin von
Montesqiou Rohan ist lauschender nach seinem
Liede als das Bärenweib auf plumpen Knollensohlen.
Denn Treibhauswunder 6ind KokosChkas Prin-
zessinnen, man kann ihre feinen Staub- und Raub-
fäden zählen. Blutsaugende Pflanzlichkeiten alle
seine atmenden Schöpfungen; ihre erschütternde
Aehnlichkeitswahrheit verschleiert ein Duft aus
Höflkhkeit gewonnen. Warum denke ich plötz-
Edi an Klimt? Er ist Botaniker, Kokoschka
Pflanzer. Wo Klimt pflückt, gräbt Kokoschka die
MFurzel aus — wo Klimt den Menschen entfaltet,
gedeiht eine Farm Geschöpfe aus Kokoschkas Far-
ben. Ich schaudere vor den rissig gewordenen
Spitzen Fangzähnen dort im bläulichen Fleisch des
Greisenmundes, aber auf dem Bilde der lachende
Italiener zerrt gierig am Genuß des prangenden
Lebens. KokosChka wie Klimt oder Klimt wie Ko-
kosChka sehen und säen das Tier im Menschen
und ernten es naCh ihrer Farbe. Liebesmüde läßt
die Dame den schmeichelnden Leib aus grausamen
Träumen zur Erde gleiten, immer wird sie Sanft
auf ihren rosenweißen Krallen fallen. Das Gerippe
der männlichen Hand gegenüber dem Frauenbilde
äst ein zeitloses Blatt, seine gewaltige Blume ist
des Dalai Lamas Haupt. Auch den Wiener be-
kannten Architekten erkenne ich am Lauschen seiner
bösen Gorillenpupillen und seiner stummen Affen-
gesChwindigkeit wieder, ein Tanz ohne Musik. Mein
Begleiter weist mit einer Troubadourgeste auf
Imeinen blonden Hamlet; in ironischer Kriegshältung
kämpft Herwarth Walden gegen den kargen argen
Geist. Auf allen Bildern KokösChkas steht ein
S'trahl. Aus der Schwermutfarbe des Bethlehem-
himmels reichen zwei Marienhände das Kind. Viele
iWolken und Sonnen und Welten nahen, Blau tritt
aus Blau. Der Schnee brennt auf seiner Schnee-
llandschaft. Sie ist ehrwürdig wie eine Jubiläums-
vergangenheit: Dürer, Grünewald.
Oskar Kokoschkas Malerei ist eine junge
Priestergestalt, himmelnd seine blauerfüllten Augen
und zögernd und hochmütig. Er berührt die Men-
schen wie Dinge und stellt sie, barmherzige Fi-
gürchen, lächelnd auf seine Hand. Iminer sehe ich
ih’n wie durCh eine Lupe, jch glaube, er ist ein
Riese. Breite Schültern ruhen auf seinem schlan-
ken Stamm, seine doppelt gewölbte Stim denkt
zweifach. Ein schweigender Hindu, erwählt und
geweiht — seine Zunge xmgelöst.
Else Lasker-SChüler
Gespräche mit Kalypso
Ueber die Musik
Von Alfred Döblln
Achtes Gespräch: Indes die Göttin krank
llegt / Von den höheren Tonordnungen
Portsetionc
Der Junge
Mir klingt ja manches fremd und befremdlicH
an dem, was Du eägst. Du hältst also jene
größere Form oder Zusammenhangsweise nicht für
eine Urform der Musik; sie jst Dir keineswegs
eine Art Urnebel, die sinfonische Ordnung, aus dem
sich die größeren und kleineren Welten ballen und
Iosreißen. Aber vcrzeih’ mir: Du mußt mir das
schon deutlicher sagen. Ich dachte nie über Musik
nach.
D e r A11 e
Ich will Dir weisen, wie dle Musik, ohne sich
zu bannen, tn die straffen, kurzen Ordnungen, und
ohne sich aufzulösen, in die Riesenreihen, wie die
große liedfremde Musik sich' eine Ordnung gewinnt.
Es stellt sich Musik dar in Nachähmung, Wieder-
kehr und veränderter Wiederkehr einer einzigen
Tonfolge; stellt sich im Lied, Fuge, Kanon dar.
Nun taucht die Frage auf: gibt es Musik zwischen
zwei fremden Tonfolgen und beliebig vielen Ton-
folgen? An dieser Frage hängt nicht gerade die
große Musik, denn schon die eine Tonfolge kann
sich unter kundigen Händen zu großer, sehr großer
Musik entwickeln; aber der Tonfolgen gibt es
viele, und es hieße, diesen Reichtum verdeihen
lassen und willkürlich die Musik verarmen, wollte
män nur eine Tonfolge zur Musikbildnerin madien.
Schön die Veränderung bei der Wiederkehr ruft
auf diese Bahn und spricht, indem sie ändert und
nicht gleicht, die große Formel der Künste aus:
von der Gleichheit aber in der Ungleichheit, von
der Einheit aber in der Vielheit, von dem Zu-
sammenhäng, der um so deutlicher wird, an je mehr
er sich erweist, gegen je mehr er sich' erweist
und gegen je ungleicheres er sich’ durchsetzt. Dde
große Musik ruht auf einer Ordnung zwischen ver-
schiedenen aufeinander folgenden Tonverbänden.
Zwar kann auch in der großen Musik der einzelne
TonVerband seiner Neigung folgen und slich aus-
gliedern in Kanon, Fuge oder lied, jedoch' wird
die umfassende Ordnungsweise die Glieder von
solcher Ausbildung gern fernhalten, die nicht im
Wesen der Gesamtordnung liegt und den Schein
gereihter kleiner Musik erweckt.
Der Junge
Also Du fragst, wie sich fremde Tonfolgen
verknüpfen können? Laß mich denken. — Wenn
ich zwei Bilder habe und will sie an eine Wand
hängen —, yerzeih’ mir: ganz fremd können und
dürfen Deine beiden Tonfolgen nicht sein, wenn
sie Musik schaffen wollen. Fremd, das heißt be-
ziehungsloß, gleichgiltig gegeneinander; denn
Musik soll ja eine Zusaminenhängsweise der Töne
sein, und Du forderst unmögliches von ihr, die
das Beziehüngslose — beziehen Soll. Fremd, dies
kann nur sein: nicht gleich, und nicht nur ver-
ändert. Aber welche Beziehüng bleibt ihnen dann?
Nicht Gleichheit, nicht Aehnlichkeit, — Gegen-
satz?
Der Alte
Wohl, dies ist eins. Erfaß aber noch einmal,
was die Formel der Künste aussprechen wollte,
den Gedanken von dem — Gedanken, von dem
Zusammenhang, der um So mächtiger ist, an je
mehr er sich erweist und gegen je ungleicheres
er sich durchSetzt. Die Vielheit der ungleichen
Tonfolgen wird ihre Grenzen häben an —
uns; unser Gedächtnis höhnt dem Willen der
Kunst, — wo wir nichts festhälten können, setzen
wir weder Gleichheit noch Unterschiedlichkeit an.
Und so findet aueh das Fremde, das Ungleiche,
wie Du klug erfaßt, seinen Zaun und seine Mauer
in der Kunst; — ganz Beziehungsloses kann nicht
zusammengehängt werden. — Aber dies ist uns
schön wichtig: der Gegensatz eint. Und auf
Einheit fußend hat er den Vorzug, daß er
den Unterschied des Unterschiedenen aufs
schärfste hervorhebt. Er stellt die Grundform
des Fremden und doch Bezogenen dar; seine
Macht ist darum groß in aller Kunst. Denn darin
hängt alles: den Reichtum in satter Fülle zuzeigen
und doch in dem Prunken der Spangen und Mäntel,
in dem überladenen Pomp der Heerschären den
König und zuerst ihn sehen zu lassen. — Es
scheint, als ob sich hier ein Gesetz entwiCkelt habe,
das die Kunst aus sich heraus bildungsfähig macht:
Nun folgt auf das Langsame das weniger Langsame
und Rasche, das Leise zieht das Kräftiglaute an,
und so bei den weiteren Bestimmungen der Töne,
wodurch die Abwechslung, besser eine Unendlich-
keit des Mannigfaltigen gewährleistet wird. Und
in der Tat ist dies ein solches Gesetz, sofem über-
haupt Gesetze bilden. Aus sich heraus aber fließen
Töne nicht; das Gesetz schafft keine Handlungen,
sondern richtet sie. Vielartig sind die Bindungs-
weisen niederer Ordnung, welChe die Musik kennt,
überbestimmt fast bis zur Unbestimmtheit sind die
einzelnen Tonfolgen : So findet das Gesetz der
Mannigfaltigkeit als wählendes reiche Tätigkeit.
Bäld drängt sich diese, bald jene Bestimmung
richtunggebend hervor; das ist natürlich ein Narr,
der etwa glaubt, die Musik erfolge nun aus sich',
und nicht vielmehr aus dem Musiker. Schon weil
er die jeweilig richtunggebende Bestimmung wählL
NaCh dem Gesetz des Gegensatzes und der
Mannigfaltigkeit, das ganz im allgemeinen herreCht,
hebe ich eins heraus, das, ihm untergeordnet, be-
sondere die Einheit sucht mit Hilfe des Wirklich-
keitswertes der Tonfolgen. Diese Tonfolge füh'rt
zu einer anderen und dritten fremden, vereChiedenen,
indem sie folgerichtig gerade die Ordnungsweise,
welche die Wirklichkeit stellt, entwickelt, mehr oder
weniger anekdotische, epische Stimmungs-, Seelen-
bilder entwirft. Sie führt dicht an die Reihenmusik 1.
Und so gibt es noCh' vielerlei Regeln und Gesetze,
aus den Werkzeugen und so weiter. Bald tritt die
Wirksamkeit dieses, bald jenes Gesetzes mehr iri
den Vordergrund; die Musik ist überaus zusammen-
gesetzt, und man wird ihr mit einsCitigen Bestim-
mungen und Regeln nicht gerecht. Vieles berück-
sichtigt der Musiker, und Alles führt ihn auf ein-
mal; wenn auch die Musiker sich in der Bevor-
zugung der verschiedenen Ordnungsweisen unter-
scheiden und gruppieren. Hier klingt eine Ton-
folge: Das Gehen eines Kriegers, mein’ ich, dient
ihr zur Ordnungsweise, gibt ihr den schärferen Sinn,
macht sie höher musikaMsch; diese Folge windet
sich zierhch mit geschnürten Hüften, schlankem
Hälschen, spitzen Füßchen, — begreifliCh, daß sie
weiter balanciert, daß hohe, rasche Figuren leichte
Spitzen über sie werfen, daß ein Brummbäß gegen
sie antapert, sie zärtMch verdreht, verstimüit; sie
kreischen und kichem; eine andere Folge hät
Seufzer in sich getmnken, nun schleicht und kriecht
es ohne Ende. Die Faust schwingt diese Folge,
höhnt und droht und läßt sich nicht besänftigen.
Bekümmert und schämig bleibt dieSfe auf dem Flecke
stehen, geht nach ein paar Schritten immer wiedef
zurüdk und im Kreise wie ein verlassenes Mäd-
chen. UeberbMckst Du ein längeres Musikstück, so
wiret Du finden, daß die Fortführung der Ton-
folgen auf sehr wechselnder Grundlage geschieht.
Jetzt wird mit einem zagsaften Zwie- und Zwitscher-
gespräch begonnen, jetzt fordem die singendefl
Saitentöne eine Abwechslung in aufschmettemdefl
Trompeten, die ihren Glanz und ihre Eigenart erst
gegen dumpfe Holzbläser erweisen wollen, um
wieder die Saitentöne hervorzittern zu lassfen; jetzt
ladet eine kleine Tonfolge zu breiter, liedähnlichef
Ausfühmng ein; nachdem in wechselnder Stärke
gespielt wurde, gilt es nun, auf gleichmiäßiger Höhe
zu bleiben und mhig fortzuspinnen. Bei Anwen-
dung dieser einfaChen, sehr einfachen und begreif-
MChen, doch' wechselnden Regeln des Zusammefl'
hängs spielt naturgemäßi der Chärakter, das Tem'
perament, die Eigenart des Musikere die Haupt-
rolle. Du mußt mich nicht mißverstehfen, wfenn ich
sage, die Musik trüge ihre Gesetze nicht in sich»
sondern im Musiker. Ich will mich nicht versteckefl
hinter dem ! Herrifehter, — das mögen andere tufl
und schwätzen von dem schöpferischen Willen —>
vielmehr hat ja alles Betrachten der Kunst ebefl
diesen Sinn, Herr zu werden dieses Herm, diese*
166