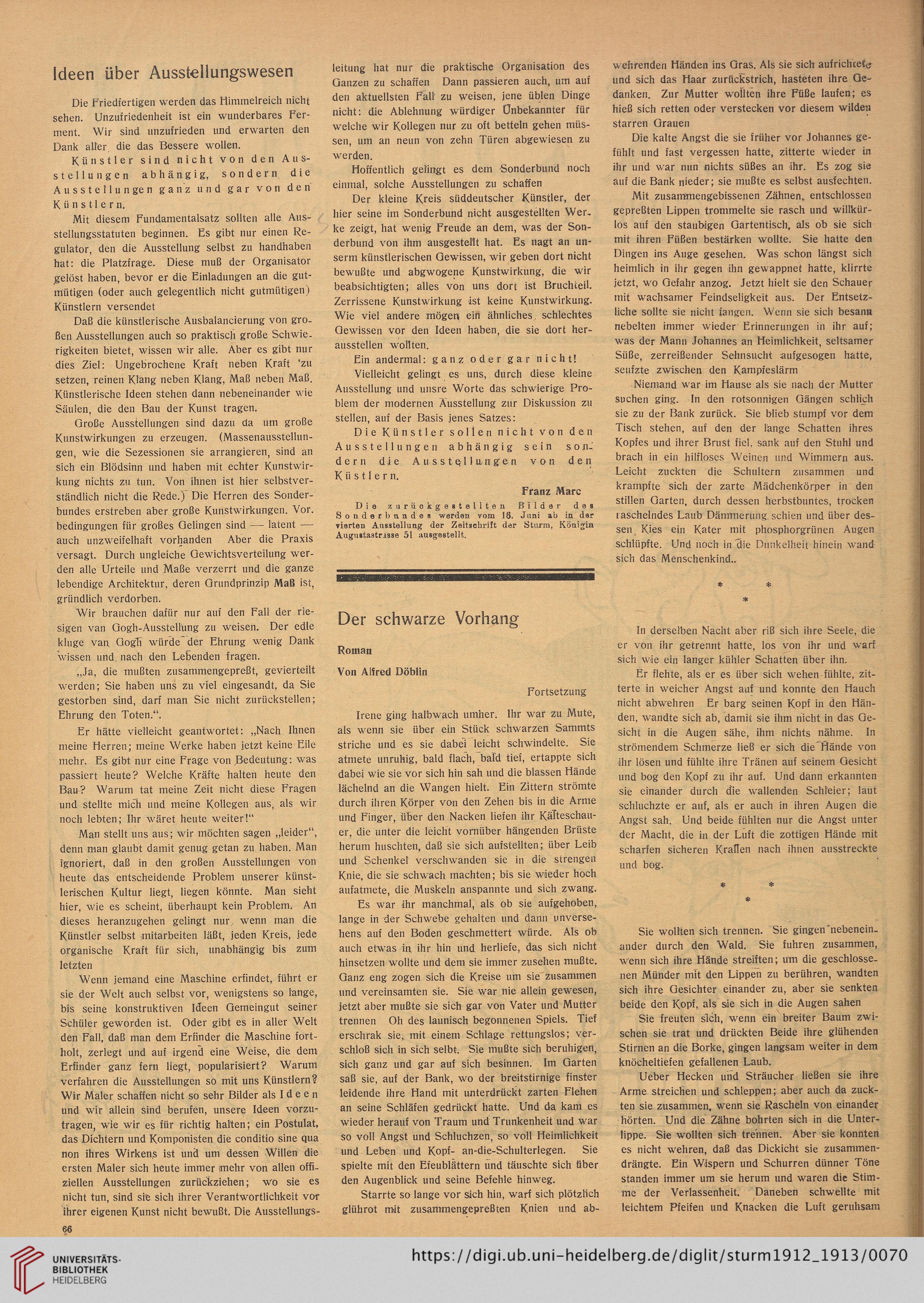Ideen über Ausstellungswesen
Die Friedfertigen werden das Himmelreich nicht
sehen. Unzufriedenheit ist ein wunderbares Fer-
ment. Wir sind unzufrieden und erwarten den
Dank aller die das Bessere wollen.
Künstler sind nicht von den Aus-
stellungen abhängig, sondern die
Ausstellungen ganz und gar von den
Künstlern.
Mit diesem Fundamentalsatz sollten alle Aus-
stellungsstatuten beginnen. Es gibt nur einen Re-
gulator, den die Ausstellung selbst zu handhaben
hat: die Platzfrage. Diese muß der Organisator
gelöst haben, bevor er die Einladungen an die gut-
mütigen (oder auch gelegentlich nicht gutmütigen)
Künstlern versendet
Daß die künstlerische Ausbalancierung von gro-
ßen Ausstellungen auch so praktisch große Schwie-
rigkeiten bietet, wissen wir alle. Aber es gibt nur
dies Ziel: Ungebrochene Kraft neben Kraft ‘zu
setzen, reinen Klang neben Klang, Maß neben Maß.
Künstlerische Ideen stehen dann nebeneinander wie
Säulen, die den Bau der Kunst tragen.
Große Ausstellungen sind dazu da um große
Kunstwirkungen zu erzeugen. (Massenausstellun-
gen, wie die Sezessionen sie arrangieren, sind an
sich ein Blödsinn und haben mit echter Kunstwir-
kung nichts zu tun. Von ihnen ist hier selbstver-
ständlich nicht die Rede.) Die Herren des Sonder-
bundes erstreben aber große Kunstwirkungen. Vor.
bedingungen für großes Gelingen sind — latent —
auch unzweifelhaft vorhanden Aber die Praxis
versagt. Durch ungleiche Gewichtsverteilung wer-
den alle Urteile und Maße verzerrt und die ganze
lebendige Architektur, deren Grundprinzip Maß ist,
gründlich verdorben.
Wir brauchen dafür nur auf den Fall der rie-
sigen van Gogh-Ausstellung zu weisen. Der edle
kluge van Gogh würde der Ehrung wenig Dank
wissen und nach den Lebenden fragen.
„Ja, die mußten zusammengepreßt, gevierteilt
werden; Sie haben uns zu viel eingesandt, da Sie
gestorben sind, darf man Sie nicht zurückstellen;
Ehrung den Toten.“.
Er hätte vielleicht geantwortet: „Nach Ihnen
meine Herren; meine Werke haben jetzt keine Eile
mehr. Es gibt nur eine Frage von Bedeutung: was
passiert heute? Welche Kräfte halten heute den
Bau? Warum tat meine Zeit nicht diese Fragen
und stellte mich und meine Kollegen aus, als wir
noch lebten; Ihr wäret heute weiter!“
Man stellt uns aus; wir möchten sagen „leider“,
denn man glaubt damit genug getan zu haben. Man
ignoriert, daß in den großen Ausstellungen von
heute das entscheidende Problem unserer künst-
lerischen Kultur liegt, liegen könnte. Man sieht
hier, wie es scheint, überhaupt kein Problem. An
dieses heranzugehen gelingt nur., wenn man die
Künstler selbst mitarbeiten läßt, jeden Kreis, jede
organische Kraft für sich, unabhängig bis zum
letzten
Wenn jemand eine Maschine erfindet, führt er
sie der Welt auch selbst vor, wenigstens so lange,
bis seine konstruktiven Ideen Gemeingut seiner
Schüler geworden ist. Oder gibt es in aller Welt
den Fall, daß man dem Erfinder die Maschine fort-
holt, zerlegt und auf irgend eine Weise, die dem
Erfinder ganz fern liegt, popularisiert? Warum
verfahren die Ausstellungen so mit uns Künstlern?
Wir Maler schaffen nicht so sehr Bilder als I d e e n
und wir allein sind berufen, unsere Ideen vorzu-
tragen, wie wir es für richtig halten; ein Postulat,
das Dichtern und Komponisten die conditio sine qua
non ihres Wirkens ist und um dessen Willen die
ersten Maler sich heute immer mehr von allen offi-
ziellen Ausstellungen zurückziehen; wo sie es
nicht tun, sind sie sich ihrer Verantwortlichkeit vor
ihrer eigenen Kunst nicht bewußt. Die Ausstellungs-
ee
leitung hat nur die praktische Organisation des
Ganzen zu schaffen Dann passieren auch, um auf
den aktuellsten Fall zu weisen, jene üblen Dinge
nicht: die Ablehnung würdiger Unbekannter für
welche wir Kollegen nur zu oft betteln gehen müs-
sen, um an neun von zehn Türen abgewiesen zu
werden.
Hoffentlich gelingt es dem Sonderbund noch
einmal, solche Ausstellungen zu schaffen
Der kleine Kreis süddeutscher Künstler, der
hier seine im Sonderbund nicht ausgestellten Wer-
ke zeigt, hat wenig Freude an dem, was der Son-
derbund von ihm ausgestellt hat. Es nagt an un-
serm künstlerischen Gewissen, wir geben dort nicht
bewußte und abgwogene Kunstwirkung, die wir
beabsichtigten; alles von uns dort ist Bruchteil.
Zerrissene Kunstwirkung ist keine Kunstwirkung.
Wie viel andere mögen ein ähnliches schlechtes
Gewissen vor den Ideen haben, die sie dort her-
ausstellen wollten.
Ein andermal: ganz oder gar nicht!
Vielleicht gelingt es uns, durch diese kleine
Ausstellung und unsre Worte das schwierige Pro-
blem der modernen Ausstellung zur Diskussion zu
stellen, auf der Basis jenes Satzes:
Die Künstler sollen nicht von den
Ausstellungen abhängig sein son-
dern die Ausstellungen von den
K ü s 11 e r n.
Franz Marc
Die zurück gestellten Bilder des
Sonder Landes werden vom 18. Juni ab in dar
vierten Ausstellung der Zeitschrift der Sturm, Königin
Augustastrusse 51 ausgestellt.
Der schwarze Vorhang
Roman
Von Alfred Döblin
Fortsetzung
Irene ging halbwach umher. Ihr war zu Mute,
als wenn sie über ein Stück schwarzen Sammts
striche und es sie dabei leicht schwindelte. Sie
atmete unruhig, bald flach, bald tief, ertappte sich
dabei wie sie vor sich hin sah und die blassen Hände
lächelnd an die Wangen hielt. Ein Zittern strömte
durch ihren Körper von den Zehen bis in die Arme
und Finger, über den Nacken liefen ihr Kälteschau-
er, die unter die leicht vornüber hängenden Brüste
herum huschten, daß sie sich aufstellten; über Leib
und Schenkel’ verschwanden sie in die strengen
Knie, die sie schwach machten; bis sie wieder hoch
aufatmete, die Muskeln anspannte und sich zwang.
Es war ihr manchmal, als ob sie aufgehoben,
lange in der Schwebe gehalten und dann unverse-
hens auf den Boden geschmettert würde. Als ob
auch etwas in ihr hin und herliefe, das sich nicht
hinsetzen wollte und dem sie immer zusehen mußte.
Ganz eng zogen sich die Kreise um sie zusammen
und vereinsamten sie. Sie war nie allein gewesen,
jetzt aber mußte sie sich gar von Vater und Mutter
trennen Oh des launisch begonnenen Spiels. Tief
erschrak sie,, mit einem Schlage rettungslos; ver-
schloß sich in sich selbt. Sie mußte sich beruhigen,
sich ganz und gar auf sich besinnen. Im Garten
saß sie, auf der Bank, wo der breitstirnige finster
leidende ihre Hand mit unterdrückt zarten Flehen
an seine Schläfen gedrückt hatte. Und da kam es
wieder herauf von Traum und Trunkenheit und war
so voll Angst und Schluchzen, so voll Heimlichkeit
und Leben und Kopf- an-die-Schulterlegen. Sie
spielte mit den Efeublättern und täuschte sich über
den Augenblick und seine Befehle hinweg.
Starrte so lange vor sich hin, warf sich plötzlich
glührot mit zusammengepreßten Knien und ab-
wehrenden Händen ins Gras. Als sie sich auf richtete*
und sich das Haar zurückstrich, hasteten ihre Ge-
danken. Zur Mutter wollten ihre Füße laufen; es
hieß sich retten oder verstecken vor diesem wilden
starren Grauen
Die kalte Angst die sie früher vor Johannes ge-
fühlt und fast vergessen hatte, zitterte wieder in
ihr und war nun nichts, süßes an ihr. Es zog sie
auf die Bank nieder; sie mußte es selbst ausfechten.
Mit zusammengebissenen Zähnen,, entschlossen
gepreßten Lippen trommelte sie rasch und willkür-
los auf den staubigen Gartentisch, als ob sie sich
mit ihren Füßen bestärken wollte. Sie hatte den
Dingen ins Auge gesehen. Was schon längst sich
heimlich in ihr gegen ihn gewappnet hatte, klirrte
jetzt, wo Gefahr anzog. Jetzt hielt sie den Schauer
mit wachsamer Feindseligkeit aus. Der Entsetz-
liche sollte sie nicht fangen. Wenn sie sich besann
nebelten immer wieder Erinnerungen in ihr auf;
was der Mann Johannes an Heimlichkeit, seltsamer
Süße, zerreißender Sehnsucht aufgesogen hatte,
seufzte zwischen den Kampfeslärm
Niemand war im Hause als sie nach der Mutter
suchen ging. In den rotsonnigen Gängen schlich
sie zu der Bank zurück. Sie blieb stumpf vor dem
Tisch stehen, auf den der länge Schatten ihres
Kopfes und ihrer Brust fiel, sank auf den Stuhl und
brach in ein hilfloses Weinen und Wimmern aus.
Leicht zuckten die Schultern zusammen und
krampfte sich der zarte Alädchenkörper in den
stillen Garten, durch dessen herbstbuntes, trocken
laschelndes Laub Dämmerung, schien und über des-
sen Kies ein Kater mit phosphorgrünen Augen
schlüpfte. Und noch in die Dunkelheit hinein wand
sich das Menschenkind..
* *
*
In derselben Nacht aber riß sich ihre Seele, die
er von ihr getrennt hatte, los von ihr und warf
sich wie ein langer kühler Schatten über ihn.
Er flehte, als er es über sich wehen fühlte, zit-
terte in weicher Angst auf und konnte den Hauch
nicht abwehren Er barg seinen Kopf in den Hän-
den, wandte sich ab, damit sie ihm nicht in das Ge-
sicht in die Augen sähe, ihm nichts nähme. In
strömendem Schmerze ließ er sich die Hände von
ihr lösen und fühlte ihre Tränen auf seinem Gesicht
und bog den Kopf zu ihr auf. Und dann erkannten
sie einander durch die wallenden Schleier; laut
schluchzte er auf, als er auch in ihren Augen die
Angst sah. Und beide fühlten nur die Angst unter
der Macht, die in der Luft die zottigen Hände mit
scharfen sicheren Kraßen nach ihnen ausstreckte
und bog.
* *
*
Sie wollten sich trennen. Sie gingen‘nebenein-
ander durch den Wald. Sie fuhren zusammen,
wenn sich ihre Hände streiften; um die geschlosse-
nen Münder mit den Lippen zu berühren, wandten
sich ihre Gesichter einander zu, aber sie senkten
beide den Kopf, als säe sich in die Augen sahen
Sie freuten sich, wenn ein breiter Baum zwi-
schen sie trat und drückten Beide ihre glühenden
Stirnen an die Borke, gingen langsam weiter in dem
knöcheltiefen gefallenen Laub.
Ueber Hecken und Sträucher ließen sie ihre
Arme streichen und schleppen; aber auch da zuck-
ten sie zusammen, wenn sie Rascheln von einander
hörten. Und die Zähne bohrten sich in die Unter-
lippe. Sie wollten sich trennen. Aber sie konnten
es nicht wehren, daß das Dickicht sie zusammen-
drängte. Ein Wispern und Schurren dünner Töne
standen immer um sie herum und waren die Stim-
me der Verlassenheit. Daneben schwellte mit
leichtem Pfeifen und Knacken die Luft geruhsam
Die Friedfertigen werden das Himmelreich nicht
sehen. Unzufriedenheit ist ein wunderbares Fer-
ment. Wir sind unzufrieden und erwarten den
Dank aller die das Bessere wollen.
Künstler sind nicht von den Aus-
stellungen abhängig, sondern die
Ausstellungen ganz und gar von den
Künstlern.
Mit diesem Fundamentalsatz sollten alle Aus-
stellungsstatuten beginnen. Es gibt nur einen Re-
gulator, den die Ausstellung selbst zu handhaben
hat: die Platzfrage. Diese muß der Organisator
gelöst haben, bevor er die Einladungen an die gut-
mütigen (oder auch gelegentlich nicht gutmütigen)
Künstlern versendet
Daß die künstlerische Ausbalancierung von gro-
ßen Ausstellungen auch so praktisch große Schwie-
rigkeiten bietet, wissen wir alle. Aber es gibt nur
dies Ziel: Ungebrochene Kraft neben Kraft ‘zu
setzen, reinen Klang neben Klang, Maß neben Maß.
Künstlerische Ideen stehen dann nebeneinander wie
Säulen, die den Bau der Kunst tragen.
Große Ausstellungen sind dazu da um große
Kunstwirkungen zu erzeugen. (Massenausstellun-
gen, wie die Sezessionen sie arrangieren, sind an
sich ein Blödsinn und haben mit echter Kunstwir-
kung nichts zu tun. Von ihnen ist hier selbstver-
ständlich nicht die Rede.) Die Herren des Sonder-
bundes erstreben aber große Kunstwirkungen. Vor.
bedingungen für großes Gelingen sind — latent —
auch unzweifelhaft vorhanden Aber die Praxis
versagt. Durch ungleiche Gewichtsverteilung wer-
den alle Urteile und Maße verzerrt und die ganze
lebendige Architektur, deren Grundprinzip Maß ist,
gründlich verdorben.
Wir brauchen dafür nur auf den Fall der rie-
sigen van Gogh-Ausstellung zu weisen. Der edle
kluge van Gogh würde der Ehrung wenig Dank
wissen und nach den Lebenden fragen.
„Ja, die mußten zusammengepreßt, gevierteilt
werden; Sie haben uns zu viel eingesandt, da Sie
gestorben sind, darf man Sie nicht zurückstellen;
Ehrung den Toten.“.
Er hätte vielleicht geantwortet: „Nach Ihnen
meine Herren; meine Werke haben jetzt keine Eile
mehr. Es gibt nur eine Frage von Bedeutung: was
passiert heute? Welche Kräfte halten heute den
Bau? Warum tat meine Zeit nicht diese Fragen
und stellte mich und meine Kollegen aus, als wir
noch lebten; Ihr wäret heute weiter!“
Man stellt uns aus; wir möchten sagen „leider“,
denn man glaubt damit genug getan zu haben. Man
ignoriert, daß in den großen Ausstellungen von
heute das entscheidende Problem unserer künst-
lerischen Kultur liegt, liegen könnte. Man sieht
hier, wie es scheint, überhaupt kein Problem. An
dieses heranzugehen gelingt nur., wenn man die
Künstler selbst mitarbeiten läßt, jeden Kreis, jede
organische Kraft für sich, unabhängig bis zum
letzten
Wenn jemand eine Maschine erfindet, führt er
sie der Welt auch selbst vor, wenigstens so lange,
bis seine konstruktiven Ideen Gemeingut seiner
Schüler geworden ist. Oder gibt es in aller Welt
den Fall, daß man dem Erfinder die Maschine fort-
holt, zerlegt und auf irgend eine Weise, die dem
Erfinder ganz fern liegt, popularisiert? Warum
verfahren die Ausstellungen so mit uns Künstlern?
Wir Maler schaffen nicht so sehr Bilder als I d e e n
und wir allein sind berufen, unsere Ideen vorzu-
tragen, wie wir es für richtig halten; ein Postulat,
das Dichtern und Komponisten die conditio sine qua
non ihres Wirkens ist und um dessen Willen die
ersten Maler sich heute immer mehr von allen offi-
ziellen Ausstellungen zurückziehen; wo sie es
nicht tun, sind sie sich ihrer Verantwortlichkeit vor
ihrer eigenen Kunst nicht bewußt. Die Ausstellungs-
ee
leitung hat nur die praktische Organisation des
Ganzen zu schaffen Dann passieren auch, um auf
den aktuellsten Fall zu weisen, jene üblen Dinge
nicht: die Ablehnung würdiger Unbekannter für
welche wir Kollegen nur zu oft betteln gehen müs-
sen, um an neun von zehn Türen abgewiesen zu
werden.
Hoffentlich gelingt es dem Sonderbund noch
einmal, solche Ausstellungen zu schaffen
Der kleine Kreis süddeutscher Künstler, der
hier seine im Sonderbund nicht ausgestellten Wer-
ke zeigt, hat wenig Freude an dem, was der Son-
derbund von ihm ausgestellt hat. Es nagt an un-
serm künstlerischen Gewissen, wir geben dort nicht
bewußte und abgwogene Kunstwirkung, die wir
beabsichtigten; alles von uns dort ist Bruchteil.
Zerrissene Kunstwirkung ist keine Kunstwirkung.
Wie viel andere mögen ein ähnliches schlechtes
Gewissen vor den Ideen haben, die sie dort her-
ausstellen wollten.
Ein andermal: ganz oder gar nicht!
Vielleicht gelingt es uns, durch diese kleine
Ausstellung und unsre Worte das schwierige Pro-
blem der modernen Ausstellung zur Diskussion zu
stellen, auf der Basis jenes Satzes:
Die Künstler sollen nicht von den
Ausstellungen abhängig sein son-
dern die Ausstellungen von den
K ü s 11 e r n.
Franz Marc
Die zurück gestellten Bilder des
Sonder Landes werden vom 18. Juni ab in dar
vierten Ausstellung der Zeitschrift der Sturm, Königin
Augustastrusse 51 ausgestellt.
Der schwarze Vorhang
Roman
Von Alfred Döblin
Fortsetzung
Irene ging halbwach umher. Ihr war zu Mute,
als wenn sie über ein Stück schwarzen Sammts
striche und es sie dabei leicht schwindelte. Sie
atmete unruhig, bald flach, bald tief, ertappte sich
dabei wie sie vor sich hin sah und die blassen Hände
lächelnd an die Wangen hielt. Ein Zittern strömte
durch ihren Körper von den Zehen bis in die Arme
und Finger, über den Nacken liefen ihr Kälteschau-
er, die unter die leicht vornüber hängenden Brüste
herum huschten, daß sie sich aufstellten; über Leib
und Schenkel’ verschwanden sie in die strengen
Knie, die sie schwach machten; bis sie wieder hoch
aufatmete, die Muskeln anspannte und sich zwang.
Es war ihr manchmal, als ob sie aufgehoben,
lange in der Schwebe gehalten und dann unverse-
hens auf den Boden geschmettert würde. Als ob
auch etwas in ihr hin und herliefe, das sich nicht
hinsetzen wollte und dem sie immer zusehen mußte.
Ganz eng zogen sich die Kreise um sie zusammen
und vereinsamten sie. Sie war nie allein gewesen,
jetzt aber mußte sie sich gar von Vater und Mutter
trennen Oh des launisch begonnenen Spiels. Tief
erschrak sie,, mit einem Schlage rettungslos; ver-
schloß sich in sich selbt. Sie mußte sich beruhigen,
sich ganz und gar auf sich besinnen. Im Garten
saß sie, auf der Bank, wo der breitstirnige finster
leidende ihre Hand mit unterdrückt zarten Flehen
an seine Schläfen gedrückt hatte. Und da kam es
wieder herauf von Traum und Trunkenheit und war
so voll Angst und Schluchzen, so voll Heimlichkeit
und Leben und Kopf- an-die-Schulterlegen. Sie
spielte mit den Efeublättern und täuschte sich über
den Augenblick und seine Befehle hinweg.
Starrte so lange vor sich hin, warf sich plötzlich
glührot mit zusammengepreßten Knien und ab-
wehrenden Händen ins Gras. Als sie sich auf richtete*
und sich das Haar zurückstrich, hasteten ihre Ge-
danken. Zur Mutter wollten ihre Füße laufen; es
hieß sich retten oder verstecken vor diesem wilden
starren Grauen
Die kalte Angst die sie früher vor Johannes ge-
fühlt und fast vergessen hatte, zitterte wieder in
ihr und war nun nichts, süßes an ihr. Es zog sie
auf die Bank nieder; sie mußte es selbst ausfechten.
Mit zusammengebissenen Zähnen,, entschlossen
gepreßten Lippen trommelte sie rasch und willkür-
los auf den staubigen Gartentisch, als ob sie sich
mit ihren Füßen bestärken wollte. Sie hatte den
Dingen ins Auge gesehen. Was schon längst sich
heimlich in ihr gegen ihn gewappnet hatte, klirrte
jetzt, wo Gefahr anzog. Jetzt hielt sie den Schauer
mit wachsamer Feindseligkeit aus. Der Entsetz-
liche sollte sie nicht fangen. Wenn sie sich besann
nebelten immer wieder Erinnerungen in ihr auf;
was der Mann Johannes an Heimlichkeit, seltsamer
Süße, zerreißender Sehnsucht aufgesogen hatte,
seufzte zwischen den Kampfeslärm
Niemand war im Hause als sie nach der Mutter
suchen ging. In den rotsonnigen Gängen schlich
sie zu der Bank zurück. Sie blieb stumpf vor dem
Tisch stehen, auf den der länge Schatten ihres
Kopfes und ihrer Brust fiel, sank auf den Stuhl und
brach in ein hilfloses Weinen und Wimmern aus.
Leicht zuckten die Schultern zusammen und
krampfte sich der zarte Alädchenkörper in den
stillen Garten, durch dessen herbstbuntes, trocken
laschelndes Laub Dämmerung, schien und über des-
sen Kies ein Kater mit phosphorgrünen Augen
schlüpfte. Und noch in die Dunkelheit hinein wand
sich das Menschenkind..
* *
*
In derselben Nacht aber riß sich ihre Seele, die
er von ihr getrennt hatte, los von ihr und warf
sich wie ein langer kühler Schatten über ihn.
Er flehte, als er es über sich wehen fühlte, zit-
terte in weicher Angst auf und konnte den Hauch
nicht abwehren Er barg seinen Kopf in den Hän-
den, wandte sich ab, damit sie ihm nicht in das Ge-
sicht in die Augen sähe, ihm nichts nähme. In
strömendem Schmerze ließ er sich die Hände von
ihr lösen und fühlte ihre Tränen auf seinem Gesicht
und bog den Kopf zu ihr auf. Und dann erkannten
sie einander durch die wallenden Schleier; laut
schluchzte er auf, als er auch in ihren Augen die
Angst sah. Und beide fühlten nur die Angst unter
der Macht, die in der Luft die zottigen Hände mit
scharfen sicheren Kraßen nach ihnen ausstreckte
und bog.
* *
*
Sie wollten sich trennen. Sie gingen‘nebenein-
ander durch den Wald. Sie fuhren zusammen,
wenn sich ihre Hände streiften; um die geschlosse-
nen Münder mit den Lippen zu berühren, wandten
sich ihre Gesichter einander zu, aber sie senkten
beide den Kopf, als säe sich in die Augen sahen
Sie freuten sich, wenn ein breiter Baum zwi-
schen sie trat und drückten Beide ihre glühenden
Stirnen an die Borke, gingen langsam weiter in dem
knöcheltiefen gefallenen Laub.
Ueber Hecken und Sträucher ließen sie ihre
Arme streichen und schleppen; aber auch da zuck-
ten sie zusammen, wenn sie Rascheln von einander
hörten. Und die Zähne bohrten sich in die Unter-
lippe. Sie wollten sich trennen. Aber sie konnten
es nicht wehren, daß das Dickicht sie zusammen-
drängte. Ein Wispern und Schurren dünner Töne
standen immer um sie herum und waren die Stim-
me der Verlassenheit. Daneben schwellte mit
leichtem Pfeifen und Knacken die Luft geruhsam