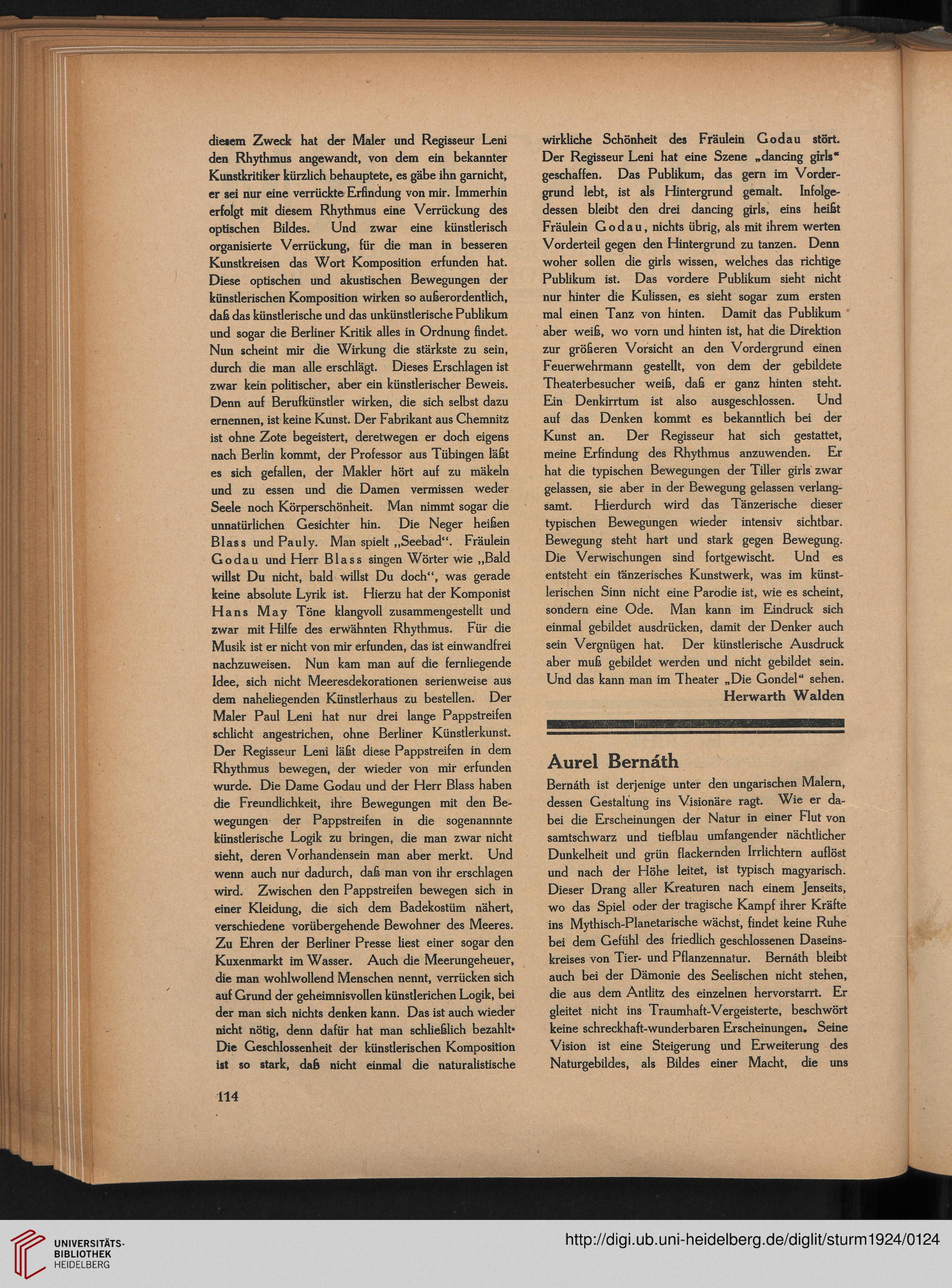diesem Zweck hat der Maler und Regisseur Leni
den Rhythmus angewandt, von dem ein bekannter
Kunstkritiker kürzlich behauptete, es gäbe ihn garnicht,
er sei nur eine verrückte Erfindung von mir. Immerhin
erfolgt mit diesem Rhythmus eine Verrückung des
optischen Bildes. Und zwar eine künstlerisch
organisierte Verrückung, für die man in besseren
Kunstkreisen das Wort Komposition erfunden hat.
Diese optischen und akustischen Bewegungen der
künstlerischen Komposition wirken so außerordentlich,
daß das künstlerische und das unkünstlerische Publikum
und sogar die Berliner Kritik alles in Ordnung findet.
Nun scheint mir die Wirkung die stärkste zu sein,
durch die man alle erschlägt. Dieses Erschlagen ist
zwar kein politischer, aber ein künstlerischer Beweis.
Denn auf Berufkünstler wirken, die sich selbst dazu
ernennen, ist keine Kunst. Der Fabrikant aus Chemnitz
ist ohne Zote begeistert, deretwegen er doch eigens
nach Berlin kommt, der Professor aus Tübingen läßt
es sich gefallen, der Makler hört auf zu mäkeln
und zu essen und die Damen vermissen weder
Seele noch Körperschönheit. Man nimmt sogar die
unnatürlichen Gesichter hin. Die Neger heißen
Blass und Pauly. Man spielt „Seebad“. Fräulein
Godau und Herr Blass singen Wörter wie „Bald
willst Du nicht, bald willst Du doch“, was gerade
keine absolute Lyrik ist. Hierzu hat der Komponist
Hans May Töne klangvoll zusammengestellt und
zwar mit Hilfe des erwähnten Rhythmus. Für die
Musik ist er nicht von mir erfunden, das ist einwandfrei
nachzuweisen. Nun kam man auf die fernliegende
Idee, sich nicht Meeresdekorationen serienweise aus
dem naheliegenden Künstlerhaus zu bestellen. Der
Maler Paul Leni hat nur drei lange Pappstreifen
schlicht angestrichen, ohne Berliner Künstlerkunst.
Der Regisseur Leni läßt diese Pappstreifen in dem
Rhythmus bewegen, der wieder von mir erfunden
wurde. Die Dame Godau und der Herr Blass haben
die Freundlichkeit, ihre Bewegungen mit den Be-
wegungen der Pappstreifen in die sogenannnte
künstlerische Logik zu bringen, die man zwar nicht
sieht, deren Vorhandensein man aber merkt. Und
wenn auch nur dadurch, daß man von ihr erschlagen
wird. Zwischen den Pappstreifen bewegen sich in
einer Kleidung, die sich dem Badekostüm nähert,
verschiedene vorübergehende Bewohner des Meeres.
Zu Ehren der Berliner Presse liest einer sogar den
Kuxenmarkt im Wasser. Auch die Meerungeheuer,
die man wohlwollend Menschen nennt, verrücken sich
auf Grund der geheimnisvollen künstlerichen Logik, bei
der man sich nichts denken kann. Das ist auch wieder
nicht nötig, denn dafür hat man schließlich bezahlt«
Die Geschlossenheit der künstlerischen Komposition
ist so stark, daß nicht einmal die naturalistische
wirkliche Schönheit des Fräulein Godau stört.
Der Regisseur Leni hat eine Szene „dancing girls“
geschaffen. Das Publikum, das gern im Vorder-
grund lebt, ist als Hintergrund gemalt. Infolge-
dessen bleibt den drei dancing girls, eins heißt
Fräulein Godau, nichts übrig, als mit ihrem werten
Vorderteil gegen den Hintergrund zu tanzen. Denn
woher sollen die girls wissen, welches das richtige
Publikum ist. Das vordere Publikum sieht nicht
nur hinter die Kulissen, es sieht sogar zum ersten
mal einen Tanz von hinten. Damit das Publikum
aber weiß, wo vorn und hinten ist, hat die Direktion
zur größeren Vorsicht an den Vordergrund einen
Feuerwehrmann gestellt, von dem der gebildete
Theaterbesucher weiß, daß er ganz hinten steht.
Ein Denkirrtum ist also ausgeschlossen. Und
auf das Denken kommt es bekanntlich bei der
Kunst an. Der Regisseur hat sich gestattet,
meine Erfindung des Rhythmus anzuwenden. Er
hat die typischen Bewegungen der Tiller girls zwar
gelassen, sie aber in der Bewegung gelassen verlang-
samt. Hierdurch wird das Tänzerische dieser
typischen Bewegungen wieder intensiv sichtbar.
Bewegung steht hart und stark gegen Bewegung.
Die Verwischungen sind fortgewischt. Und es
entsteht ein tänzerisches Kunstwerk, was im künst-
lerischen Sinn nicht eine Parodie ist, wie es scheint,
sondern eine Ode. Man kann im Eindruck sich
einmal gebildet ausdrücken, damit der Denker auch
sein Vergnügen hat. Der künstlerische Ausdruck
aber muß gebildet werden und nicht gebildet sein.
Und das kann man im Theater „Die Gondel“ sehen.
Herwarth Walden
Aurel Bernäth
Bernäth ist derjenige unter den ungarischen Malern,
dessen Gestaltung ins Visionäre ragt. Wie er da-
bei die Erscheinungen der Natur in einer Flut von
samtschwarz und tiefblau umfangender nächtlicher
Dunkelheit und grün flackernden Irrlichtern auflöst
und nach der Höhe leitet, ist typisch magyarisch.
Dieser Drang aller Kreaturen nach einem Jenseits,
wo das Spiel oder der tragische Kampf ihrer Kräfte
ins Mythisch-Planetarische wächst, findet keine Ruhe
bei dem Gefühl des friedlich geschlossenen Daseins-
kreises von Tier- und Pflanzennatur. Bernäth bleibt
auch bei der Dämonie des Seelischen nicht stehen,
die aus dem Antlitz des einzelnen hervorstarrt. Er
gleitet nicht ins Traumhaft-Vergeisterte, beschwört
keine schreckhaft-wunder baren Erscheinungen. Seine
Vision ist eine Steigerung und Erweiterung des
Naturgebildes, als Bildes einer Macht, die uns
den Rhythmus angewandt, von dem ein bekannter
Kunstkritiker kürzlich behauptete, es gäbe ihn garnicht,
er sei nur eine verrückte Erfindung von mir. Immerhin
erfolgt mit diesem Rhythmus eine Verrückung des
optischen Bildes. Und zwar eine künstlerisch
organisierte Verrückung, für die man in besseren
Kunstkreisen das Wort Komposition erfunden hat.
Diese optischen und akustischen Bewegungen der
künstlerischen Komposition wirken so außerordentlich,
daß das künstlerische und das unkünstlerische Publikum
und sogar die Berliner Kritik alles in Ordnung findet.
Nun scheint mir die Wirkung die stärkste zu sein,
durch die man alle erschlägt. Dieses Erschlagen ist
zwar kein politischer, aber ein künstlerischer Beweis.
Denn auf Berufkünstler wirken, die sich selbst dazu
ernennen, ist keine Kunst. Der Fabrikant aus Chemnitz
ist ohne Zote begeistert, deretwegen er doch eigens
nach Berlin kommt, der Professor aus Tübingen läßt
es sich gefallen, der Makler hört auf zu mäkeln
und zu essen und die Damen vermissen weder
Seele noch Körperschönheit. Man nimmt sogar die
unnatürlichen Gesichter hin. Die Neger heißen
Blass und Pauly. Man spielt „Seebad“. Fräulein
Godau und Herr Blass singen Wörter wie „Bald
willst Du nicht, bald willst Du doch“, was gerade
keine absolute Lyrik ist. Hierzu hat der Komponist
Hans May Töne klangvoll zusammengestellt und
zwar mit Hilfe des erwähnten Rhythmus. Für die
Musik ist er nicht von mir erfunden, das ist einwandfrei
nachzuweisen. Nun kam man auf die fernliegende
Idee, sich nicht Meeresdekorationen serienweise aus
dem naheliegenden Künstlerhaus zu bestellen. Der
Maler Paul Leni hat nur drei lange Pappstreifen
schlicht angestrichen, ohne Berliner Künstlerkunst.
Der Regisseur Leni läßt diese Pappstreifen in dem
Rhythmus bewegen, der wieder von mir erfunden
wurde. Die Dame Godau und der Herr Blass haben
die Freundlichkeit, ihre Bewegungen mit den Be-
wegungen der Pappstreifen in die sogenannnte
künstlerische Logik zu bringen, die man zwar nicht
sieht, deren Vorhandensein man aber merkt. Und
wenn auch nur dadurch, daß man von ihr erschlagen
wird. Zwischen den Pappstreifen bewegen sich in
einer Kleidung, die sich dem Badekostüm nähert,
verschiedene vorübergehende Bewohner des Meeres.
Zu Ehren der Berliner Presse liest einer sogar den
Kuxenmarkt im Wasser. Auch die Meerungeheuer,
die man wohlwollend Menschen nennt, verrücken sich
auf Grund der geheimnisvollen künstlerichen Logik, bei
der man sich nichts denken kann. Das ist auch wieder
nicht nötig, denn dafür hat man schließlich bezahlt«
Die Geschlossenheit der künstlerischen Komposition
ist so stark, daß nicht einmal die naturalistische
wirkliche Schönheit des Fräulein Godau stört.
Der Regisseur Leni hat eine Szene „dancing girls“
geschaffen. Das Publikum, das gern im Vorder-
grund lebt, ist als Hintergrund gemalt. Infolge-
dessen bleibt den drei dancing girls, eins heißt
Fräulein Godau, nichts übrig, als mit ihrem werten
Vorderteil gegen den Hintergrund zu tanzen. Denn
woher sollen die girls wissen, welches das richtige
Publikum ist. Das vordere Publikum sieht nicht
nur hinter die Kulissen, es sieht sogar zum ersten
mal einen Tanz von hinten. Damit das Publikum
aber weiß, wo vorn und hinten ist, hat die Direktion
zur größeren Vorsicht an den Vordergrund einen
Feuerwehrmann gestellt, von dem der gebildete
Theaterbesucher weiß, daß er ganz hinten steht.
Ein Denkirrtum ist also ausgeschlossen. Und
auf das Denken kommt es bekanntlich bei der
Kunst an. Der Regisseur hat sich gestattet,
meine Erfindung des Rhythmus anzuwenden. Er
hat die typischen Bewegungen der Tiller girls zwar
gelassen, sie aber in der Bewegung gelassen verlang-
samt. Hierdurch wird das Tänzerische dieser
typischen Bewegungen wieder intensiv sichtbar.
Bewegung steht hart und stark gegen Bewegung.
Die Verwischungen sind fortgewischt. Und es
entsteht ein tänzerisches Kunstwerk, was im künst-
lerischen Sinn nicht eine Parodie ist, wie es scheint,
sondern eine Ode. Man kann im Eindruck sich
einmal gebildet ausdrücken, damit der Denker auch
sein Vergnügen hat. Der künstlerische Ausdruck
aber muß gebildet werden und nicht gebildet sein.
Und das kann man im Theater „Die Gondel“ sehen.
Herwarth Walden
Aurel Bernäth
Bernäth ist derjenige unter den ungarischen Malern,
dessen Gestaltung ins Visionäre ragt. Wie er da-
bei die Erscheinungen der Natur in einer Flut von
samtschwarz und tiefblau umfangender nächtlicher
Dunkelheit und grün flackernden Irrlichtern auflöst
und nach der Höhe leitet, ist typisch magyarisch.
Dieser Drang aller Kreaturen nach einem Jenseits,
wo das Spiel oder der tragische Kampf ihrer Kräfte
ins Mythisch-Planetarische wächst, findet keine Ruhe
bei dem Gefühl des friedlich geschlossenen Daseins-
kreises von Tier- und Pflanzennatur. Bernäth bleibt
auch bei der Dämonie des Seelischen nicht stehen,
die aus dem Antlitz des einzelnen hervorstarrt. Er
gleitet nicht ins Traumhaft-Vergeisterte, beschwört
keine schreckhaft-wunder baren Erscheinungen. Seine
Vision ist eine Steigerung und Erweiterung des
Naturgebildes, als Bildes einer Macht, die uns