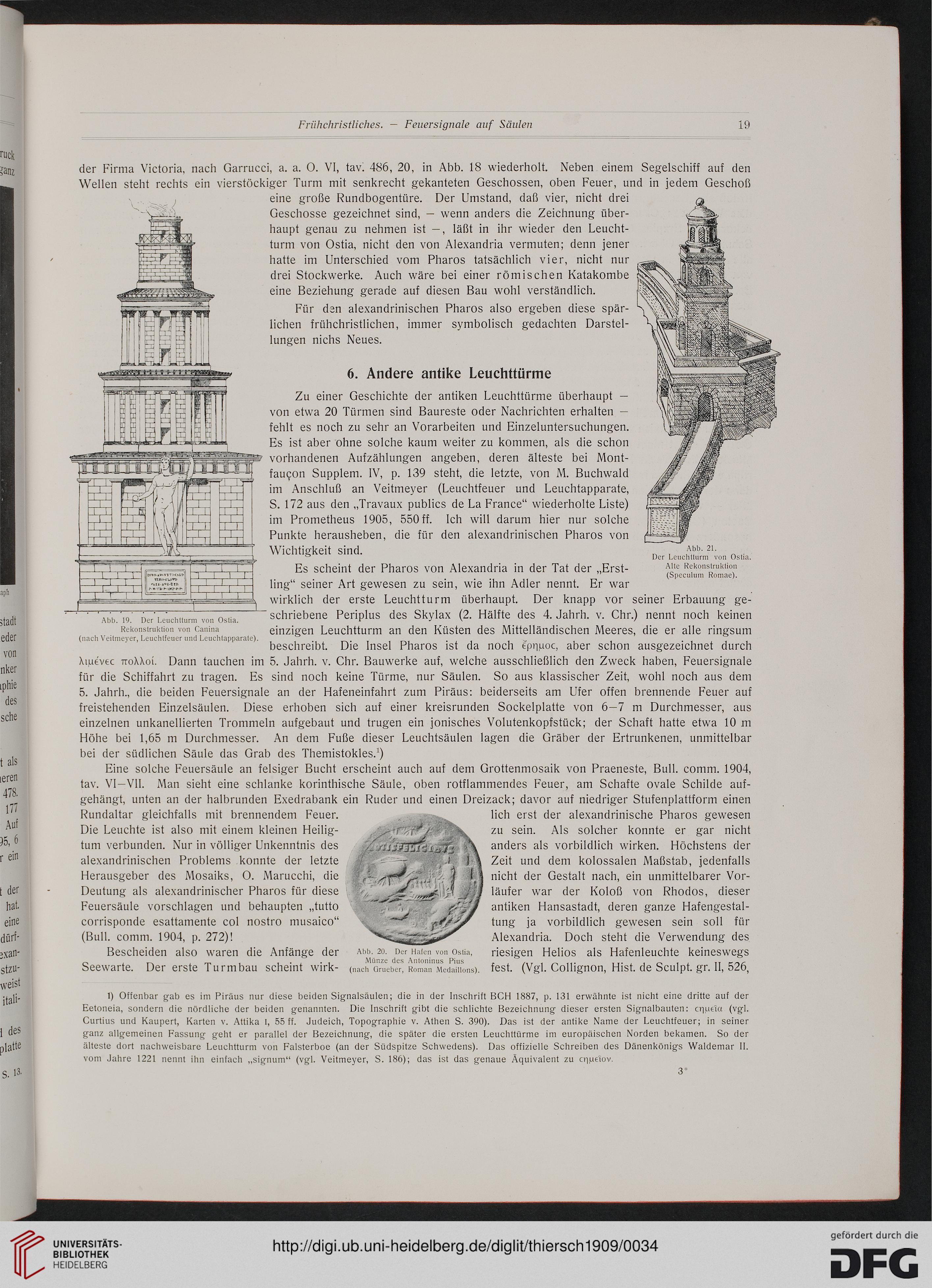Frühchristliches. — Feuersignale auf Säulen
19
der Firma Victoria, nach Garrucci, a. a. 0. VI, tavi 486, 20, in Abb. 18 wiederholt. Neben einem Segelschiff auf den
Wellen steht rechts ein vierstöckiger Turm mit senkrecht gekanteten Geschossen, oben Feuer, und in jedem Geschoß
eine große Rundbogentüre. Der Umstand, daß vier, nicht drei
Geschosse gezeichnet sind, — wenn anders die Zeichnung über-
haupt genau zu nehmen ist —, läßt in ihr wieder den Leucht-
turm von Ostia, nicht den von Alexandria vermuten; denn jener
hatte im Unterschied vom Pharos tatsächlich vier, nicht nur
drei Stockwerke. Auch wäre bei einer römischen Katakombe
eine Beziehung gerade auf diesen Bau wohl verständlich.
Für den alexandrinischen Pharos also ergeben diese spär-
lichen frühchristlichen, immer symbolisch gedachten Darstel-
lungen nichs Neues.
6. Andere antike Leuchttürme
Zu einer Geschichte der antiken Leuchttürme überhaupt —
von etwa 20 Türmen sind Baureste oder Nachrichten erhalten -
fehlt es noch zu sehr an Vorarbeiten und Einzeluntersuchungen.
Es ist aber ohne solche kaum weiter zu kommen, als die schon
vorhandenen Aufzählungen angeben, deren älteste bei Mont-
faucon Supplem. IV, p. 139 steht, die letzte, von M. Buchwald
im Anschluß an Veitmeyer (Leuchtfeuer und Leuchtapparate,
S. 172 aus den „Travaux publics de La France" wiederholte Liste)
im Prometheus 1905, 550 ff. Ich will darum hier nur solche
Punkte herausheben, die für den alexandrinischen Pharos von
Wichtigkeit sind.
Es scheint der Pharos von Alexandria in der Tat der „Erst-
ling" seiner Art gewesen zu sein, wie ihn Adler nennt. Er war
wirklich der erste Leuchtturm überhaupt. Der knapp vor seiner Erbauung ge-
schriebene Periplus des Skylax (2. Hälfte des 4. Jahrh. v. Chr.) nennt noch keinen
einzigen Leuchtturm an den Küsten des Mittelländischen Meeres, die er alle ringsum
beschreibt. Die Insel Pharos ist da noch eptiuoc, aber schon ausgezeichnet durch
Xiuevtc ttoXXoL Dann tauchen im 5. Jahrh. v. Chr. Bauwerke auf, welche ausschließlich den Zweck haben, Feuersignale
für die Schiffahrt zu tragen. Es sind noch keine Türme, nur Säulen. So aus klassischer Zeit, wohl noch aus dem
5. Jahrh., die beiden Feuersignale an der Hafeneinfahrt zum Piräus: beiderseits am Ufer offen brennende Feuer auf
freistehenden Einzelsäulen. Diese erhoben sich auf einer kreisrunden Sockelplatte von 6—7 m Durchmesser, aus
einzelnen unkanellierten Trommeln aufgebaut und trugen ein jonisches Volutenkopfstück; der Schaft hatte etwa 10 m
Höhe bei 1,65 m Durchmesser. An dem Fuße dieser Leuchtsäulen lagen die Gräber der Ertrunkenen, unmittelbar
bei der südlichen Säule das Grab des Themistokles.1)
Eine solche Feuersäule an felsiger Bucht erscheint auch auf dem Grottenmosaik von Praeneste, Bull. comm. 1904,
tav. VI—VII. Man sieht eine schlanke korinthische Säule, oben rotflammendes Feuer, am Schafte ovale Schilde auf-
gehängt, unten an der halbrunden Exedrabank ein Ruder und einen Dreizack; davor auf niedriger Stufenplattform einen
Abb. 21.
Der Leuchtturm von Ostia.
Alte Rekonstruktion
(Speculum Romae).
Abb. 19. Der Leuchtturm von Ostia.
Rekonstruktion von Canina
(nach Veitmeyer, Leuchtfeuer und Leuchtapparate).
Rundaltar gleichfalls mit brennendem Feuer.
Die Leuchte ist also mit einem kleinen Heilig-
tum verbunden. Nur in völliger Unkenntnis des
alexandrinischen Problems konnte der letzte
Herausgeber des Mosaiks, O. Marucchi, die
Deutung als alexandrinischer Pharos für diese
Feuersäule vorschlagen und behaupten „tutto
corrisponde esattamente col nostro musaico"
(Bull. comm. 1904, p. 272)!
Bescheiden also waren die Anfänge der
Seewarte. Der erste Turmbau scheint wirk-
Abb. 20. Der Hafen von Ostia,
Münze des Antoninus Pius
(nach Grueber, Roman Medaillons).
lieh erst der alexandrinische Pharos gewesen
zu sein. Als solcher konnte er gar nicht
anders als vorbildlich wirken. Höchstens der
Zeit und dem kolossalen Maßstab, jedenfalls
nicht der Gestalt nach, ein unmittelbarer Vor-
läufer war der Koloß von Rhodos, dieser
antiken Hansastadt, deren ganze Hafengestal-
tung ja vorbildlich gewesen sein soll für
Alexandria. Doch steht die Verwendung des
riesigen Helios als Hafenleuchte keineswegs
fest. (Vgl. Collignon, Hist. de Sculpt. gr. II, 526,
1) Offenbar gab es im Piräus nur diese beiden Signalsäulen; die in der Inschrift BCH 1887, p. 131 erwähnte ist nicht eine dritte auf der
Eetoneia, sondern die nördliche der beiden genannten. Die Inschrift gibt die schlichte Bezeichnung dieser ersten Signalbauten: ciintiu (vgl.
Curtius und Kaupert, Karten v. Attika [, 55 ff. Judeich, Topographie v. Athen S. 390). Das ist der antike Name der Leuchtfeuer; in seiner
ganz allgemeinen Fassung geht er parallel der Bezeichnung, die später die ersten Leuchttürme im europäischen Norden bekamen. So der
älteste dort nachweisbare Leuchtturm von Falsterboe (an der Südspitze Schwedens). Das offizielle Schreiben des Dänenkönigs Waldemar II.
vom Jahre 1221 nennt ihn einfach „Signum" (vgl. Veitmeyer, S. 186); das ist das genaue Äquivalent zu cn.utiov.
3'
19
der Firma Victoria, nach Garrucci, a. a. 0. VI, tavi 486, 20, in Abb. 18 wiederholt. Neben einem Segelschiff auf den
Wellen steht rechts ein vierstöckiger Turm mit senkrecht gekanteten Geschossen, oben Feuer, und in jedem Geschoß
eine große Rundbogentüre. Der Umstand, daß vier, nicht drei
Geschosse gezeichnet sind, — wenn anders die Zeichnung über-
haupt genau zu nehmen ist —, läßt in ihr wieder den Leucht-
turm von Ostia, nicht den von Alexandria vermuten; denn jener
hatte im Unterschied vom Pharos tatsächlich vier, nicht nur
drei Stockwerke. Auch wäre bei einer römischen Katakombe
eine Beziehung gerade auf diesen Bau wohl verständlich.
Für den alexandrinischen Pharos also ergeben diese spär-
lichen frühchristlichen, immer symbolisch gedachten Darstel-
lungen nichs Neues.
6. Andere antike Leuchttürme
Zu einer Geschichte der antiken Leuchttürme überhaupt —
von etwa 20 Türmen sind Baureste oder Nachrichten erhalten -
fehlt es noch zu sehr an Vorarbeiten und Einzeluntersuchungen.
Es ist aber ohne solche kaum weiter zu kommen, als die schon
vorhandenen Aufzählungen angeben, deren älteste bei Mont-
faucon Supplem. IV, p. 139 steht, die letzte, von M. Buchwald
im Anschluß an Veitmeyer (Leuchtfeuer und Leuchtapparate,
S. 172 aus den „Travaux publics de La France" wiederholte Liste)
im Prometheus 1905, 550 ff. Ich will darum hier nur solche
Punkte herausheben, die für den alexandrinischen Pharos von
Wichtigkeit sind.
Es scheint der Pharos von Alexandria in der Tat der „Erst-
ling" seiner Art gewesen zu sein, wie ihn Adler nennt. Er war
wirklich der erste Leuchtturm überhaupt. Der knapp vor seiner Erbauung ge-
schriebene Periplus des Skylax (2. Hälfte des 4. Jahrh. v. Chr.) nennt noch keinen
einzigen Leuchtturm an den Küsten des Mittelländischen Meeres, die er alle ringsum
beschreibt. Die Insel Pharos ist da noch eptiuoc, aber schon ausgezeichnet durch
Xiuevtc ttoXXoL Dann tauchen im 5. Jahrh. v. Chr. Bauwerke auf, welche ausschließlich den Zweck haben, Feuersignale
für die Schiffahrt zu tragen. Es sind noch keine Türme, nur Säulen. So aus klassischer Zeit, wohl noch aus dem
5. Jahrh., die beiden Feuersignale an der Hafeneinfahrt zum Piräus: beiderseits am Ufer offen brennende Feuer auf
freistehenden Einzelsäulen. Diese erhoben sich auf einer kreisrunden Sockelplatte von 6—7 m Durchmesser, aus
einzelnen unkanellierten Trommeln aufgebaut und trugen ein jonisches Volutenkopfstück; der Schaft hatte etwa 10 m
Höhe bei 1,65 m Durchmesser. An dem Fuße dieser Leuchtsäulen lagen die Gräber der Ertrunkenen, unmittelbar
bei der südlichen Säule das Grab des Themistokles.1)
Eine solche Feuersäule an felsiger Bucht erscheint auch auf dem Grottenmosaik von Praeneste, Bull. comm. 1904,
tav. VI—VII. Man sieht eine schlanke korinthische Säule, oben rotflammendes Feuer, am Schafte ovale Schilde auf-
gehängt, unten an der halbrunden Exedrabank ein Ruder und einen Dreizack; davor auf niedriger Stufenplattform einen
Abb. 21.
Der Leuchtturm von Ostia.
Alte Rekonstruktion
(Speculum Romae).
Abb. 19. Der Leuchtturm von Ostia.
Rekonstruktion von Canina
(nach Veitmeyer, Leuchtfeuer und Leuchtapparate).
Rundaltar gleichfalls mit brennendem Feuer.
Die Leuchte ist also mit einem kleinen Heilig-
tum verbunden. Nur in völliger Unkenntnis des
alexandrinischen Problems konnte der letzte
Herausgeber des Mosaiks, O. Marucchi, die
Deutung als alexandrinischer Pharos für diese
Feuersäule vorschlagen und behaupten „tutto
corrisponde esattamente col nostro musaico"
(Bull. comm. 1904, p. 272)!
Bescheiden also waren die Anfänge der
Seewarte. Der erste Turmbau scheint wirk-
Abb. 20. Der Hafen von Ostia,
Münze des Antoninus Pius
(nach Grueber, Roman Medaillons).
lieh erst der alexandrinische Pharos gewesen
zu sein. Als solcher konnte er gar nicht
anders als vorbildlich wirken. Höchstens der
Zeit und dem kolossalen Maßstab, jedenfalls
nicht der Gestalt nach, ein unmittelbarer Vor-
läufer war der Koloß von Rhodos, dieser
antiken Hansastadt, deren ganze Hafengestal-
tung ja vorbildlich gewesen sein soll für
Alexandria. Doch steht die Verwendung des
riesigen Helios als Hafenleuchte keineswegs
fest. (Vgl. Collignon, Hist. de Sculpt. gr. II, 526,
1) Offenbar gab es im Piräus nur diese beiden Signalsäulen; die in der Inschrift BCH 1887, p. 131 erwähnte ist nicht eine dritte auf der
Eetoneia, sondern die nördliche der beiden genannten. Die Inschrift gibt die schlichte Bezeichnung dieser ersten Signalbauten: ciintiu (vgl.
Curtius und Kaupert, Karten v. Attika [, 55 ff. Judeich, Topographie v. Athen S. 390). Das ist der antike Name der Leuchtfeuer; in seiner
ganz allgemeinen Fassung geht er parallel der Bezeichnung, die später die ersten Leuchttürme im europäischen Norden bekamen. So der
älteste dort nachweisbare Leuchtturm von Falsterboe (an der Südspitze Schwedens). Das offizielle Schreiben des Dänenkönigs Waldemar II.
vom Jahre 1221 nennt ihn einfach „Signum" (vgl. Veitmeyer, S. 186); das ist das genaue Äquivalent zu cn.utiov.
3'