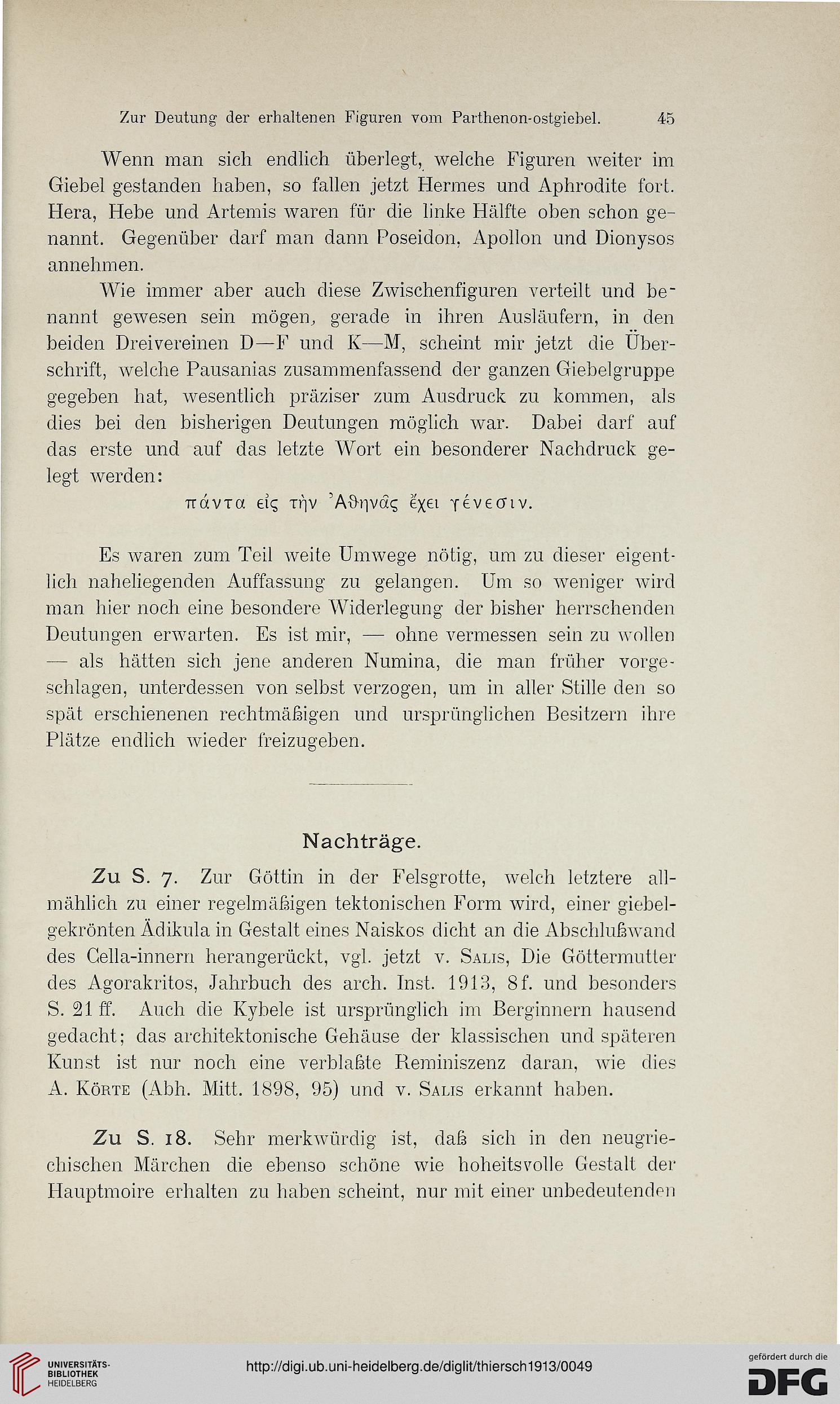Zur Deutung der erhaltenen Figuren vom Parthenon-ostgiebel.
45
Wenn man sich endlich überlegt, welche Figuren weiter im
Giebel gestanden haben, so fallen jetzt Hermes und Aphrodite fort.
Hera, Hebe und Artemis waren für die linke Hälfte oben schon ge-
nannt. Gegenüber darf man dann Poseidon, Apollon und Dionysos
annehmen.
Wie immer aber auch diese Zwischenfiguren verteilt und be-
nannt gewesen sein mögen, gerade in ihren Ausläufern, in den
beiden Dreivereinen D—F und K—M, scheint mir jetzt die Uber-
schrift, welche Pausanias zusammenfassend der ganzen Giebelgruppe
gegeben hat, wesentlich präziser zum Ausdruck zu kommen, als
dies bei den bisherigen Deutungen möglich war. Dabei darf auf
das erste und auf das letzte Wort ein besonderer Nachdruck ge-
legt werden:
irdvTa elq Tr\v 'Aönväc; exei 'feveöw.
Es waren zum Teil weite Umwege nötig, um zu dieser eigent-
lich naheliegenden Auffassung zu gelangen. Um so weniger wird
man hier noch eine besondere Widerlegung der bisher herrschenden
Deutungen erwarten. Es ist mir, — ohne vermessen sein zu wollen
— als hätten sich jene anderen Numina, die man früher vorge-
schlagen, unterdessen von selbst verzogen, um in aller Stille den so
spät erschienenen rechtmäßigen und ursprünglichen Besitzern ihre
Plätze endlich wieder freizugeben.
Nachträge.
Zu S. 7. Zur Göttin in der Felsgrotte, welch letztere all-
mählich zu einer regelmäßigen tektonischen Form wird, einer giebel-
gekrönten Ädikula in Gestalt eines Naiskos dicht an die Abschlußwand
des Gella-innern herangerückt, vgl. jetzt v. Salis, Die Göttermutter
des Agorakritos, Jahrbuch des arch. Inst. 1913, 8 f. und besonders
S. 21 ff. Auch die Kybele ist ursprünglich im Berginnern hausend
gedacht; das architektonische Gehäuse der klassischen und späteren
Kunst ist nur noch eine verblaßte Reminiszenz daran, wie dies
A. Körte (Abh. Mitt. 1898, 95) und v. Salis erkannt haben.
Zu S. 18. Sehr merkwürdig ist, daß sich in den neugrie-
chischen Märchen die ebenso schöne wie hoheitsvolle Gestalt der
Hauptmoire erhalten zu haben scheint, nur mit einer unbedeutenden
45
Wenn man sich endlich überlegt, welche Figuren weiter im
Giebel gestanden haben, so fallen jetzt Hermes und Aphrodite fort.
Hera, Hebe und Artemis waren für die linke Hälfte oben schon ge-
nannt. Gegenüber darf man dann Poseidon, Apollon und Dionysos
annehmen.
Wie immer aber auch diese Zwischenfiguren verteilt und be-
nannt gewesen sein mögen, gerade in ihren Ausläufern, in den
beiden Dreivereinen D—F und K—M, scheint mir jetzt die Uber-
schrift, welche Pausanias zusammenfassend der ganzen Giebelgruppe
gegeben hat, wesentlich präziser zum Ausdruck zu kommen, als
dies bei den bisherigen Deutungen möglich war. Dabei darf auf
das erste und auf das letzte Wort ein besonderer Nachdruck ge-
legt werden:
irdvTa elq Tr\v 'Aönväc; exei 'feveöw.
Es waren zum Teil weite Umwege nötig, um zu dieser eigent-
lich naheliegenden Auffassung zu gelangen. Um so weniger wird
man hier noch eine besondere Widerlegung der bisher herrschenden
Deutungen erwarten. Es ist mir, — ohne vermessen sein zu wollen
— als hätten sich jene anderen Numina, die man früher vorge-
schlagen, unterdessen von selbst verzogen, um in aller Stille den so
spät erschienenen rechtmäßigen und ursprünglichen Besitzern ihre
Plätze endlich wieder freizugeben.
Nachträge.
Zu S. 7. Zur Göttin in der Felsgrotte, welch letztere all-
mählich zu einer regelmäßigen tektonischen Form wird, einer giebel-
gekrönten Ädikula in Gestalt eines Naiskos dicht an die Abschlußwand
des Gella-innern herangerückt, vgl. jetzt v. Salis, Die Göttermutter
des Agorakritos, Jahrbuch des arch. Inst. 1913, 8 f. und besonders
S. 21 ff. Auch die Kybele ist ursprünglich im Berginnern hausend
gedacht; das architektonische Gehäuse der klassischen und späteren
Kunst ist nur noch eine verblaßte Reminiszenz daran, wie dies
A. Körte (Abh. Mitt. 1898, 95) und v. Salis erkannt haben.
Zu S. 18. Sehr merkwürdig ist, daß sich in den neugrie-
chischen Märchen die ebenso schöne wie hoheitsvolle Gestalt der
Hauptmoire erhalten zu haben scheint, nur mit einer unbedeutenden