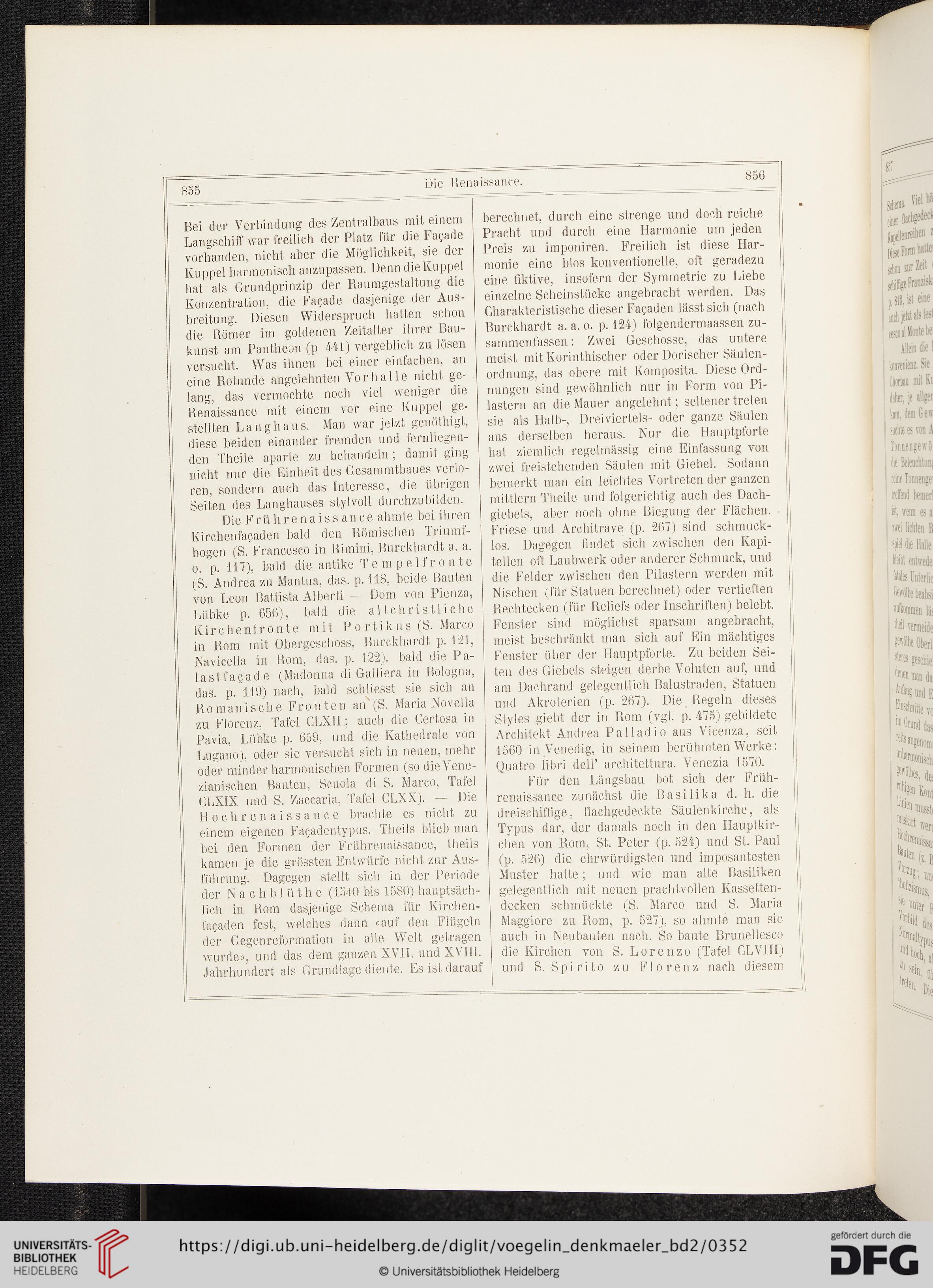855
Die Renaissance.
856
Bei der Verbindung des Zentralbaus mit einem
Langschiff war freilich der Platz für die Fagade
vorhanden, nicht aber die Möglichkeit, sie der
Kuppel harmonisch anzupassen. Denn die Kuppel
hat als Grundprinzip der Raumgestaltung die
Konzentration, die Fa^ade dasjenige der Aus-
breitung. Diesen Widerspruch hatten schon
die Römer im goldenen Zeitalter ihrer Bau-
kunst am Pantheon (p 441) vergeblich zu lösen
versucht. Was ihnen bei einer einfachen, an
eine Rotunde angelehnten Vor ha 1 le nicht ge-
lang, das vermochte noch viel weniger die
Renaissance mit einem vor eine Kuppel ge-
stellten Langhaus. Man war jetzt genöthigt,
diese beiden einander fremden und fernliegen-
den Theile aparte zu behandeln; damit ging
nicht nur die Einheit des Gesammtbaues verlo-
ren, sondern auch das Interesse, die übrigen
Seiten des Langhauses styl voll durchzubilden.
Die Frührenaissance ahmte bei ihren
Kirchenfagaden bald den Römischen Triumf-
bogen (S. Francesco in Rimini, Burckhardt a. a.
o. p. 117), bald die antike Tempelfronte
(S. Andrea zu Mantua, das. p. 118, beide Bauten
von Leon Battista Alberti — Dom von Pienza,
Lübke p. 656), bald die altchristliche
Kirchenlronte mit Portikus (S. Marco
in Rom mit Obergeschoss, Burckhardt p. 121,
Navicella in Rom, das. p. 122). bald die Pa-
lastfa^ade (Madonna di Galliera in Bologna,
das. p. 119) nach, bald schliesst sie sich an
Romanische Fronten ai?(S. Maria Novella
zu Florenz, Tafel CLX1I: auch die Certosa in
Pavia, Lübke p. 659, und die Kathedrale von
Lugano), oder sie versucht sich in neuen, mehr
oder minder harmonischen Formen (so die Vene-
zianischen Bauten, Scuola di S. Marco, Tafel
GLXIX und S. Zaccaria, Tafel CLXX). — Die
Hochrenaissance brachte es nicht zu
einem eigenen Fa^adentypus. Theils blieb man
bei den Formen der Frührenaissance, theils
kamen je die grössten Entwürfe nicht zur Aus-
führung. Dagegen stellt sich in der Periode
der Nachblüthe (1540 bis 1580) hauptsäch-
lich in Rom dasjenige Schema für Kirchen-
läQaden fest, welches dann «auf den Flügeln
der Gegenreformation in alle Welt getragen
wurde», und das dem ganzen XVII. und XVIII.
Jahrhundert als Grundlage diente. Es ist darauf
berechnet, durch eine strenge und doch reiche
Pracht und durch eine Harmonie um jeden
Preis zu imponiren. Freilich ist diese Har-
monie eine blos konventionelle, oft geradezu
eine fiktive, insofern der Symmetrie zu Liebe
einzelne Scheinstücke angebracht werden. Das
Charakteristische dieser Fanden lässt sich (nach
Burckhardt a. a. o. p. 124) folgendermaassen zu-
sammenfassen: Zwei Geschosse, das untere
meist mit Korinthischer oder Dorischer Säulen-
ordnung, das obere mit Komposita. Diese Ord-
nungen sind gewöhnlich nur in Form von Pi-
lastern an die Mauer angelehnt; seltener treten
sie als Halb-, Drei Viertels- oder ganze Säulen
aus derselben heraus. Nur die Hauptpforte
hat ziemlich regelmässig eine Einfassung von
zwei freistehenden Säulen mit Giebel. Sodann
bemerkt man ein leichtes Vortreten der ganzen
mittlern Theile und folgerichtig auch des Dach-
giebels, aber noch ohne Biegung der Flächen.
Friese und Architrave (p. 267) sind schmuck-
los. Dagegen findet sich zwischen den Kapi-
tellen oft Laubwerk oder anderer Schmuck, und
die Felder zwischen den Pilastern werden mit
Nischen (für Statuen berechnet) oder vertieften
Rechtecken (für Reliefs oder Inschriften) belebt.
Fenster sind möglichst sparsam angebracht,
meist beschränkt man sich auf Ein mächtiges
Fenster über der Hauptpforte. Zu beiden Sei-
ten des Giebels steigen derbe Voluten auf, und
am Dachrand gelegentlich Balustraden, Statuen
und Akroterien (p. 267). Die Regeln dieses
Styles giebt der in Rom (vgk p. 475) gebildete
Architekt Andrea Pa 11 ad io aus Vicenza, seit
1560 in Venedig, in seinem berühmten Werke:
Quatro libri dell’ architettura. Venezia 1570.
Für den Längsbau bot sich der Früh-
renaissance zunächst die Basilika d. h. die
dreischiffige, flachgedeckte Säulenkirche, als
Typus dar, der damals noch in den Hauptkir-
chen von Ronij St. Peter (p. 524) und St. Paul
(p. 526) die ehrwürdigsten und imposantesten
Muster hatte; und wie man alte Basiliken
gelegentlich mit neuen prachtvollen Kassetten-
decken schmückte (S. Marco und S. Maria
Maggiore zu Rom, p. 527), so ahmte man sie
auch in Neubauten nach. So baute Brunellesco
die Kirchen von S. Lorenzo (Tafel GLVIII)
und S. Spirito zu Florenz nach diesem
Die Renaissance.
856
Bei der Verbindung des Zentralbaus mit einem
Langschiff war freilich der Platz für die Fagade
vorhanden, nicht aber die Möglichkeit, sie der
Kuppel harmonisch anzupassen. Denn die Kuppel
hat als Grundprinzip der Raumgestaltung die
Konzentration, die Fa^ade dasjenige der Aus-
breitung. Diesen Widerspruch hatten schon
die Römer im goldenen Zeitalter ihrer Bau-
kunst am Pantheon (p 441) vergeblich zu lösen
versucht. Was ihnen bei einer einfachen, an
eine Rotunde angelehnten Vor ha 1 le nicht ge-
lang, das vermochte noch viel weniger die
Renaissance mit einem vor eine Kuppel ge-
stellten Langhaus. Man war jetzt genöthigt,
diese beiden einander fremden und fernliegen-
den Theile aparte zu behandeln; damit ging
nicht nur die Einheit des Gesammtbaues verlo-
ren, sondern auch das Interesse, die übrigen
Seiten des Langhauses styl voll durchzubilden.
Die Frührenaissance ahmte bei ihren
Kirchenfagaden bald den Römischen Triumf-
bogen (S. Francesco in Rimini, Burckhardt a. a.
o. p. 117), bald die antike Tempelfronte
(S. Andrea zu Mantua, das. p. 118, beide Bauten
von Leon Battista Alberti — Dom von Pienza,
Lübke p. 656), bald die altchristliche
Kirchenlronte mit Portikus (S. Marco
in Rom mit Obergeschoss, Burckhardt p. 121,
Navicella in Rom, das. p. 122). bald die Pa-
lastfa^ade (Madonna di Galliera in Bologna,
das. p. 119) nach, bald schliesst sie sich an
Romanische Fronten ai?(S. Maria Novella
zu Florenz, Tafel CLX1I: auch die Certosa in
Pavia, Lübke p. 659, und die Kathedrale von
Lugano), oder sie versucht sich in neuen, mehr
oder minder harmonischen Formen (so die Vene-
zianischen Bauten, Scuola di S. Marco, Tafel
GLXIX und S. Zaccaria, Tafel CLXX). — Die
Hochrenaissance brachte es nicht zu
einem eigenen Fa^adentypus. Theils blieb man
bei den Formen der Frührenaissance, theils
kamen je die grössten Entwürfe nicht zur Aus-
führung. Dagegen stellt sich in der Periode
der Nachblüthe (1540 bis 1580) hauptsäch-
lich in Rom dasjenige Schema für Kirchen-
läQaden fest, welches dann «auf den Flügeln
der Gegenreformation in alle Welt getragen
wurde», und das dem ganzen XVII. und XVIII.
Jahrhundert als Grundlage diente. Es ist darauf
berechnet, durch eine strenge und doch reiche
Pracht und durch eine Harmonie um jeden
Preis zu imponiren. Freilich ist diese Har-
monie eine blos konventionelle, oft geradezu
eine fiktive, insofern der Symmetrie zu Liebe
einzelne Scheinstücke angebracht werden. Das
Charakteristische dieser Fanden lässt sich (nach
Burckhardt a. a. o. p. 124) folgendermaassen zu-
sammenfassen: Zwei Geschosse, das untere
meist mit Korinthischer oder Dorischer Säulen-
ordnung, das obere mit Komposita. Diese Ord-
nungen sind gewöhnlich nur in Form von Pi-
lastern an die Mauer angelehnt; seltener treten
sie als Halb-, Drei Viertels- oder ganze Säulen
aus derselben heraus. Nur die Hauptpforte
hat ziemlich regelmässig eine Einfassung von
zwei freistehenden Säulen mit Giebel. Sodann
bemerkt man ein leichtes Vortreten der ganzen
mittlern Theile und folgerichtig auch des Dach-
giebels, aber noch ohne Biegung der Flächen.
Friese und Architrave (p. 267) sind schmuck-
los. Dagegen findet sich zwischen den Kapi-
tellen oft Laubwerk oder anderer Schmuck, und
die Felder zwischen den Pilastern werden mit
Nischen (für Statuen berechnet) oder vertieften
Rechtecken (für Reliefs oder Inschriften) belebt.
Fenster sind möglichst sparsam angebracht,
meist beschränkt man sich auf Ein mächtiges
Fenster über der Hauptpforte. Zu beiden Sei-
ten des Giebels steigen derbe Voluten auf, und
am Dachrand gelegentlich Balustraden, Statuen
und Akroterien (p. 267). Die Regeln dieses
Styles giebt der in Rom (vgk p. 475) gebildete
Architekt Andrea Pa 11 ad io aus Vicenza, seit
1560 in Venedig, in seinem berühmten Werke:
Quatro libri dell’ architettura. Venezia 1570.
Für den Längsbau bot sich der Früh-
renaissance zunächst die Basilika d. h. die
dreischiffige, flachgedeckte Säulenkirche, als
Typus dar, der damals noch in den Hauptkir-
chen von Ronij St. Peter (p. 524) und St. Paul
(p. 526) die ehrwürdigsten und imposantesten
Muster hatte; und wie man alte Basiliken
gelegentlich mit neuen prachtvollen Kassetten-
decken schmückte (S. Marco und S. Maria
Maggiore zu Rom, p. 527), so ahmte man sie
auch in Neubauten nach. So baute Brunellesco
die Kirchen von S. Lorenzo (Tafel GLVIII)
und S. Spirito zu Florenz nach diesem