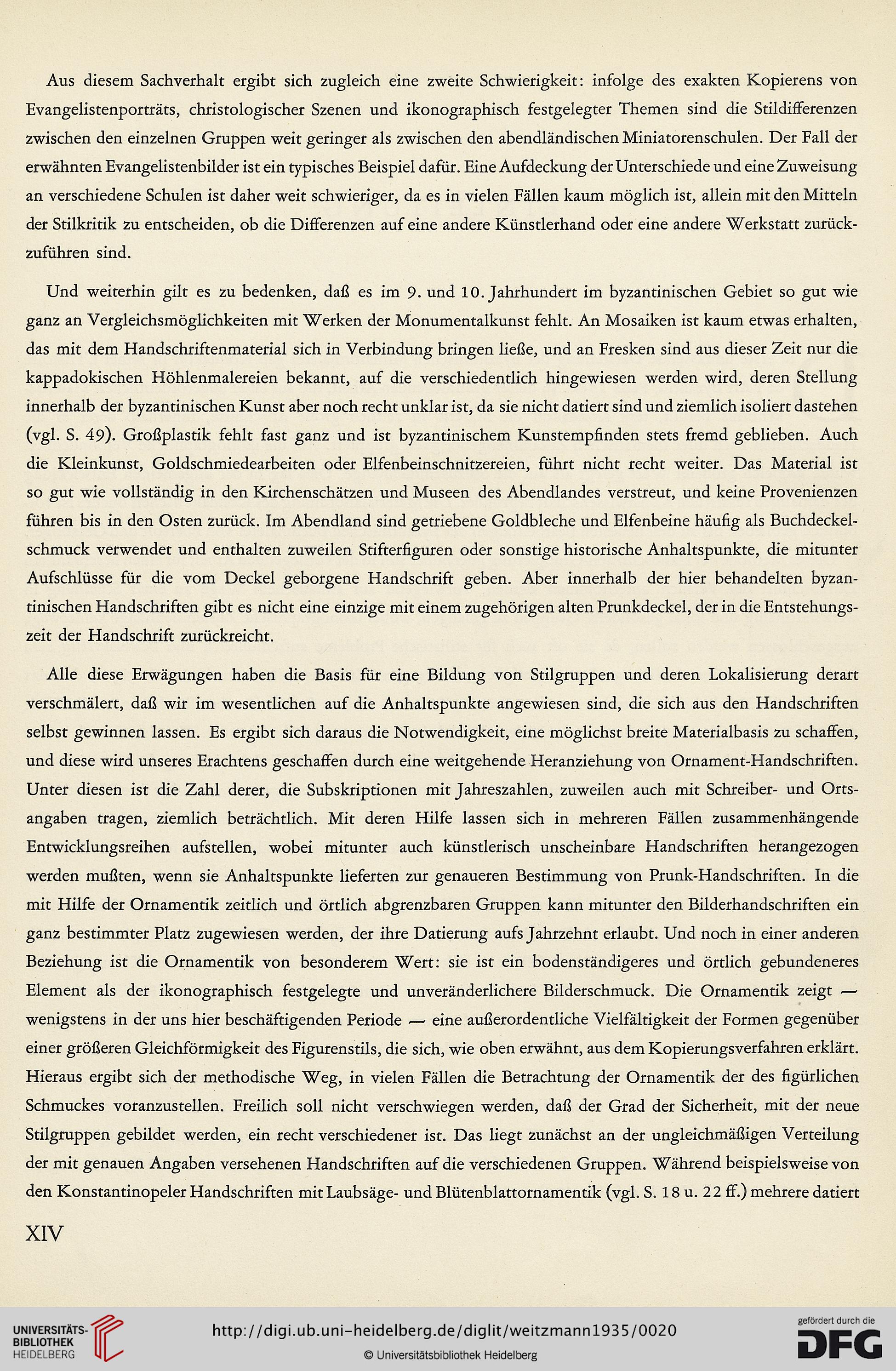Aus diesem Sachverhalt ergibt sich zugleich eine zweite Schwierigkeit: infolge des exakten Kopierens von
Evangelistenporträts, christologischer Szenen und ikonographisch festgelegter Themen sind die Stildifferenzen
zwischen den einzelnen Gruppen weit geringer als zwischen den abendländischen Miniatorenschulen. Der Fall der
erwähnten Evangelistenbilder ist ein typisches Beispiel dafür. Eine Auldeckung der Unterschiede und eine Zuweisung
an verschiedene Schulen ist daher weit schwieriger, da es in vielen Fällen kaum möglich ist, allein mit den Mitteln
der Stilkritik zu entscheiden, ob die Differenzen auf eine andere Künstlerhand oder eine andere Werkstatt zurück-
zuführen sind.
Und weiterhin gilt es zu bedenken, daß es im 9. und 10. Jahrhundert im byzantinischen Gebiet so gut wie
ganz an Vergleichsmöglichkeiten mit Werken der Monumentalkunst fehlt. An Mosaiken ist kaum etwas erhalten,
das mit dem Handschriftenmaterial sich in Verbindung bringen ließe, und an Fresken sind aus dieser Zeit nur die
kappadokischen Höhlenmalereien bekannt, auf die verschiedentlich hingewiesen werden wird, deren Stellung
innerhalb der byzantinischen Kunst aber noch recht unklar ist, da sie nicht datiert sind und ziemlich isoliert dastehen
(vgl. S. 4$). Großplastik fehlt fast ganz und ist byzantinischem Kunstempfinden stets fremd geblieben. Auch
die Kleinkunst, Goldschmiedearbeiten oder Elfenbeinschnitzereien, führt nicht recht weiter. Das Material ist
so gut wie vollständig in den Kirchenschätzen und Museen des Abendlandes verstreut, und keine Provenienzen
fuhren bis in den Osten zurück. Im Abendland sind getriebene Goldbleche und Elfenbeine häufig als Buchdeckel-
schmuck verwendet und enthalten zuweilen Stifterfiguren oder sonstige historische Anhaltspunkte, die mitunter
Aufschlüsse für die vom Deckel geborgene Handschrift geben. Aber innerhalb der hier behandelten byzan-
tinischen Handschriften gibt es nicht eine einzige mit einem zugehörigen alten Prunkdeckel, der in die Entstehungs-
zeit der Handschrift zurückreicht.
Alle diese Erwägungen haben die Basis für eine Bildung von Stilgruppen und deren Lokalisierung derart
verschmälert, daß wir im wesentlichen auf die Anhaltspunkte angewiesen sind, die sich aus den Handschriften
selbst gewinnen lassen. Es ergibt sich daraus die Notwendigkeit, eine möglichst breite Materialbasis zu schaffen,
und diese wird unseres Erachtens geschaffen durch eine weitgehende Heranziehung von Ornament-Handschriften.
Unter diesen ist die Zahl derer, die Subskriptionen mit Jahreszahlen, zuweilen auch mit Schreiber- und Orts-
angaben tragen, ziemlich beträchtlich. Mit deren Hilfe lassen sich in mehreren Fällen zusammenhängende
Entwicklungsreihen aufstellen, wobei mitunter auch künstlerisch unscheinbare Handschriften herangezogen
werden mußten, wenn sie Anhaltspunkte lieferten zur genaueren Bestimmung von Prunk-Handschriften. In die
mit Hilfe der Ornamentik zeitlich und örtlich abgrenzbaren Gruppen kann mitunter den Bilderhandschriften ein
ganz bestimmter Platz zugewiesen werden, der ihre Datierung aufs Jahrzehnt erlaubt. Und noch in einer anderen
Beziehung ist die Ornamentik von besonderem Wert: sie ist ein bodenständigeres und örtlich gebundeneres
Element als der ikonographisch festgelegte und unveränderlichere Bilderschmuck. Die Ornamentik zeigt —
wenigstens in der uns hier beschäftigenden Periode — eine außerordentliche Vielfältigkeit der Formen gegenüber
einer größeren Gleichförmigkeit des Figurenstils, die sich, wie oben erwähnt, aus dem Kopierungsverfahren erklärt.
Hieraus ergibt sich der methodische Weg, in vielen Fällen die Betrachtung der Ornamentik der des figürlichen
Schmuckes voranzustellen. Freilich soll nicht verschwiegen werden, daß der Grad der Sicherheit, mit der neue
Stilgruppen gebildet werden, ein recht verschiedener ist. Das liegt zunächst an der ungleichmäßigen Verteilung
der mit genauen Angaben versehenen Handschriften auf die verschiedenen Gruppen. Während beispielsweise von
den Konstantinopeler Handschriften mit Laubsäge- und Blütenblattornamentik (vgl. S. 18 u. 2 2 ff.) mehrere datiert
XIV
Evangelistenporträts, christologischer Szenen und ikonographisch festgelegter Themen sind die Stildifferenzen
zwischen den einzelnen Gruppen weit geringer als zwischen den abendländischen Miniatorenschulen. Der Fall der
erwähnten Evangelistenbilder ist ein typisches Beispiel dafür. Eine Auldeckung der Unterschiede und eine Zuweisung
an verschiedene Schulen ist daher weit schwieriger, da es in vielen Fällen kaum möglich ist, allein mit den Mitteln
der Stilkritik zu entscheiden, ob die Differenzen auf eine andere Künstlerhand oder eine andere Werkstatt zurück-
zuführen sind.
Und weiterhin gilt es zu bedenken, daß es im 9. und 10. Jahrhundert im byzantinischen Gebiet so gut wie
ganz an Vergleichsmöglichkeiten mit Werken der Monumentalkunst fehlt. An Mosaiken ist kaum etwas erhalten,
das mit dem Handschriftenmaterial sich in Verbindung bringen ließe, und an Fresken sind aus dieser Zeit nur die
kappadokischen Höhlenmalereien bekannt, auf die verschiedentlich hingewiesen werden wird, deren Stellung
innerhalb der byzantinischen Kunst aber noch recht unklar ist, da sie nicht datiert sind und ziemlich isoliert dastehen
(vgl. S. 4$). Großplastik fehlt fast ganz und ist byzantinischem Kunstempfinden stets fremd geblieben. Auch
die Kleinkunst, Goldschmiedearbeiten oder Elfenbeinschnitzereien, führt nicht recht weiter. Das Material ist
so gut wie vollständig in den Kirchenschätzen und Museen des Abendlandes verstreut, und keine Provenienzen
fuhren bis in den Osten zurück. Im Abendland sind getriebene Goldbleche und Elfenbeine häufig als Buchdeckel-
schmuck verwendet und enthalten zuweilen Stifterfiguren oder sonstige historische Anhaltspunkte, die mitunter
Aufschlüsse für die vom Deckel geborgene Handschrift geben. Aber innerhalb der hier behandelten byzan-
tinischen Handschriften gibt es nicht eine einzige mit einem zugehörigen alten Prunkdeckel, der in die Entstehungs-
zeit der Handschrift zurückreicht.
Alle diese Erwägungen haben die Basis für eine Bildung von Stilgruppen und deren Lokalisierung derart
verschmälert, daß wir im wesentlichen auf die Anhaltspunkte angewiesen sind, die sich aus den Handschriften
selbst gewinnen lassen. Es ergibt sich daraus die Notwendigkeit, eine möglichst breite Materialbasis zu schaffen,
und diese wird unseres Erachtens geschaffen durch eine weitgehende Heranziehung von Ornament-Handschriften.
Unter diesen ist die Zahl derer, die Subskriptionen mit Jahreszahlen, zuweilen auch mit Schreiber- und Orts-
angaben tragen, ziemlich beträchtlich. Mit deren Hilfe lassen sich in mehreren Fällen zusammenhängende
Entwicklungsreihen aufstellen, wobei mitunter auch künstlerisch unscheinbare Handschriften herangezogen
werden mußten, wenn sie Anhaltspunkte lieferten zur genaueren Bestimmung von Prunk-Handschriften. In die
mit Hilfe der Ornamentik zeitlich und örtlich abgrenzbaren Gruppen kann mitunter den Bilderhandschriften ein
ganz bestimmter Platz zugewiesen werden, der ihre Datierung aufs Jahrzehnt erlaubt. Und noch in einer anderen
Beziehung ist die Ornamentik von besonderem Wert: sie ist ein bodenständigeres und örtlich gebundeneres
Element als der ikonographisch festgelegte und unveränderlichere Bilderschmuck. Die Ornamentik zeigt —
wenigstens in der uns hier beschäftigenden Periode — eine außerordentliche Vielfältigkeit der Formen gegenüber
einer größeren Gleichförmigkeit des Figurenstils, die sich, wie oben erwähnt, aus dem Kopierungsverfahren erklärt.
Hieraus ergibt sich der methodische Weg, in vielen Fällen die Betrachtung der Ornamentik der des figürlichen
Schmuckes voranzustellen. Freilich soll nicht verschwiegen werden, daß der Grad der Sicherheit, mit der neue
Stilgruppen gebildet werden, ein recht verschiedener ist. Das liegt zunächst an der ungleichmäßigen Verteilung
der mit genauen Angaben versehenen Handschriften auf die verschiedenen Gruppen. Während beispielsweise von
den Konstantinopeler Handschriften mit Laubsäge- und Blütenblattornamentik (vgl. S. 18 u. 2 2 ff.) mehrere datiert
XIV