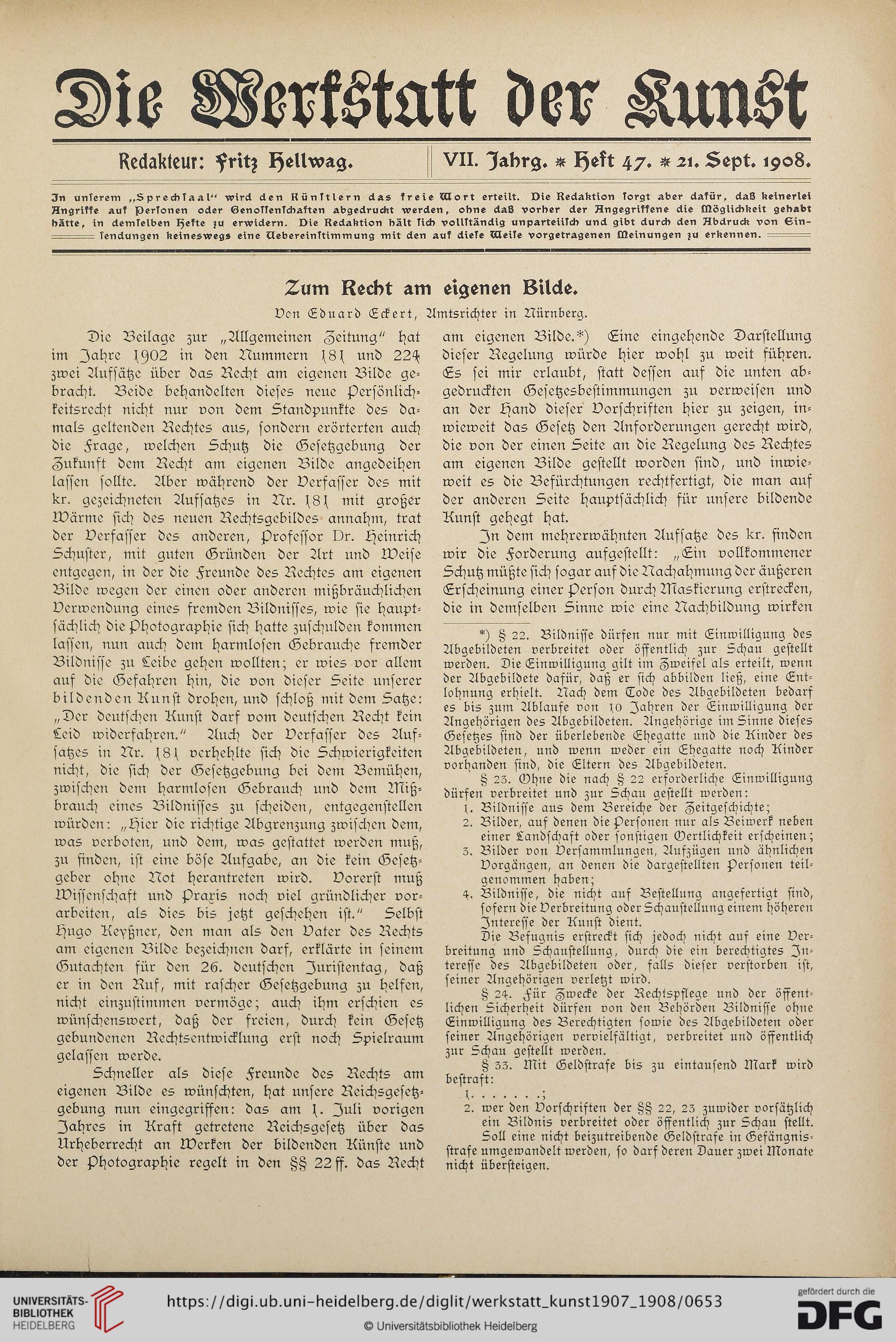Die Werkstatt der Mußt
keäakleur: HeNnag.
VII. Jakrg. Hekt 4^. 21. Sept. 1908.
In unserem „Sprecktaat" xvircl clen ttünsrsern ctas freie Mort erteilt. Vie Recisktion sorgt aber Lasur, Lag keinerlei
Angriffe aus Personen ocler SenoNentLiaslsn abgeäruckt ^verclen, okn« claS vorder cier ^ngegrissene clie MögULiksit geksbt
käne, in clernselben IZests ;u eriviclern. Vie klectaktion kält lick vollltanclig unpartsiisck unci gibt äurck clen )Ibciruck von 6in-
. senclungen keinestveg» eins Nebsreinstirnrnung rnit clen aus cliese Meile vorgetragsnen Meinungen zu erkennen. —
Tum Ksckt am eigenen Vilcle.
Von Eduard Eckert, Amtsrichter in Nürnberg.
Die Beilage zur „Allgemeinen Zeitung" hat
im Zahre Ifi02 den Nummern H8s und 22^
zwei 2lufsätze über das Recht am eigenen Bilde ge-
bracht. Beide behandelten dieses neue persönlich-
keitsrecht nicht nur von dem Standpunkte des da-
mals geltenden Rechtes aus, sondern erörterten auch
die Frage, welchen Schutz die Gesetzgebung der
Zukunst dem Recht am eigenen Bilde angedeihen
lassen sollte. Aber während der Verfasser des mit
ler. gezeichneten Aufsatzes in Nr. H8s mit großer
TVärme sich des neuen Rechtsgebildes annahm, trat
der Verfasser des anderen, Professor Or. Heinrich
Schuster, mit guten Gründen der Art und Weise
entgegen, in der die Freunde des Rechtes am eigenen
Bilde wegen der einen oder anderen mißbräuchlichen
Verwendung eines fremden Bildnisses, wie sie haupt-
sächlich die Photographie sich hatte zuschulden kommen
lassen, nun auch dem harmlosen Gebrauche fremder
Bildnisse zu Leibe gehen wollten; er wies vor allem
auf die Gefahren hin, die von dieser Seite unserer
bildenden Kunst drohen, und schloß mit dem Satze:
„Der deutschen Kunst darf vom deutschen Recht kein
Leid widerfahren." Auch der Verfasser des Auf-
satzes in Nr. H8s verhehlte sich die Schwierigkeiten
nicht, die sich der Gesetzgebung bei dem Bemühen,
zwischen dem harmlosen Gebrauch und dem Witz-
brauch eines Bildnisses zu scheiden, entgegenstellen
würden: „Hier die richtige Abgrenzung zwischen dem,
was verboten, und dem, was gestattet werden muß,
zu finden, ist eine böse Aufgabe, an die kein Gesetz-
geber ohne Not herantreten wird. Vorerst muß
Wissenschaft und Praxis noch viel gründlicher vor-
arbeiten, als dies bis jetzt geschehen ist." Selbst
Hugo Keyßner, den man als den Vater des Rechts
am eigenen Bilde bezeichnen darf, erklärte in seinem
Gutachten für den 26. deutschen Zuristentag, daß
er in den Ruf, mit rascher Gesetzgebung zu helfen,
nicht einzustimmen vermöge; auch ihm erschien es
wünschenswert, daß der freien, durch kein Gesetz
gebundenen Rechtsentwicklung erst noch Spielraum
gelassen werde.
Schneller als diese Freunde des Rechts am
eigenen Bilde es wünschten, hat unsere Reichsgesetz-
gebung nun eingegriffen: das am s. Zuli vorigen
Zahrcs in Kraft getretene Reichsgesetz über das
Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und
der Photographie regelt in den ZA 22 ff. das Recht
am eigenen Bilde.*) (Line eingehende Darstellung
dieser Regelung würde hier wohl zu weit führen.
Ls sei mir erlaubt, statt dessen auf die unten ab-
gedruckten Gesetzesbestimmungen zu verweisen und
an der Hand dieser Vorschriften hier zu zeigen, in-
wieweit das Gesetz den Anforderungen gerecht wird,
die von der einen Seite an die Regelung des Rechtes
am eigenen Bilde gestellt worden sind, und inwie-
weit es die Befürchtungen rechtfertigt, die man auf
der anderen Seite hauptsächlich für unsere bildende
Kunst gehegt hat.
Zn dem mehrerwähnten Aufsatze des lcr. finden
wir die Forderung aufgestellt: „Lin vollkommener
Schutz müßte sich sogar auf die Nachahmung der äußeren
Erscheinung einer Person durch Maskierung erstrecken,
die in demselben Sinne wie eine Nachbildung wirken
ch K 22. Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des
Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt
werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn
der Abgebildete dafür, daß er sich abbilden ließ, eine Ent-
lohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf
es bis zum Ablaufe von ;o Zähren der Einwilligung der
Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses
Gesetzes sind der überlebende Ehegatte und die Kinder des
Abgebildeten, und wenn weder ein Ehegatte noch Kinder
vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.
K 23. Ohne die nach K 22 erforderliche Einwilligung
dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:
Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben
einer Landschaft oder sonstigen Gertlichkeit erscheinen;
z. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen
Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teil-
genommen haben;
H. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind,
sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren
Interesse der Kunst dient.
Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Ver-
breitung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Zn-
teresse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist,
seiner Angehörigen verletzt wird.
K 2H. Für Zwecke der Rechtspflege und der öffent-
lichen Sicherheit dürfen von den Behörden Bildnisse ohne
Einwilligung des Berechtigten sowie des Abgebildeten oder
seiner Angehörigen vervielfältigt, verbreitet und öffentlich
zur Schau gestellt werden.
K 33. Mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark wird
bestraft:
l.;
2. wer den Vorschriften der KZ 22, 23 zuwider vorsätzlich
ein Bildnis verbreitet oder öffentlich zur Schau stellt.
Soll eine nicht beizutreibende Geldstrafe in Gefängnis-
strafe umgewandelt werden, so darf deren Dauer zwei Monate
nicht übersteigen.
keäakleur: HeNnag.
VII. Jakrg. Hekt 4^. 21. Sept. 1908.
In unserem „Sprecktaat" xvircl clen ttünsrsern ctas freie Mort erteilt. Vie Recisktion sorgt aber Lasur, Lag keinerlei
Angriffe aus Personen ocler SenoNentLiaslsn abgeäruckt ^verclen, okn« claS vorder cier ^ngegrissene clie MögULiksit geksbt
käne, in clernselben IZests ;u eriviclern. Vie klectaktion kält lick vollltanclig unpartsiisck unci gibt äurck clen )Ibciruck von 6in-
. senclungen keinestveg» eins Nebsreinstirnrnung rnit clen aus cliese Meile vorgetragsnen Meinungen zu erkennen. —
Tum Ksckt am eigenen Vilcle.
Von Eduard Eckert, Amtsrichter in Nürnberg.
Die Beilage zur „Allgemeinen Zeitung" hat
im Zahre Ifi02 den Nummern H8s und 22^
zwei 2lufsätze über das Recht am eigenen Bilde ge-
bracht. Beide behandelten dieses neue persönlich-
keitsrecht nicht nur von dem Standpunkte des da-
mals geltenden Rechtes aus, sondern erörterten auch
die Frage, welchen Schutz die Gesetzgebung der
Zukunst dem Recht am eigenen Bilde angedeihen
lassen sollte. Aber während der Verfasser des mit
ler. gezeichneten Aufsatzes in Nr. H8s mit großer
TVärme sich des neuen Rechtsgebildes annahm, trat
der Verfasser des anderen, Professor Or. Heinrich
Schuster, mit guten Gründen der Art und Weise
entgegen, in der die Freunde des Rechtes am eigenen
Bilde wegen der einen oder anderen mißbräuchlichen
Verwendung eines fremden Bildnisses, wie sie haupt-
sächlich die Photographie sich hatte zuschulden kommen
lassen, nun auch dem harmlosen Gebrauche fremder
Bildnisse zu Leibe gehen wollten; er wies vor allem
auf die Gefahren hin, die von dieser Seite unserer
bildenden Kunst drohen, und schloß mit dem Satze:
„Der deutschen Kunst darf vom deutschen Recht kein
Leid widerfahren." Auch der Verfasser des Auf-
satzes in Nr. H8s verhehlte sich die Schwierigkeiten
nicht, die sich der Gesetzgebung bei dem Bemühen,
zwischen dem harmlosen Gebrauch und dem Witz-
brauch eines Bildnisses zu scheiden, entgegenstellen
würden: „Hier die richtige Abgrenzung zwischen dem,
was verboten, und dem, was gestattet werden muß,
zu finden, ist eine böse Aufgabe, an die kein Gesetz-
geber ohne Not herantreten wird. Vorerst muß
Wissenschaft und Praxis noch viel gründlicher vor-
arbeiten, als dies bis jetzt geschehen ist." Selbst
Hugo Keyßner, den man als den Vater des Rechts
am eigenen Bilde bezeichnen darf, erklärte in seinem
Gutachten für den 26. deutschen Zuristentag, daß
er in den Ruf, mit rascher Gesetzgebung zu helfen,
nicht einzustimmen vermöge; auch ihm erschien es
wünschenswert, daß der freien, durch kein Gesetz
gebundenen Rechtsentwicklung erst noch Spielraum
gelassen werde.
Schneller als diese Freunde des Rechts am
eigenen Bilde es wünschten, hat unsere Reichsgesetz-
gebung nun eingegriffen: das am s. Zuli vorigen
Zahrcs in Kraft getretene Reichsgesetz über das
Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und
der Photographie regelt in den ZA 22 ff. das Recht
am eigenen Bilde.*) (Line eingehende Darstellung
dieser Regelung würde hier wohl zu weit führen.
Ls sei mir erlaubt, statt dessen auf die unten ab-
gedruckten Gesetzesbestimmungen zu verweisen und
an der Hand dieser Vorschriften hier zu zeigen, in-
wieweit das Gesetz den Anforderungen gerecht wird,
die von der einen Seite an die Regelung des Rechtes
am eigenen Bilde gestellt worden sind, und inwie-
weit es die Befürchtungen rechtfertigt, die man auf
der anderen Seite hauptsächlich für unsere bildende
Kunst gehegt hat.
Zn dem mehrerwähnten Aufsatze des lcr. finden
wir die Forderung aufgestellt: „Lin vollkommener
Schutz müßte sich sogar auf die Nachahmung der äußeren
Erscheinung einer Person durch Maskierung erstrecken,
die in demselben Sinne wie eine Nachbildung wirken
ch K 22. Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des
Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt
werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn
der Abgebildete dafür, daß er sich abbilden ließ, eine Ent-
lohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf
es bis zum Ablaufe von ;o Zähren der Einwilligung der
Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses
Gesetzes sind der überlebende Ehegatte und die Kinder des
Abgebildeten, und wenn weder ein Ehegatte noch Kinder
vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.
K 23. Ohne die nach K 22 erforderliche Einwilligung
dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:
Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben
einer Landschaft oder sonstigen Gertlichkeit erscheinen;
z. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen
Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teil-
genommen haben;
H. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind,
sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren
Interesse der Kunst dient.
Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Ver-
breitung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Zn-
teresse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist,
seiner Angehörigen verletzt wird.
K 2H. Für Zwecke der Rechtspflege und der öffent-
lichen Sicherheit dürfen von den Behörden Bildnisse ohne
Einwilligung des Berechtigten sowie des Abgebildeten oder
seiner Angehörigen vervielfältigt, verbreitet und öffentlich
zur Schau gestellt werden.
K 33. Mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark wird
bestraft:
l.;
2. wer den Vorschriften der KZ 22, 23 zuwider vorsätzlich
ein Bildnis verbreitet oder öffentlich zur Schau stellt.
Soll eine nicht beizutreibende Geldstrafe in Gefängnis-
strafe umgewandelt werden, so darf deren Dauer zwei Monate
nicht übersteigen.