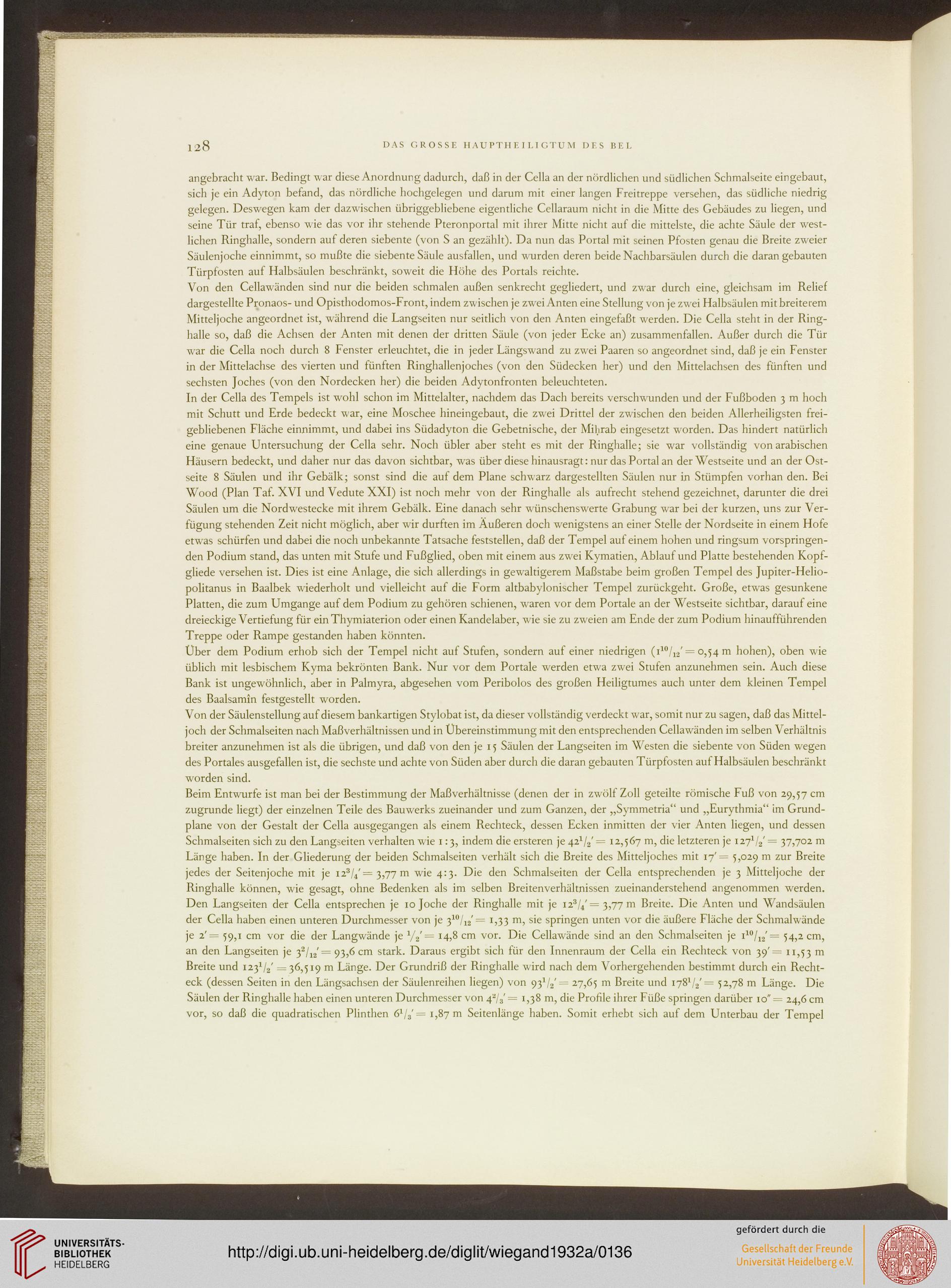12?
DAS CROSSE HAUPTIIE IL I C.TUM DES BEL
r
angebracht war. Bedingt war diese Anordnung dadurch, daß in der Cella an der nördlichen und südlichen Schmalseite eingebaut,
sich je ein Adyton befand, das nördliche hochgelegen und darum mit einer langen Freitreppe versehen, das südliche niedrig
gelegen. Deswegen kam der dazwischen übriggebliebene eigentliche Cellaraum nicht in die Mitte des Gebäudes zu liegen, und
seine Tür traf, ebenso wie das vor ihr stehende Pteronportal mit ihrer Mitte nicht auf die mittelste, die achte Säule der west-
lichen Ringhalle, sondern auf deren siebente (von S an gezählt). Da nun das Portal mit seinen Pfosten genau die Breite zweier
Säulenjoche einnimmt, so mußte die siebente Säule ausfallen, und wurden deren beide Nachbarsäulen durch die darangebauten
Türpfosten auf Halbsäulen beschränkt, soweit die Höhe des Portals reichte.
Von den Cellawänden sind nur die beiden schmalen außen senkrecht gegliedert, und zwar durch eine, gleichsam im Relief
dargestellte Pronaos- und Opisthodomos-Front, indem zwischen je zwei Anten eine Stellung von je zwei Halbsäulen mit breiterem
Mitteljoche angeordnet ist, während die Langseiten nur seitlich von den Anten eingefaßt werden. Die Cella steht in der Ring-
halle so, daß die Achsen der Anten mit denen der dritten Säule (von jeder Ecke an) zusammenfallen. Außer durch die Tür
war die Cella noch durch 8 Fenster erleuchtet, die in jeder Längswand zu zwei Paaren so angeordnet sind, daß je ein Fenster
in der Mittelachse des vierten und fünften Ringhallenjoches (von den Südecken her) und den Mittelachsen des fünften und
sechsten Joches (von den Nordecken her) die beiden Adytonfronten beleuchteten.
In der Cella des Tempels ist wohl schon im Mittelalter, nachdem das Dach bereits verschwunden und der Fußboden 3 m hoch
mit Schutt und Erde bedeckt war, eine Moschee hineingebaut, die zwei Drittel der zwischen den beiden Allerheiligsten frei-
gebliebenen Fläche einnimmt, und dabei ins Südadyton die Gebetnische, der Mihrab eingesetzt worden. Das hindert natürlich
eine genaue Untersuchung der Cella sehr. Noch übler aber steht es mit der Ringhalle; sie war vollständig von arabischen
Häusern bedeckt, und daher nur das davon sichtbar, was über diese hinausragt: nur das Portal an der Westseite und an der Ost-
seite 8 Säulen und ihr Gebälk; sonst sind die auf dem Plane schwarz dargestellten Säulen nur in Stümpfen vornan den. Bei
Wood (Plan Taf. XVI und Vedute XXI) ist noch mehr von der Ringhalle als aufrecht stehend gezeichnet, darunter die drei
Säulen um die Nordwestecke mit ihrem Gebälk. Eine danach sehr wünschenswerte Grabung war bei der kurzen, uns zur Ver-
fügung stehenden Zeit nicht möglich, aber wir durften im Äußeren doch wenigstens an einer Stelle der Nordseite in einem Hofe
etwas schürfen und dabei die noch unbekannte Tatsache feststellen, daß der Tempel auf einem hohen und ringsum vorspringen-
den Podium stand, das unten mit Stufe und Fußglied, oben mit einem aus zwei Kymatien, Ablauf und Platte bestehenden Kopf-
gliede versehen ist. Dies ist eine Anlage, die sich allerdings in gewaltigerem Maßstabe beim großen Tempel des Jupiter-Helio-
politanus in Baalbek wiederholt und vielleicht auf die Form altbabylonischer Tempel zurückgeht. Große, etwas gesunkene
Platten, die zum Umgange auf dem Podium zu gehören schienen, waren vor dem Portale an der Westseite sichtbar, darauf eine
dreieckige Vertiefung für ein Thymiaterion oder einen Kandelaber, wie sie zu zweien am Ende der zum Podium hinaufführenden
Treppe oder Rampe gestanden haben könnten.
Über dem Podium erhob sich der Tempel nicht auf Stufen, sondern auf einer niedrigen (i10/12' = 0,54 m hohen), oben wie
üblich mit lesbischem Kyma bekrönten Bank. Nur vor dem Portale werden etwa zwei Stufen anzunehmen sein. Auch diese
Bank ist ungewöhnlich, aber in Palmyra, abgesehen vom Peribolos des großen Heiligtumes auch unter dem kleinen Tempel
des Baalsamin festgestellt worden.
Von der Säulenstellung auf diesem bankartigen Stylobat ist, da dieser vollständig verdeckt war, somit nur zu sagen, daß das Mittel-
joch der Schmalseiten nach Maßverhältnissen und in Übereinstimmung mit den entsprechenden Cellawänden im selben Verhältnis
breiter anzunehmen ist als die übrigen, und daß von den je 15 Säulen der Langseiten im Westen die siebente von Süden wegen
des Portales ausgefallen ist, die sechste und achte von Süden aber durch die daran gebauten Türpfosten auf Halbsäulen beschränkt
worden sind.
Beim Entwürfe ist man bei der Bestimmung der Maßverhältnisse (denen der in zwölf Zoll geteilte römische Fuß von 29,57 cm
zugrunde liegt) der einzelnen Teile des Bauwerks zueinander und zum Ganzen, der „Symmetria" und „Eurythmia" im Grund-
plane von der Gestalt der Cella ausgegangen als einem Rechteck, dessen Ecken inmitten der vier Anten liegen, und dessen
Schmalseiten sich zu den Langseiten verhalten wie 1:3, indem die ersteren je 421/2' = 12,567 m, die letzteren je i271/2' = 37,702 m
Länge haben. In der Gliederung der beiden Schmalseiten verhält sich die Breite des Mitteljoches mit 17'= 5,029 m zur Breite
jedes der Seitenjoche mit je i23/4'= 3,77 m wie 4:3. Die den Schmalseiten der Cella entsprechenden je 3 Mitteljoche der
Ringhalle können, wie gesagt, ohne Bedenken als im selben Breitenverhältnissen zueinanderstehend angenommen werden.
Den Langseiten der Cella entsprechen je 10 Joche der Ringhalle mit je i23/4'= 3,77 m Breite. Die Anten und Wandsäulen
der Cella haben einen unteren Durchmesser von je 310/i2' = 1,33 m, sie springen unten vor die äußere Fläche der Schmalwände
je 2'= 59,1 cm vor die der Langwände je 1/2' = T4,8 cm vor. Die Cellawände sind an den Schmalseiten je i10/12'= 54,2 cm,
an den Langseiten je 32/12'= 93,6 cm stark. Daraus ergibt sich für den Innenraum der Cella ein Rechteck von 39'= 11,53 m
Breite und 1231/,,' = 36,519 m Länge. Der Grundriß der Ringhalle wird nach dem Vorhergehenden bestimmt durch ein Recht-
eck (dessen Seiten in den Längsachsen der Säulenreihen liegen) von 931/2'= 27,65 m Breite und i781/2'= 52,78 m Länge. Die
Säulen der Ringhalle haben einen unteren Durchmesser von 4z/3' = 1,38 m, die Profile ihrer Füße springen darüber 10" = 24,6 cm
vor, so daß die quadratischen Plinthen 61/3'= 1,87 m Seitenlänge haben. Somit erhebt sich auf dem Unterbau der Tempel
DAS CROSSE HAUPTIIE IL I C.TUM DES BEL
r
angebracht war. Bedingt war diese Anordnung dadurch, daß in der Cella an der nördlichen und südlichen Schmalseite eingebaut,
sich je ein Adyton befand, das nördliche hochgelegen und darum mit einer langen Freitreppe versehen, das südliche niedrig
gelegen. Deswegen kam der dazwischen übriggebliebene eigentliche Cellaraum nicht in die Mitte des Gebäudes zu liegen, und
seine Tür traf, ebenso wie das vor ihr stehende Pteronportal mit ihrer Mitte nicht auf die mittelste, die achte Säule der west-
lichen Ringhalle, sondern auf deren siebente (von S an gezählt). Da nun das Portal mit seinen Pfosten genau die Breite zweier
Säulenjoche einnimmt, so mußte die siebente Säule ausfallen, und wurden deren beide Nachbarsäulen durch die darangebauten
Türpfosten auf Halbsäulen beschränkt, soweit die Höhe des Portals reichte.
Von den Cellawänden sind nur die beiden schmalen außen senkrecht gegliedert, und zwar durch eine, gleichsam im Relief
dargestellte Pronaos- und Opisthodomos-Front, indem zwischen je zwei Anten eine Stellung von je zwei Halbsäulen mit breiterem
Mitteljoche angeordnet ist, während die Langseiten nur seitlich von den Anten eingefaßt werden. Die Cella steht in der Ring-
halle so, daß die Achsen der Anten mit denen der dritten Säule (von jeder Ecke an) zusammenfallen. Außer durch die Tür
war die Cella noch durch 8 Fenster erleuchtet, die in jeder Längswand zu zwei Paaren so angeordnet sind, daß je ein Fenster
in der Mittelachse des vierten und fünften Ringhallenjoches (von den Südecken her) und den Mittelachsen des fünften und
sechsten Joches (von den Nordecken her) die beiden Adytonfronten beleuchteten.
In der Cella des Tempels ist wohl schon im Mittelalter, nachdem das Dach bereits verschwunden und der Fußboden 3 m hoch
mit Schutt und Erde bedeckt war, eine Moschee hineingebaut, die zwei Drittel der zwischen den beiden Allerheiligsten frei-
gebliebenen Fläche einnimmt, und dabei ins Südadyton die Gebetnische, der Mihrab eingesetzt worden. Das hindert natürlich
eine genaue Untersuchung der Cella sehr. Noch übler aber steht es mit der Ringhalle; sie war vollständig von arabischen
Häusern bedeckt, und daher nur das davon sichtbar, was über diese hinausragt: nur das Portal an der Westseite und an der Ost-
seite 8 Säulen und ihr Gebälk; sonst sind die auf dem Plane schwarz dargestellten Säulen nur in Stümpfen vornan den. Bei
Wood (Plan Taf. XVI und Vedute XXI) ist noch mehr von der Ringhalle als aufrecht stehend gezeichnet, darunter die drei
Säulen um die Nordwestecke mit ihrem Gebälk. Eine danach sehr wünschenswerte Grabung war bei der kurzen, uns zur Ver-
fügung stehenden Zeit nicht möglich, aber wir durften im Äußeren doch wenigstens an einer Stelle der Nordseite in einem Hofe
etwas schürfen und dabei die noch unbekannte Tatsache feststellen, daß der Tempel auf einem hohen und ringsum vorspringen-
den Podium stand, das unten mit Stufe und Fußglied, oben mit einem aus zwei Kymatien, Ablauf und Platte bestehenden Kopf-
gliede versehen ist. Dies ist eine Anlage, die sich allerdings in gewaltigerem Maßstabe beim großen Tempel des Jupiter-Helio-
politanus in Baalbek wiederholt und vielleicht auf die Form altbabylonischer Tempel zurückgeht. Große, etwas gesunkene
Platten, die zum Umgange auf dem Podium zu gehören schienen, waren vor dem Portale an der Westseite sichtbar, darauf eine
dreieckige Vertiefung für ein Thymiaterion oder einen Kandelaber, wie sie zu zweien am Ende der zum Podium hinaufführenden
Treppe oder Rampe gestanden haben könnten.
Über dem Podium erhob sich der Tempel nicht auf Stufen, sondern auf einer niedrigen (i10/12' = 0,54 m hohen), oben wie
üblich mit lesbischem Kyma bekrönten Bank. Nur vor dem Portale werden etwa zwei Stufen anzunehmen sein. Auch diese
Bank ist ungewöhnlich, aber in Palmyra, abgesehen vom Peribolos des großen Heiligtumes auch unter dem kleinen Tempel
des Baalsamin festgestellt worden.
Von der Säulenstellung auf diesem bankartigen Stylobat ist, da dieser vollständig verdeckt war, somit nur zu sagen, daß das Mittel-
joch der Schmalseiten nach Maßverhältnissen und in Übereinstimmung mit den entsprechenden Cellawänden im selben Verhältnis
breiter anzunehmen ist als die übrigen, und daß von den je 15 Säulen der Langseiten im Westen die siebente von Süden wegen
des Portales ausgefallen ist, die sechste und achte von Süden aber durch die daran gebauten Türpfosten auf Halbsäulen beschränkt
worden sind.
Beim Entwürfe ist man bei der Bestimmung der Maßverhältnisse (denen der in zwölf Zoll geteilte römische Fuß von 29,57 cm
zugrunde liegt) der einzelnen Teile des Bauwerks zueinander und zum Ganzen, der „Symmetria" und „Eurythmia" im Grund-
plane von der Gestalt der Cella ausgegangen als einem Rechteck, dessen Ecken inmitten der vier Anten liegen, und dessen
Schmalseiten sich zu den Langseiten verhalten wie 1:3, indem die ersteren je 421/2' = 12,567 m, die letzteren je i271/2' = 37,702 m
Länge haben. In der Gliederung der beiden Schmalseiten verhält sich die Breite des Mitteljoches mit 17'= 5,029 m zur Breite
jedes der Seitenjoche mit je i23/4'= 3,77 m wie 4:3. Die den Schmalseiten der Cella entsprechenden je 3 Mitteljoche der
Ringhalle können, wie gesagt, ohne Bedenken als im selben Breitenverhältnissen zueinanderstehend angenommen werden.
Den Langseiten der Cella entsprechen je 10 Joche der Ringhalle mit je i23/4'= 3,77 m Breite. Die Anten und Wandsäulen
der Cella haben einen unteren Durchmesser von je 310/i2' = 1,33 m, sie springen unten vor die äußere Fläche der Schmalwände
je 2'= 59,1 cm vor die der Langwände je 1/2' = T4,8 cm vor. Die Cellawände sind an den Schmalseiten je i10/12'= 54,2 cm,
an den Langseiten je 32/12'= 93,6 cm stark. Daraus ergibt sich für den Innenraum der Cella ein Rechteck von 39'= 11,53 m
Breite und 1231/,,' = 36,519 m Länge. Der Grundriß der Ringhalle wird nach dem Vorhergehenden bestimmt durch ein Recht-
eck (dessen Seiten in den Längsachsen der Säulenreihen liegen) von 931/2'= 27,65 m Breite und i781/2'= 52,78 m Länge. Die
Säulen der Ringhalle haben einen unteren Durchmesser von 4z/3' = 1,38 m, die Profile ihrer Füße springen darüber 10" = 24,6 cm
vor, so daß die quadratischen Plinthen 61/3'= 1,87 m Seitenlänge haben. Somit erhebt sich auf dem Unterbau der Tempel