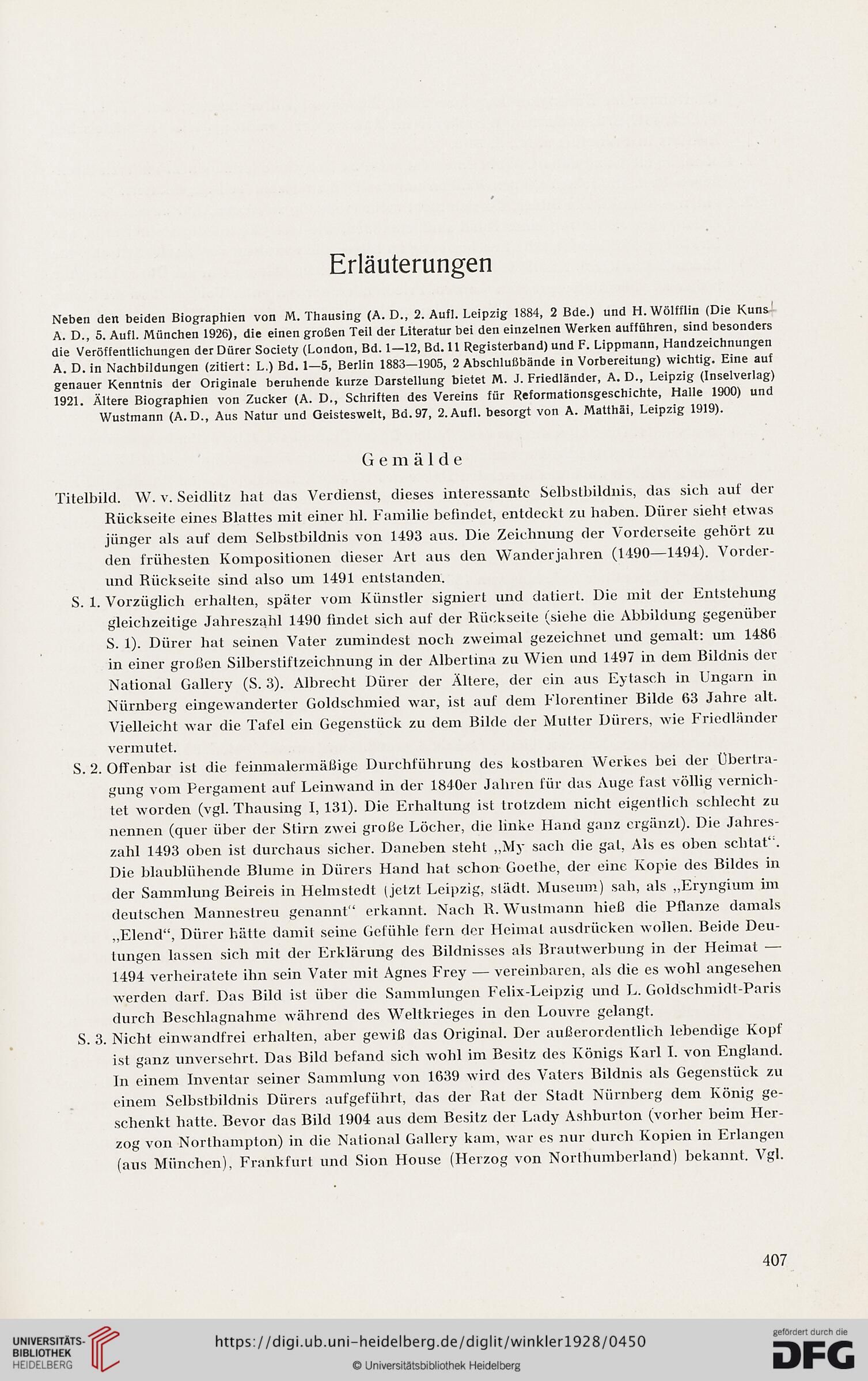Erläuterungen
Neben den beiden Biographien von M. Thausing (A. D., 2. Aufl. Leipzig 1884, 2 Bde.) und H.Wölfflin (Die Kuns
A. D., 5. Aufl. München 1926), die einen großen Teil der Literatur bei den einzelnen Werken aufführen, sind besonders
die Veröffentlichungen der Dürer Society (London, Bd. 1—12, Bd. 11 Registerband) und F. Lippmann, Handzeichnungen
A. D. in Nachbildungen (zitiert: L.) Bd. 1—5, Berlin 1883—1905, 2 Abschlußbände in Vorbereitung) wichtig. Eine auf
genauer Kenntnis der Originale beruhende kurze Darstellung bietet M. J. Friedländer, A. D., Leipzig (Inselverlag)
1921. Ältere Biographien von Zucker (A. D., Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, Halle 1900) und
Wustmann (A. D., Aus Natur und Geisteswelt, Bd.97, 2. Aufl. besorgt von A. Matthäi, Leipzig 1919).
Gemälde
Titelbild. W. v. Seidlitz hat das Verdienst, dieses interessante Selbstbildnis, das sich auf der
Rückseite eines Blattes mit einer hl. Familie befindet, entdeckt zu haben. Dürer sieht etwas
jünger als auf dem Selbstbildnis von 1493 aus. Die Zeichnung der Vorderseite gehört zu
den frühesten Kompositionen dieser Art aus den Wander jähren (1490—1494). Vorder-
und Rückseite sind also um 1491 entstanden.
S. 1. Vorzüglich erhalten, später vom Künstler signiert und datiert. Die mit der Entstehung
gleichzeitige Jahreszahl 1490 findet sich auf der Rückseite (siehe die Abbildung gegenüber
S. 1). Dürer hat seinen Vater zumindest noch zweimal gezeichnet und gemalt: um 1486
in einer großen Silberstiftzeichnung in der Albertina zu Wien und 1497 in dem Bildnis der
National Gallery (S. 3). Albrecht Dürer der Ältere, der ein aus Eytasch in Ungarn in
Nürnberg eingewanderter Goldschmied war, ist auf dem Florentiner- Bilde 63 Jahre alt.
Vielleicht war die Tafel ein Gegenstück zu dem Bilde der Mutter Dürers, wie Friedländer
vermutet.
S. 2. Offenbar ist die feinmalermäßige Durchführung des kostbaren Werkes bei der Übertra-
gung vom Pergament auf Leinwand in der 1840er Jahren für das Auge fast völlig vernich-
tet worden (vgl. Thausing I, 131). Die Erhaltung ist trotzdem nicht eigentlich schlecht zu
nennen (quer über der Stirn zwei große Löcher, die linke Hand ganz ergänzt). Die Jahres-
zahl 1493 oben ist durchaus sicher. Daneben steht „My sach die gat, Als es oben schtat“.
Die blaublühende Blume in Dürers Hand hat schon Goethe, der eine Kopie des Bildes in
der Sammlung Beireis in Helmstedt (jetzt Leipzig, städt. Museum) sah, als „Eryngium im
deutschen Mannestreu genannt“ erkannt. Nach R. Wustmann hieß die Pflanze damals
„Elend“, Dürer hätte damit seine Gefühle fern der Heimat ausdrücken wollen. Beide Deu-
tungen lassen sich mit der Erklärung des Bildnisses als Brautwerbung in der Heimat —
1494 verheiratete ihn sein Vater mit Agnes Frey — vereinbaren, als die es wohl angesehen
werden darf. Das Bild ist über die Sammlungen Felix-Leipzig und L. Goldschmidt-Paris
durch Beschlagnahme während des Weltkrieges in den Louvre gelangt.
S. 3. Nicht einwandfrei erhalten, aber gewiß das Original. Der außerordentlich lebendige Kopf
ist ganz unversehrt. Das Bild befand sich wohl im Besitz des Königs Karl I. von England.
In einem Inventar seiner Sammlung von 1639 wird des Vaters Bildnis als Gegenstück zu
einem Selbstbildnis Dürers aufgeführt, das der Rat der Stadt Nürnberg dem König ge-
schenkt hatte. Bevor das Bild 1904 aus dem Besitz der Lady Ashburton (vorher beim Her-
zog von Northampton) in die National Gallery kam, war es nur durch Kopien in Erlangen
(aus München), Frankfurt und Sion House (Herzog von Northumberland) bekannt. Vgl.
407
Neben den beiden Biographien von M. Thausing (A. D., 2. Aufl. Leipzig 1884, 2 Bde.) und H.Wölfflin (Die Kuns
A. D., 5. Aufl. München 1926), die einen großen Teil der Literatur bei den einzelnen Werken aufführen, sind besonders
die Veröffentlichungen der Dürer Society (London, Bd. 1—12, Bd. 11 Registerband) und F. Lippmann, Handzeichnungen
A. D. in Nachbildungen (zitiert: L.) Bd. 1—5, Berlin 1883—1905, 2 Abschlußbände in Vorbereitung) wichtig. Eine auf
genauer Kenntnis der Originale beruhende kurze Darstellung bietet M. J. Friedländer, A. D., Leipzig (Inselverlag)
1921. Ältere Biographien von Zucker (A. D., Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, Halle 1900) und
Wustmann (A. D., Aus Natur und Geisteswelt, Bd.97, 2. Aufl. besorgt von A. Matthäi, Leipzig 1919).
Gemälde
Titelbild. W. v. Seidlitz hat das Verdienst, dieses interessante Selbstbildnis, das sich auf der
Rückseite eines Blattes mit einer hl. Familie befindet, entdeckt zu haben. Dürer sieht etwas
jünger als auf dem Selbstbildnis von 1493 aus. Die Zeichnung der Vorderseite gehört zu
den frühesten Kompositionen dieser Art aus den Wander jähren (1490—1494). Vorder-
und Rückseite sind also um 1491 entstanden.
S. 1. Vorzüglich erhalten, später vom Künstler signiert und datiert. Die mit der Entstehung
gleichzeitige Jahreszahl 1490 findet sich auf der Rückseite (siehe die Abbildung gegenüber
S. 1). Dürer hat seinen Vater zumindest noch zweimal gezeichnet und gemalt: um 1486
in einer großen Silberstiftzeichnung in der Albertina zu Wien und 1497 in dem Bildnis der
National Gallery (S. 3). Albrecht Dürer der Ältere, der ein aus Eytasch in Ungarn in
Nürnberg eingewanderter Goldschmied war, ist auf dem Florentiner- Bilde 63 Jahre alt.
Vielleicht war die Tafel ein Gegenstück zu dem Bilde der Mutter Dürers, wie Friedländer
vermutet.
S. 2. Offenbar ist die feinmalermäßige Durchführung des kostbaren Werkes bei der Übertra-
gung vom Pergament auf Leinwand in der 1840er Jahren für das Auge fast völlig vernich-
tet worden (vgl. Thausing I, 131). Die Erhaltung ist trotzdem nicht eigentlich schlecht zu
nennen (quer über der Stirn zwei große Löcher, die linke Hand ganz ergänzt). Die Jahres-
zahl 1493 oben ist durchaus sicher. Daneben steht „My sach die gat, Als es oben schtat“.
Die blaublühende Blume in Dürers Hand hat schon Goethe, der eine Kopie des Bildes in
der Sammlung Beireis in Helmstedt (jetzt Leipzig, städt. Museum) sah, als „Eryngium im
deutschen Mannestreu genannt“ erkannt. Nach R. Wustmann hieß die Pflanze damals
„Elend“, Dürer hätte damit seine Gefühle fern der Heimat ausdrücken wollen. Beide Deu-
tungen lassen sich mit der Erklärung des Bildnisses als Brautwerbung in der Heimat —
1494 verheiratete ihn sein Vater mit Agnes Frey — vereinbaren, als die es wohl angesehen
werden darf. Das Bild ist über die Sammlungen Felix-Leipzig und L. Goldschmidt-Paris
durch Beschlagnahme während des Weltkrieges in den Louvre gelangt.
S. 3. Nicht einwandfrei erhalten, aber gewiß das Original. Der außerordentlich lebendige Kopf
ist ganz unversehrt. Das Bild befand sich wohl im Besitz des Königs Karl I. von England.
In einem Inventar seiner Sammlung von 1639 wird des Vaters Bildnis als Gegenstück zu
einem Selbstbildnis Dürers aufgeführt, das der Rat der Stadt Nürnberg dem König ge-
schenkt hatte. Bevor das Bild 1904 aus dem Besitz der Lady Ashburton (vorher beim Her-
zog von Northampton) in die National Gallery kam, war es nur durch Kopien in Erlangen
(aus München), Frankfurt und Sion House (Herzog von Northumberland) bekannt. Vgl.
407