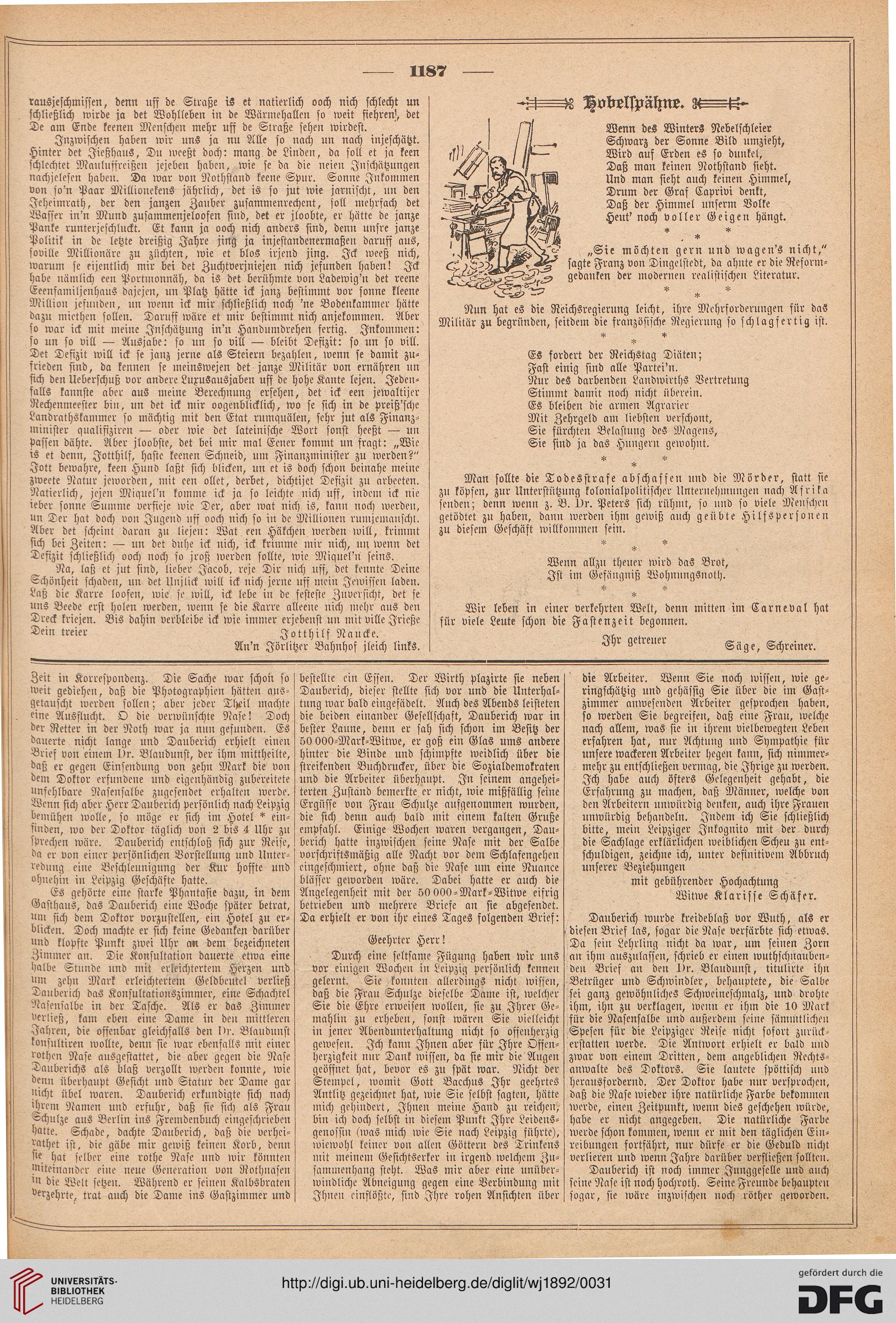1187
rausjeschmisscn, denn uff de Straße is et natierlich ooch nich schlecht un
schließlich Wirde ja det Wohlleben in de Wiirmehallen so weit fiehrens, bet
De am Ende keenen Menschen mehr uff de Straße sehen wirkest.
Inzwischen haben wir uns ja nu Alle so nach un nach injeschätzt.
Hinter det Jießhaus, Du weeßt doch: mang de Linden, da soll et ja keen
schlechter Maulusfreißen jejeben haben, wie se da die neien Jnschätzungen
nachjelesen haben. Da war von Nothstand keene Spur. Sonne Jnkommen
von so'n Paar Millionekens jährlich, det is so jut wie jarnischt, un den
Jeheimrath, der den janzen Zauber zusammenrechcnt, soll mehrfach det
Wasser in'n Mund zusammenjeloofen sind, det er jloobte, er hätte de janze
Pauke runterjeschluckt. Et kann ja ooch nich anders sind, denn unsre janze
Politik in de letzte dreißig Jahre jing ja injestandenermaßen daruff aus,
soville Millionäre zu züchten, wie et blos irjend jing. Ick weeß nich,
warum se eijentlich mir bei det Zuchtverjniejen nich jefunden haben! Ick
habe nämlich een Portmonnäh, da is det berühmte von Ladewig'n det reene
Eeenfamiljenhaus dajejen, un Platz hätte ick janz bestimmt vor sonne kleene
Million jefunden, un wenn ick mir schließlich noch 'ne Bodenkammer hätte
dazu miethen sollen. Daruff wäre et mir bestimmt nich anjekommen. Aber
so war ick mit meine Jnschätzung in'n Handumdrehen fertig. Jnkommen:
so un so vill — Ausjabe: so un so vill — bleibt Defizit: so un so vill.
Det Defizit will ick se janz jerne als Steiern bezahlen, wenn se damit zu-
frieden sind, da kennen se meinswejen det janze Militär von ernähren un
sich den Ueberschuß vor andere Luxusausjaben uff de hohe Kante lejen. Jeden-
falls kaunste aber aus meine Berechnung ersehen, det ick een jewältijer
Rechenmeester bin, un det ick mir oogenblicklich, wo se sich in de preiß'sche
Landrathskammer so mächtig mit den Etat rumquälen, sehr jut als Finanz-
minister qualifiziren — oder wie det lateinische Wort sonst heeßt — un
Passen dühte. Aber jloobste, det bei mir mal Eener kommt un fragt: „Wie
is et denn, Jotthilf, haste keenen Schneid, um Finanzminister zu werden?"
Jott bewahre, keen Hund laßt sich blicken, un et is doch schon beinahe meine
zweete Natur jeworden, mit een ollet, derbet, dichtijet Defizit zu arbeeten.
Natierlich, jejen Miquel'n komme ick ja so leichte nich uff, indem ick nie
ieber sonne Summe versieje wie Der, aber wat nich is, kaiui noch werden,
un Der hat doch von Jugend ufs ooch nich so in de Millionen rumjemanscht.
Aber det scheint daran zu liejeu: Wat een Häkchen werden will, krimmt
sich bei Zeiten: — un det duhe ick nich, ick krimme mir nich, un wenn det
Defizit schließlich ooch noch so jroß werden sollte, wie Miquel'n seins.
^ Na, laß et jut sind, lieber Jacob, reje Dir nich ufs, det kennte Deine
Schönheit schaden, un det llnjlick will ick nich jerne uff mein Jewissen laden.
Laß die Karre loofen, wie' se will, ick lebe in de festeste Zuversicht, det se
uns Beede erst holen werden, wenn se die Karre alleene nich mehr aus den
Dreck kriejen. Bis dahin verbleibe ick wie immer erjebenst un mit ville Jrieße
Dein kreier Jotthilf Raucke.
An'n Jörlitzer Bahnhof jleich links.
-EjEEEE^g HobrlMhne.
Wenn des Winters Nebelschleier
Schwarz der Sonne Bild umzieht,
Wird auf Erden es so dunkel,
Daß man keinen Nothstand sieht.
Und man sieht auch keinen Himmel,
Drum der Gras Caprivi denkt,
Daß der Himmel unserm Volke
Heut'noch voller Geigen hängt.
* *
. *
„Sie möchten gern und wagen's nicht,"
sagte Franz von Dingelstedt, da ahnte er die Reform-
gedanken der modernen realistischen Literatur.
Nun hat es die Reichsregierung leicht, ihre Mehrforderungen für das
Militär zu begründen, seitdem die französische Regierung so schlagfertig ist.
* *
*
Es fordert der Reichstag Diäten;
Fast einig sind alle Partei'n.
Nur des darbenden Landwirths Vertretung
Stimmt damit noch nicht überein.
Es bleiben die armen Agrarier
Mit Zehrgeld am liebsten verschont,
Sie fürchten Belastuiig des Magens,
Sie sind ja das Hungern gewohnt.
Man sollte die Todesstrafe ab sch affen und die Mörder, statt sie
zu köpfen, zur Unterstützung kolonialpolitischer Unternehmungen nach Afrika
senden; denn wenti z. B. 1)r. Peters sich rühmt, so itnd so viele Menschen
getödtet zu haben, dann werden ihm gewiß auch geübte HilssPersonen
zu diesem Geschäft willkommen sein.
Wenn allzu theuer wird das Brot,
Ist im Gefängniß Wohnungsnoth.
* *
*
Wir leben in einer verkehrten Well, denn mitten im Carneval hat
für viele Leute schon die Fastenzeit begonnen.
Ihr getreuer Säge, Schreiner.
Zeit in Korrespondenz. Die Sache war schon so
weit gediehen, daß die Photographien hätten ans-
getauscht werden sollen; aber jeder Theil machte
eine Ausflucht. O die verwünschte Nase! Doch
der Retter in der Noth war ja nun gefunden. Es
dauerte nicht lange und Tauberich erhielt einen
Brief von einem 1>r. Blaudunst, der ihm mittheilte,
daß er gegen Einsendung von zehn Mark die von
dem Doktor erfundene und eigenhändig zubereitete
unfehlbare Nasensalbe zugesendet erhalten werde.
Wenn sich aber Herr Dauberich persönlich nach Leipzig
bemühen wolle, so möge er sich im Hotel * ein-
finden, wo der Doktor täglich von 2 bis 4 Uhr zu
sprechen wäre. Dauberich entschloß sich zur Reise,
da er von einer persönlichen Vorstellung und Unter-
redung eine Beschleunigung der Kur hoffte und
ohnehin in Leipzig Geschäfte hatte.
Es gehörte eine starke Phantasie dazu, in dem
Gasthaus, das Dauberich eine Woche später betrat,
um sich dem Doktor vorzustellen, ein Hotel zu er-
blicken. Doch machte er sich keine Gedanken darüber
und klopfte Punkt zwei Uhr an dem bczeichneten
Zimmer an. Die Konsultation dauerte etwa eine
halbe Stunde und mit erleichtertem Herzen und
um zehn Mark erleichtertem Geldbeutel' verließ
Dauberich das Konsultationszimmer, eine Schachtel
Nasensalbe in der Tasche. Als er das Zimmer
berließ, kam eben eine Dame in den mittleren
Jahren, die offenbar gleichfalls den Dr. Blaudunst
konsultiren wollte, denn sie war ebenfalls mit einer
rothcn Nase ausgestattet, die aber gegen die Nase
Dauberichs als blaß verzollt werden konnte, wie
denn überhaupt Gesicht und Statur der Dame gar
sticht übel waren. Dauberich erkundigte sich nach
ihrem Namen und erfuhr, daß sie sich als Frau
Schulze aus Berlin ins Fremdenbuch eingeschrieben
hatte. Schade, dachte Dauberich, daß die verhei-
mlichet ist, die gäbe mir gewiß keinen Korb, denn
fit hat selber eine rothe Nase und wir könnten
miteinander eine neue Generation von Rothnasen
»> die Welt setzen. Während er seinen Kalbsbraten
verzehrte, trat auch die Dame ins Gastzimmer und
bestellte ein Essen. Der Wirth plazirte sie neben
Dauberich, dieser stellte sich vor und die Unterhal-
tung war bald eingefädelt. Auch des Abends leisteten
die beiden einander Gesellschaft, Dauberich war in
bester Laune, denn er sah sich schon im Besitz der
50 000-Mark-Witwe, er goß ein Glas ums andere
hinter die Binde und schimpfte weidlich über die
streikenden Buchdrucker, über die Sozialdemokraten
und die Arbeiter überhaupt. In seinem angehei-
terten Zustand bemerkte er nicht, wie mißfällig seine
Ergüsse von Frau Schulze ausgenommen wurden,
die sich denn auch bald mit einem kalten Gruße
empfahl. Einige Wochen waren vergangen, Dau-
berich hatte inzwischen seine Nase mit der Salbe
vorschriftsmäßig alle Nacht vor dem Schlafengehen
cingeschmiert, ohne daß die Nase um eine Nuance
blässer geworden wäre. Dabei hatte er auch die
Angelegenheit mit der 50000-Mark-Witwe eifrig
betrieben und mehrere Briefe an sie abgesendet.
Da erhielt er von ihr eines Tages folgenden Brief:
Geehrter Herr!
Durch eine seltsame Fügung haben wir uns
vor einigen Wochen in Leipzig persönlich kennen
gelernt. Sie foititten allerdings nicht wissen,
daß die Frau Schulze dieselbe Dame ist, welcher
Sie die Ehre erweisen wollen, sic zu Ihrer Ge-
mahlin zu erheben, sonst wären Sie vielleicht
in jener Abendunterhaltung nicht so offenherzig
gewesen. Ich kann Ihnen aber für Ihre Offen-
herzigkeit nur Dank wissen, da sie mir die Augen
geöffnet hat, bevor es zu spät war. Nicht der
Stempel, tvomit Gott Bacchus Ihr geehrtes
Antlitz gezeichnet hat, wie Sie selbst sagten, hätte
mich gehindert, Ihnen meine Hand zu reichen,
bin ich doch selbst in diesem Punkt Ihre Leidens-
genossin (was mich wie Sie nach Leipzig führte),
tviewohl keiner von allen Göttern des Trinkens
mit meinem Gesichtserker in irgend welchem Zu-
sammenhang steht. Was mir aber eine unüber-
windliche Abneigung gegen eine Verbindung mit
Ihnen einflößte, sind Ihre rohen Ansichten über
die Arbeiter. Wenn Sie noch wissen, wie ge-
ringschätzig und gehässig Sie über die im Gast-
zimmer anwesenden Arbeiter gesprochen haben,
so werden Sie begreifen, daß eine Frau, »velche
nach allem, was sic in ihrem vielbewegten Lebe»
erfahren hat, nur Achtung und Sympathie für
unsere wackeren Arbeiter hegen kau», sich nimmer-
mehr zu entschließen vermag, die Ihrige zu werden.
Ich habe auch öfters Gelegenheit gehabt, die
Erfahrung zu machen, daß Männer, welche von
den Arbeitern »»würdig denken, auch ihre Frauen
unwürdig behandeln. Indem ich Sie schließlich
bitte, mein Leipziger Inkognito mit der durch
die Sachlage erklärlichen weiblichen Scheu zu ent-
schuldigen, zeichne ich, unter definitivem Abbrltch
unserer Beziehungen
mit gebührender Hochachtung
Witwe Klarisse Schäfer.
Dauberich wurde kreideblaß vor Wuth, als er
■ diesen Brief las, sogar die Nase verfärbte sich etwas.
Da sein Lehrling nicht da tvar, um seinen Zorn
an ihm anszulassen, schrieb er einen wuthschnauben-
beu Brief an den l>r. Blaudunst, titulirte ihn
Betrüger und Schwindler, behauptete, die Salbe
sei ganz gewöhnliches Schweineschmalz, und drohte
ihm, ihn zu verklagen, wenn er ihm die 10 Mark
für die Nasensalbe und außerdem seine sämmtlichen
Spesen für die Leipziger Reise nicht sofort znrnck-
crstatten werde. Die Antwort erhielt er bald und
zwar von einem Dritten, dem angeblichen Rechts-
anwälte des Doktors. Sie lautete spöttisch und
herausfordernd. Der Doktor habe nur versprochen,
daß die Nase wieder ihre natürliche Farbe bekommen
werde, einen Zeitpunkt, wenn dies geschehen würde,
habe er nicht angegeben. Die natürliche Farbe
werde schon kommen, wenn er mit den täglichen Ein-
reibungen fortfährt, nur dürfe er die Geduld nicht
verlieren und wen» Jahre darüber verfließen sollten.
Dauberich ist noch immer Junggeselle und auch
seine Nase ist noch hochroth. Seine Freunde behaupten
sogar, sie wäre inzwischen noch röther geworden.
rausjeschmisscn, denn uff de Straße is et natierlich ooch nich schlecht un
schließlich Wirde ja det Wohlleben in de Wiirmehallen so weit fiehrens, bet
De am Ende keenen Menschen mehr uff de Straße sehen wirkest.
Inzwischen haben wir uns ja nu Alle so nach un nach injeschätzt.
Hinter det Jießhaus, Du weeßt doch: mang de Linden, da soll et ja keen
schlechter Maulusfreißen jejeben haben, wie se da die neien Jnschätzungen
nachjelesen haben. Da war von Nothstand keene Spur. Sonne Jnkommen
von so'n Paar Millionekens jährlich, det is so jut wie jarnischt, un den
Jeheimrath, der den janzen Zauber zusammenrechcnt, soll mehrfach det
Wasser in'n Mund zusammenjeloofen sind, det er jloobte, er hätte de janze
Pauke runterjeschluckt. Et kann ja ooch nich anders sind, denn unsre janze
Politik in de letzte dreißig Jahre jing ja injestandenermaßen daruff aus,
soville Millionäre zu züchten, wie et blos irjend jing. Ick weeß nich,
warum se eijentlich mir bei det Zuchtverjniejen nich jefunden haben! Ick
habe nämlich een Portmonnäh, da is det berühmte von Ladewig'n det reene
Eeenfamiljenhaus dajejen, un Platz hätte ick janz bestimmt vor sonne kleene
Million jefunden, un wenn ick mir schließlich noch 'ne Bodenkammer hätte
dazu miethen sollen. Daruff wäre et mir bestimmt nich anjekommen. Aber
so war ick mit meine Jnschätzung in'n Handumdrehen fertig. Jnkommen:
so un so vill — Ausjabe: so un so vill — bleibt Defizit: so un so vill.
Det Defizit will ick se janz jerne als Steiern bezahlen, wenn se damit zu-
frieden sind, da kennen se meinswejen det janze Militär von ernähren un
sich den Ueberschuß vor andere Luxusausjaben uff de hohe Kante lejen. Jeden-
falls kaunste aber aus meine Berechnung ersehen, det ick een jewältijer
Rechenmeester bin, un det ick mir oogenblicklich, wo se sich in de preiß'sche
Landrathskammer so mächtig mit den Etat rumquälen, sehr jut als Finanz-
minister qualifiziren — oder wie det lateinische Wort sonst heeßt — un
Passen dühte. Aber jloobste, det bei mir mal Eener kommt un fragt: „Wie
is et denn, Jotthilf, haste keenen Schneid, um Finanzminister zu werden?"
Jott bewahre, keen Hund laßt sich blicken, un et is doch schon beinahe meine
zweete Natur jeworden, mit een ollet, derbet, dichtijet Defizit zu arbeeten.
Natierlich, jejen Miquel'n komme ick ja so leichte nich uff, indem ick nie
ieber sonne Summe versieje wie Der, aber wat nich is, kaiui noch werden,
un Der hat doch von Jugend ufs ooch nich so in de Millionen rumjemanscht.
Aber det scheint daran zu liejeu: Wat een Häkchen werden will, krimmt
sich bei Zeiten: — un det duhe ick nich, ick krimme mir nich, un wenn det
Defizit schließlich ooch noch so jroß werden sollte, wie Miquel'n seins.
^ Na, laß et jut sind, lieber Jacob, reje Dir nich ufs, det kennte Deine
Schönheit schaden, un det llnjlick will ick nich jerne uff mein Jewissen laden.
Laß die Karre loofen, wie' se will, ick lebe in de festeste Zuversicht, det se
uns Beede erst holen werden, wenn se die Karre alleene nich mehr aus den
Dreck kriejen. Bis dahin verbleibe ick wie immer erjebenst un mit ville Jrieße
Dein kreier Jotthilf Raucke.
An'n Jörlitzer Bahnhof jleich links.
-EjEEEE^g HobrlMhne.
Wenn des Winters Nebelschleier
Schwarz der Sonne Bild umzieht,
Wird auf Erden es so dunkel,
Daß man keinen Nothstand sieht.
Und man sieht auch keinen Himmel,
Drum der Gras Caprivi denkt,
Daß der Himmel unserm Volke
Heut'noch voller Geigen hängt.
* *
. *
„Sie möchten gern und wagen's nicht,"
sagte Franz von Dingelstedt, da ahnte er die Reform-
gedanken der modernen realistischen Literatur.
Nun hat es die Reichsregierung leicht, ihre Mehrforderungen für das
Militär zu begründen, seitdem die französische Regierung so schlagfertig ist.
* *
*
Es fordert der Reichstag Diäten;
Fast einig sind alle Partei'n.
Nur des darbenden Landwirths Vertretung
Stimmt damit noch nicht überein.
Es bleiben die armen Agrarier
Mit Zehrgeld am liebsten verschont,
Sie fürchten Belastuiig des Magens,
Sie sind ja das Hungern gewohnt.
Man sollte die Todesstrafe ab sch affen und die Mörder, statt sie
zu köpfen, zur Unterstützung kolonialpolitischer Unternehmungen nach Afrika
senden; denn wenti z. B. 1)r. Peters sich rühmt, so itnd so viele Menschen
getödtet zu haben, dann werden ihm gewiß auch geübte HilssPersonen
zu diesem Geschäft willkommen sein.
Wenn allzu theuer wird das Brot,
Ist im Gefängniß Wohnungsnoth.
* *
*
Wir leben in einer verkehrten Well, denn mitten im Carneval hat
für viele Leute schon die Fastenzeit begonnen.
Ihr getreuer Säge, Schreiner.
Zeit in Korrespondenz. Die Sache war schon so
weit gediehen, daß die Photographien hätten ans-
getauscht werden sollen; aber jeder Theil machte
eine Ausflucht. O die verwünschte Nase! Doch
der Retter in der Noth war ja nun gefunden. Es
dauerte nicht lange und Tauberich erhielt einen
Brief von einem 1>r. Blaudunst, der ihm mittheilte,
daß er gegen Einsendung von zehn Mark die von
dem Doktor erfundene und eigenhändig zubereitete
unfehlbare Nasensalbe zugesendet erhalten werde.
Wenn sich aber Herr Dauberich persönlich nach Leipzig
bemühen wolle, so möge er sich im Hotel * ein-
finden, wo der Doktor täglich von 2 bis 4 Uhr zu
sprechen wäre. Dauberich entschloß sich zur Reise,
da er von einer persönlichen Vorstellung und Unter-
redung eine Beschleunigung der Kur hoffte und
ohnehin in Leipzig Geschäfte hatte.
Es gehörte eine starke Phantasie dazu, in dem
Gasthaus, das Dauberich eine Woche später betrat,
um sich dem Doktor vorzustellen, ein Hotel zu er-
blicken. Doch machte er sich keine Gedanken darüber
und klopfte Punkt zwei Uhr an dem bczeichneten
Zimmer an. Die Konsultation dauerte etwa eine
halbe Stunde und mit erleichtertem Herzen und
um zehn Mark erleichtertem Geldbeutel' verließ
Dauberich das Konsultationszimmer, eine Schachtel
Nasensalbe in der Tasche. Als er das Zimmer
berließ, kam eben eine Dame in den mittleren
Jahren, die offenbar gleichfalls den Dr. Blaudunst
konsultiren wollte, denn sie war ebenfalls mit einer
rothcn Nase ausgestattet, die aber gegen die Nase
Dauberichs als blaß verzollt werden konnte, wie
denn überhaupt Gesicht und Statur der Dame gar
sticht übel waren. Dauberich erkundigte sich nach
ihrem Namen und erfuhr, daß sie sich als Frau
Schulze aus Berlin ins Fremdenbuch eingeschrieben
hatte. Schade, dachte Dauberich, daß die verhei-
mlichet ist, die gäbe mir gewiß keinen Korb, denn
fit hat selber eine rothe Nase und wir könnten
miteinander eine neue Generation von Rothnasen
»> die Welt setzen. Während er seinen Kalbsbraten
verzehrte, trat auch die Dame ins Gastzimmer und
bestellte ein Essen. Der Wirth plazirte sie neben
Dauberich, dieser stellte sich vor und die Unterhal-
tung war bald eingefädelt. Auch des Abends leisteten
die beiden einander Gesellschaft, Dauberich war in
bester Laune, denn er sah sich schon im Besitz der
50 000-Mark-Witwe, er goß ein Glas ums andere
hinter die Binde und schimpfte weidlich über die
streikenden Buchdrucker, über die Sozialdemokraten
und die Arbeiter überhaupt. In seinem angehei-
terten Zustand bemerkte er nicht, wie mißfällig seine
Ergüsse von Frau Schulze ausgenommen wurden,
die sich denn auch bald mit einem kalten Gruße
empfahl. Einige Wochen waren vergangen, Dau-
berich hatte inzwischen seine Nase mit der Salbe
vorschriftsmäßig alle Nacht vor dem Schlafengehen
cingeschmiert, ohne daß die Nase um eine Nuance
blässer geworden wäre. Dabei hatte er auch die
Angelegenheit mit der 50000-Mark-Witwe eifrig
betrieben und mehrere Briefe an sie abgesendet.
Da erhielt er von ihr eines Tages folgenden Brief:
Geehrter Herr!
Durch eine seltsame Fügung haben wir uns
vor einigen Wochen in Leipzig persönlich kennen
gelernt. Sie foititten allerdings nicht wissen,
daß die Frau Schulze dieselbe Dame ist, welcher
Sie die Ehre erweisen wollen, sic zu Ihrer Ge-
mahlin zu erheben, sonst wären Sie vielleicht
in jener Abendunterhaltung nicht so offenherzig
gewesen. Ich kann Ihnen aber für Ihre Offen-
herzigkeit nur Dank wissen, da sie mir die Augen
geöffnet hat, bevor es zu spät war. Nicht der
Stempel, tvomit Gott Bacchus Ihr geehrtes
Antlitz gezeichnet hat, wie Sie selbst sagten, hätte
mich gehindert, Ihnen meine Hand zu reichen,
bin ich doch selbst in diesem Punkt Ihre Leidens-
genossin (was mich wie Sie nach Leipzig führte),
tviewohl keiner von allen Göttern des Trinkens
mit meinem Gesichtserker in irgend welchem Zu-
sammenhang steht. Was mir aber eine unüber-
windliche Abneigung gegen eine Verbindung mit
Ihnen einflößte, sind Ihre rohen Ansichten über
die Arbeiter. Wenn Sie noch wissen, wie ge-
ringschätzig und gehässig Sie über die im Gast-
zimmer anwesenden Arbeiter gesprochen haben,
so werden Sie begreifen, daß eine Frau, »velche
nach allem, was sic in ihrem vielbewegten Lebe»
erfahren hat, nur Achtung und Sympathie für
unsere wackeren Arbeiter hegen kau», sich nimmer-
mehr zu entschließen vermag, die Ihrige zu werden.
Ich habe auch öfters Gelegenheit gehabt, die
Erfahrung zu machen, daß Männer, welche von
den Arbeitern »»würdig denken, auch ihre Frauen
unwürdig behandeln. Indem ich Sie schließlich
bitte, mein Leipziger Inkognito mit der durch
die Sachlage erklärlichen weiblichen Scheu zu ent-
schuldigen, zeichne ich, unter definitivem Abbrltch
unserer Beziehungen
mit gebührender Hochachtung
Witwe Klarisse Schäfer.
Dauberich wurde kreideblaß vor Wuth, als er
■ diesen Brief las, sogar die Nase verfärbte sich etwas.
Da sein Lehrling nicht da tvar, um seinen Zorn
an ihm anszulassen, schrieb er einen wuthschnauben-
beu Brief an den l>r. Blaudunst, titulirte ihn
Betrüger und Schwindler, behauptete, die Salbe
sei ganz gewöhnliches Schweineschmalz, und drohte
ihm, ihn zu verklagen, wenn er ihm die 10 Mark
für die Nasensalbe und außerdem seine sämmtlichen
Spesen für die Leipziger Reise nicht sofort znrnck-
crstatten werde. Die Antwort erhielt er bald und
zwar von einem Dritten, dem angeblichen Rechts-
anwälte des Doktors. Sie lautete spöttisch und
herausfordernd. Der Doktor habe nur versprochen,
daß die Nase wieder ihre natürliche Farbe bekommen
werde, einen Zeitpunkt, wenn dies geschehen würde,
habe er nicht angegeben. Die natürliche Farbe
werde schon kommen, wenn er mit den täglichen Ein-
reibungen fortfährt, nur dürfe er die Geduld nicht
verlieren und wen» Jahre darüber verfließen sollten.
Dauberich ist noch immer Junggeselle und auch
seine Nase ist noch hochroth. Seine Freunde behaupten
sogar, sie wäre inzwischen noch röther geworden.