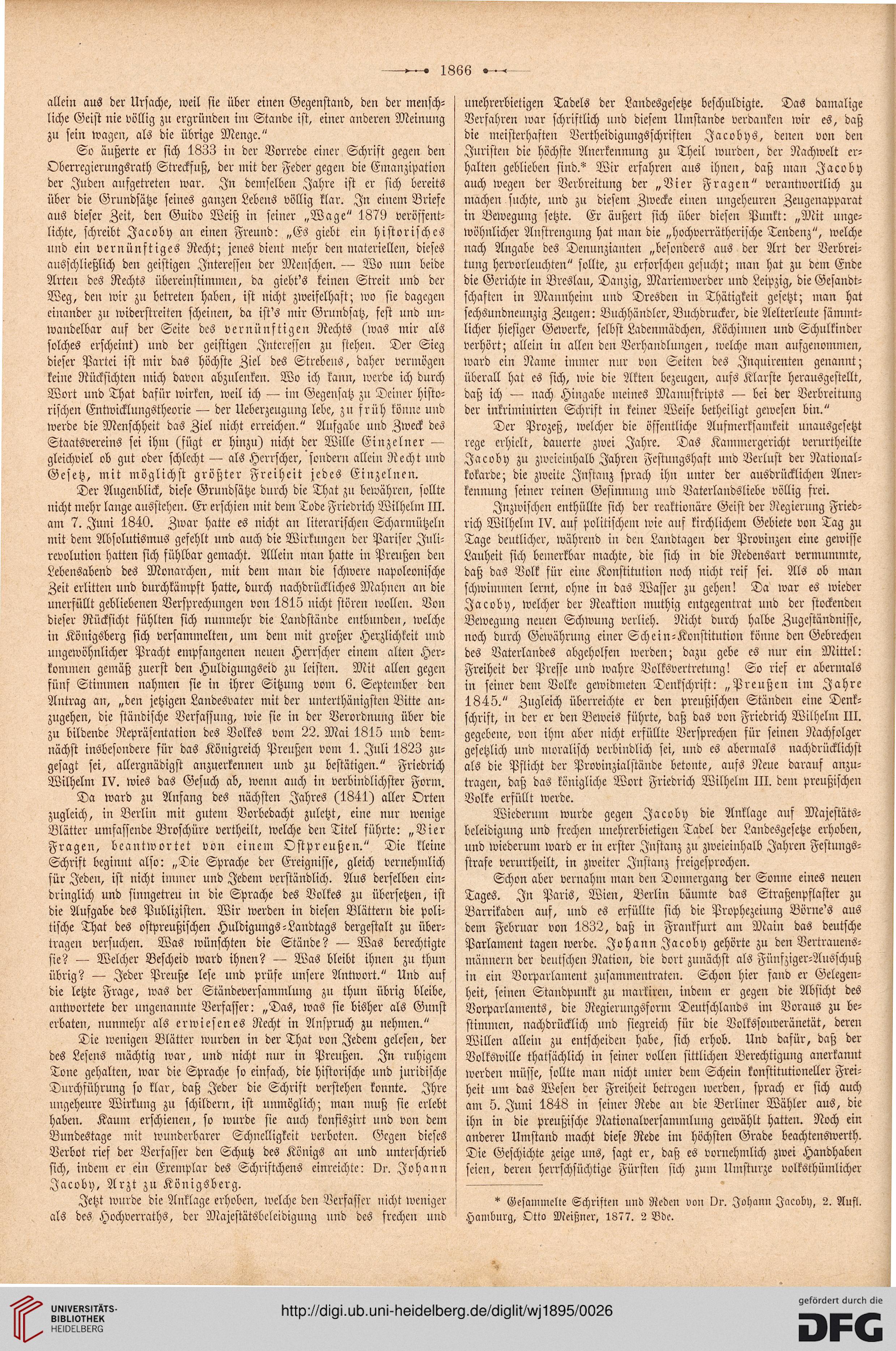1866
allein aus der Ursache, weil sie über einen Gegenstand, den der mensch-
liche Geist nie völlig zn ergründen int Stande ist, einer anderen Meinung
zu sein wagen, als die übrige Menge."
So äußerte er sich 1833 in der Vorrede einer Schrift gegen den
Oberregierungsrath Streckfuß, der mit der Feder gegen die Emanzipation
der Juden aufgetreten war. In demselben Jahre ist er sich bereits
über die Grundsätze seines ganzen Lebens völlig klar. In einem Briefe
aus dieser Zeit, den Guido Weiß in seiner „Wage" 1879 veröffent-
lichte, schreibt Jacoby an einen Freund: „Es giebt ein historisches
und ein vernünftiges Recht; jenes dient mehr den materiellen, dieses
ausschließlich den geistigen Interessen der Menschen. — Wo nun beide
Arten des Rechts übereinstimmen, da giebt's keinen Streit und der
Weg, den wir zu betreten haben, ist nicht zweifelhaft; wo sie dagegen
einander zu widerstreiten scheinen, da ist's mir Grundsatz, fest und un-
wandelbar auf der Seite des vernünftigen Rechts (was mir als
solches erscheint) und der geistigen Interessen zn stehen. Der Sieg
dieser Partei ist mir das höchste Ziel des Strebens, daher vermögen
keine Rücksichten mich davon abzulenken. Wo ich kann, werde ich durch
Wort und That dafür wirken, weil ich — im Gegensatz zu Deiner histo-
rischen Entwicklungstheorie — der Ueberzeugung lebe, zu früh könne und
werde die Menschheit das Ziel nicht erreichen." Aufgabe und Zweck des
Staatsvereins sei ihm (fügt er hinzu) nicht der Wille Einzelner —
gleichviel ob gut oder schlecht — als Herrscher, sondern allein Recht und
Gesetz, mit möglichst größter Freiheit jedes Einzelnen.
Der Augenblick, diese Grundsätze durch die That zn bewähren, sollte
nicht mehr lange ausstehen. Er erschien mit dem Tode Friedrich Wilhelm III.
am 7. Juni 1840. Zwar hatte es nicht an literarischen Scharmützeln
mit dem Absolutismus gefehlt und auch die Wirkungen der Pariser Juli-
revolution hatten sich fühlbar gemacht. Allein man hatte in Preußen den
Lebensabend des Monarchen, mit dem man die schwere napoleonische
Zeit erlitten und durchkämpft hatte, durch nachdrückliches Mahnen an die
unerfüllt gebliebenen Versprechungen von 1815 nicht stören wollen. Von
dieser Rücksicht fühlten sich nunmehr die Landstände entbunden, welche
in Königsberg sich versammelten, um dem mit großer Herzlichkeit mrd
ungewöhnlicher Pracht empfangenen neuen Herrscher einem alten Her-
kommen gemäß zuerst den Huldigungseid zu leisten. Mit allen gegen
fünf Stimmen nahmen sie in ihrer Sitzung vom 6. September den
Antrag an, „den jetzigen Landesvater mit der nnterthänigsten Bitte an-
zugehen, die stäirdische Verfassuirg, wie sie in der Verordnung über die
zu bildende Repräsentation des Volkes vom 22. Mai 1815 und dem-
nächst insbesondere für das Königreich Preußen vom 1. Juli 1823 zu-
gesagt sei, allergnädigst anzuerkennen und zu bestätigen." Friedrich
Wilhelm IV. wies das Gesuch ab, wenn auch in verbindlichster Form.
Da ward zu Anfang des nächsten Jahres (1841) aller Orten
zugleich, in Berlin mit gutem Vorbedacht zuletzt, eine nur wenige
Blätter umfassende Broschüre vertheilt, welche den Titel führte: „Vier
Fragen, beantwortet von einem Ostpreußen." Die kleine
Schrift beginnt also: „Die Sprache der Ereignisse, gleich vernehmlich
für Jeden, ist nicht immer und Jedem verständlich. Aus derselben ein-
dringlich und sinngetreu in die Sprache des Volkes zn übersetze,:, ist
die Aufgabe des Publizisten. Wir werden in diesen Blättern die poli-
tische That des ostpreußischen Huldigungs-Landtags dergestalt zu über-
tragen versuchen. Was wünschten die Stände? — Was berechtigte
sie? — Welcher Bescheid ward ihnen? — Was bleibt ihnen zu thun
übrig? — Jeder Preuße lese und prüfe unsere Antwort." Und auf
die letzte Frage, was der Ständeversammlung zu thun übrig bleibe,
antwortete der ungenannte Verfasser: „Das, was sie bisher als Gunst
erbaten, nunmehr als erwiesenes Recht in Anspruch zu nehmen."
Die wenigen Blätter wurden in der That von Jedem gelesen, der
des Lesens mächtig war, und nicht nur in Preußen. In ruhigem
Tone gehalten, war die Sprache so einfach, die historische und juridische
Durchführung so klar, daß Jeder die Schrift verstehen konnte. Ihre
ungeheure Wirkung zu schildern, ist unmöglich; man muß sie erlebt
haben. Kaum erschienen, so wurde sie auch konfiszirt und von dem
Bundestage mit wunderbarer Schnelligkeit verboten. Gegen dieses
Verbot rief der Verfasser den Schutz des Königs an und unterschrieb
sich, indem er ein Eremplar des Schriftchens einreichte: vr. Johann
Jacoby, Arzt zu Königsberg.
Jetzt wurde die Anklage erhoben, welche den Verfasser nicht weniger
als des Hochverrathö, der Majestätsbeleidigung und des frechen und
unehrerbietigen Tadels der Landesgesetze beschuldigte. Das damalige
Verfahren war schriftlich und diesem Umstande verdanken wir cs, daß
die meisterhaften Vcrtheidigungsschriften Jacobys, denen von den
Juristen die höchste Anerkennung zu Theil wurden, der Nachwelt er-
halten geblieben sind? Wir erfahren aus ihnen, daß man Jacoby
auch wegen der Verbreitung der „Vier Fragen" verantwortlich zu
machen suchte, und zu diesem Zwecke einen ungeheuren Zeugenapparat
in Bewegung setzte. Er äußert sich über diesen Punkt: „Mit unge-
wöhnlicher Anstrengung hat man die „hochverrätherische Tendenz", welche
nach Angabe des Denunzianten „besonders aus der Art der Verbrei-
tung hervorleuchten" sollte, zu erforschen gesucht; man hat zu dem Ende
die Gerichte in Breslau, Danzig, Marienwerder und Leipzig, die Gesandt-
schaften in Mannheim und Dresden in Thätigkeit gesetzt; nran hat
sechsundneunzig Zeugen: Buchhändler, Buchdrucker, die Aelterleute sämmt-
licher hiesiger Gewerke, selbst Ladenmädchen, Köchinnen und Schulkinder
verhört; allein in alle:: den Verhandlungen, welche man ausgenommen,
ward ein Name immer nur von Seiten des Inquirenten genannt;
überall hat es sich, wie die Akten bezeugen, aufs Klarste herausgestellt,
daß ich — nach Hingabe meines Manuskripts — bei der Verbreitung
der inkriminirten Schrift in keiner Weise betheiligt gewesen bin."
Der Prozeß, welcher die öffentliche Aufmerksamkeit unausgesetzt
rege erhielt, dauerte zwei Jahre. Das Kammergericht verurtheilte
Jacoby zu zweieinhalb Jahren Festungshaft und Verlust der National-
kokarde; die zweite Instanz sprach ihn unter der ausdrücklichen Aner-
kennung seiner reinen Gesinnung und Vaterlandsliebe völlig frei.
Inzwischen enthüllte sich der reaktionäre Geist der Negierung Fried-
rich Wilhelm IV. auf politischem wie auf kirchlichem Gebiete von Tag zu
Tage deutlicher, während in den Landtagen der Provinzen eine gewisse
Lauheit sich bemerkbar machte, die sich in die Redensart vermummte,
daß das Volk für eine Konstitution noch nicht reif sei. Als ob man
schwimmen lernt, ohne in das Wasser zu gehen! Da war es wieder
Jacoby, welcher der Reaktion muthig cntgegentrat und der stockenden
Bctvegung neuen Schwung verlieh. Nicht durch halbe Zugeständnisse,
noch durch Gewährung einer Schein-Konstitutton könne den Gebrechei:
des Vaterlandes abgeholfen werden; dazu gebe es nur ein Mittel:
Freiheit der Presse und wahre Volksvertretung! So rief er abermals
in seiner dem Volke gewidmeten Denkschrift: „Preußen im Jahre
1845." Zugleich überreichte er den preußischen Ständen eine Denk-
schrift, in der er den Beweis führte, daß das von Friedrich Wilhelm III.
gegebene, von ihm aber nicht erfüllte Versprechen für seinen Nachfolger
gesetzlich und moralisch verbindlich sei, und es abermals nachdrücklichst
als die Pflicht der Provinzialstände betonte, aufs Neue darauf anzu-
tragcn, daß das königliche Wort Friedrich Wilhelm III. dem preußischen
Volke erfüllt werde.
Wiederum wurde gegen Jacoby die Anklage auf Majestäts-
beleidigung und frechen unehrerbietigen Tadel der Landesgesetze erhoben,
und wiederum ward er in erster Instanz zu zweieinhalb Jahren Festungs-
strafe verurtheilt, in zweiter Instanz frcigesprochen.
Schon aber vernahm man den Donnergang der Sonne eines neuen
Tages. In Paris, Wien, Berlin bäumte das Straßenpflaster zn
Barrikaden ans, und es erfüllte sich die Prophezeiung Börne's aus
dem Februar von 1832, daß in Frankfurt am Main das deutsche
Parlament tagen werde. Johann Jacoby gehörte zu den Vertrauens-
männern der deutschen Nation, die dort zunächst alö Fünfziger-Ausschuß
in ein Vorparlament zusammentraten. Schon hier fand er Gelegen-
heit, seinen Standpunkt zu markiren, indem er gegen die Absicht des
Vorparlaments, die Regierungsform Deutschlands im Voraus zu be-
stimmen, nachdrücklich und siegreich für die Volkssouveränetät, deren
Willen allein zu entscheiden habe, sich erhob. Und dafür, daß der
Volkswille thatsächlich in seiner vollen sittlichen Berechtigung anerkannt
werden müsse, sollte man nicht unter dem Schein konstitutioneller Frei-
heit um das Wesen der Freiheit betrogen werden, sprach er sich auch
am 5. Juni 1848 in seiner Rede an die Berliner Wähler aus, die
ihn in die preußische Nationalversammlung gewählt hatten. Noch ein
anderer Umstand macht diese Rede in: höchsten Grade beachtenswerth.
Die Geschichte zeige uns, sagt er, daß es vornehmlich zwei Handhaben
seien, deren herrschsüchtige Fürsten sich zum Umstürze volksthümlicher *
* Gesammelte Schriften und Reden von Or. Johann Jacoby, 2. Auch
Hamburg, Otto Meißner, 1877. 2 Bdc.
allein aus der Ursache, weil sie über einen Gegenstand, den der mensch-
liche Geist nie völlig zn ergründen int Stande ist, einer anderen Meinung
zu sein wagen, als die übrige Menge."
So äußerte er sich 1833 in der Vorrede einer Schrift gegen den
Oberregierungsrath Streckfuß, der mit der Feder gegen die Emanzipation
der Juden aufgetreten war. In demselben Jahre ist er sich bereits
über die Grundsätze seines ganzen Lebens völlig klar. In einem Briefe
aus dieser Zeit, den Guido Weiß in seiner „Wage" 1879 veröffent-
lichte, schreibt Jacoby an einen Freund: „Es giebt ein historisches
und ein vernünftiges Recht; jenes dient mehr den materiellen, dieses
ausschließlich den geistigen Interessen der Menschen. — Wo nun beide
Arten des Rechts übereinstimmen, da giebt's keinen Streit und der
Weg, den wir zu betreten haben, ist nicht zweifelhaft; wo sie dagegen
einander zu widerstreiten scheinen, da ist's mir Grundsatz, fest und un-
wandelbar auf der Seite des vernünftigen Rechts (was mir als
solches erscheint) und der geistigen Interessen zn stehen. Der Sieg
dieser Partei ist mir das höchste Ziel des Strebens, daher vermögen
keine Rücksichten mich davon abzulenken. Wo ich kann, werde ich durch
Wort und That dafür wirken, weil ich — im Gegensatz zu Deiner histo-
rischen Entwicklungstheorie — der Ueberzeugung lebe, zu früh könne und
werde die Menschheit das Ziel nicht erreichen." Aufgabe und Zweck des
Staatsvereins sei ihm (fügt er hinzu) nicht der Wille Einzelner —
gleichviel ob gut oder schlecht — als Herrscher, sondern allein Recht und
Gesetz, mit möglichst größter Freiheit jedes Einzelnen.
Der Augenblick, diese Grundsätze durch die That zn bewähren, sollte
nicht mehr lange ausstehen. Er erschien mit dem Tode Friedrich Wilhelm III.
am 7. Juni 1840. Zwar hatte es nicht an literarischen Scharmützeln
mit dem Absolutismus gefehlt und auch die Wirkungen der Pariser Juli-
revolution hatten sich fühlbar gemacht. Allein man hatte in Preußen den
Lebensabend des Monarchen, mit dem man die schwere napoleonische
Zeit erlitten und durchkämpft hatte, durch nachdrückliches Mahnen an die
unerfüllt gebliebenen Versprechungen von 1815 nicht stören wollen. Von
dieser Rücksicht fühlten sich nunmehr die Landstände entbunden, welche
in Königsberg sich versammelten, um dem mit großer Herzlichkeit mrd
ungewöhnlicher Pracht empfangenen neuen Herrscher einem alten Her-
kommen gemäß zuerst den Huldigungseid zu leisten. Mit allen gegen
fünf Stimmen nahmen sie in ihrer Sitzung vom 6. September den
Antrag an, „den jetzigen Landesvater mit der nnterthänigsten Bitte an-
zugehen, die stäirdische Verfassuirg, wie sie in der Verordnung über die
zu bildende Repräsentation des Volkes vom 22. Mai 1815 und dem-
nächst insbesondere für das Königreich Preußen vom 1. Juli 1823 zu-
gesagt sei, allergnädigst anzuerkennen und zu bestätigen." Friedrich
Wilhelm IV. wies das Gesuch ab, wenn auch in verbindlichster Form.
Da ward zu Anfang des nächsten Jahres (1841) aller Orten
zugleich, in Berlin mit gutem Vorbedacht zuletzt, eine nur wenige
Blätter umfassende Broschüre vertheilt, welche den Titel führte: „Vier
Fragen, beantwortet von einem Ostpreußen." Die kleine
Schrift beginnt also: „Die Sprache der Ereignisse, gleich vernehmlich
für Jeden, ist nicht immer und Jedem verständlich. Aus derselben ein-
dringlich und sinngetreu in die Sprache des Volkes zn übersetze,:, ist
die Aufgabe des Publizisten. Wir werden in diesen Blättern die poli-
tische That des ostpreußischen Huldigungs-Landtags dergestalt zu über-
tragen versuchen. Was wünschten die Stände? — Was berechtigte
sie? — Welcher Bescheid ward ihnen? — Was bleibt ihnen zu thun
übrig? — Jeder Preuße lese und prüfe unsere Antwort." Und auf
die letzte Frage, was der Ständeversammlung zu thun übrig bleibe,
antwortete der ungenannte Verfasser: „Das, was sie bisher als Gunst
erbaten, nunmehr als erwiesenes Recht in Anspruch zu nehmen."
Die wenigen Blätter wurden in der That von Jedem gelesen, der
des Lesens mächtig war, und nicht nur in Preußen. In ruhigem
Tone gehalten, war die Sprache so einfach, die historische und juridische
Durchführung so klar, daß Jeder die Schrift verstehen konnte. Ihre
ungeheure Wirkung zu schildern, ist unmöglich; man muß sie erlebt
haben. Kaum erschienen, so wurde sie auch konfiszirt und von dem
Bundestage mit wunderbarer Schnelligkeit verboten. Gegen dieses
Verbot rief der Verfasser den Schutz des Königs an und unterschrieb
sich, indem er ein Eremplar des Schriftchens einreichte: vr. Johann
Jacoby, Arzt zu Königsberg.
Jetzt wurde die Anklage erhoben, welche den Verfasser nicht weniger
als des Hochverrathö, der Majestätsbeleidigung und des frechen und
unehrerbietigen Tadels der Landesgesetze beschuldigte. Das damalige
Verfahren war schriftlich und diesem Umstande verdanken wir cs, daß
die meisterhaften Vcrtheidigungsschriften Jacobys, denen von den
Juristen die höchste Anerkennung zu Theil wurden, der Nachwelt er-
halten geblieben sind? Wir erfahren aus ihnen, daß man Jacoby
auch wegen der Verbreitung der „Vier Fragen" verantwortlich zu
machen suchte, und zu diesem Zwecke einen ungeheuren Zeugenapparat
in Bewegung setzte. Er äußert sich über diesen Punkt: „Mit unge-
wöhnlicher Anstrengung hat man die „hochverrätherische Tendenz", welche
nach Angabe des Denunzianten „besonders aus der Art der Verbrei-
tung hervorleuchten" sollte, zu erforschen gesucht; man hat zu dem Ende
die Gerichte in Breslau, Danzig, Marienwerder und Leipzig, die Gesandt-
schaften in Mannheim und Dresden in Thätigkeit gesetzt; nran hat
sechsundneunzig Zeugen: Buchhändler, Buchdrucker, die Aelterleute sämmt-
licher hiesiger Gewerke, selbst Ladenmädchen, Köchinnen und Schulkinder
verhört; allein in alle:: den Verhandlungen, welche man ausgenommen,
ward ein Name immer nur von Seiten des Inquirenten genannt;
überall hat es sich, wie die Akten bezeugen, aufs Klarste herausgestellt,
daß ich — nach Hingabe meines Manuskripts — bei der Verbreitung
der inkriminirten Schrift in keiner Weise betheiligt gewesen bin."
Der Prozeß, welcher die öffentliche Aufmerksamkeit unausgesetzt
rege erhielt, dauerte zwei Jahre. Das Kammergericht verurtheilte
Jacoby zu zweieinhalb Jahren Festungshaft und Verlust der National-
kokarde; die zweite Instanz sprach ihn unter der ausdrücklichen Aner-
kennung seiner reinen Gesinnung und Vaterlandsliebe völlig frei.
Inzwischen enthüllte sich der reaktionäre Geist der Negierung Fried-
rich Wilhelm IV. auf politischem wie auf kirchlichem Gebiete von Tag zu
Tage deutlicher, während in den Landtagen der Provinzen eine gewisse
Lauheit sich bemerkbar machte, die sich in die Redensart vermummte,
daß das Volk für eine Konstitution noch nicht reif sei. Als ob man
schwimmen lernt, ohne in das Wasser zu gehen! Da war es wieder
Jacoby, welcher der Reaktion muthig cntgegentrat und der stockenden
Bctvegung neuen Schwung verlieh. Nicht durch halbe Zugeständnisse,
noch durch Gewährung einer Schein-Konstitutton könne den Gebrechei:
des Vaterlandes abgeholfen werden; dazu gebe es nur ein Mittel:
Freiheit der Presse und wahre Volksvertretung! So rief er abermals
in seiner dem Volke gewidmeten Denkschrift: „Preußen im Jahre
1845." Zugleich überreichte er den preußischen Ständen eine Denk-
schrift, in der er den Beweis führte, daß das von Friedrich Wilhelm III.
gegebene, von ihm aber nicht erfüllte Versprechen für seinen Nachfolger
gesetzlich und moralisch verbindlich sei, und es abermals nachdrücklichst
als die Pflicht der Provinzialstände betonte, aufs Neue darauf anzu-
tragcn, daß das königliche Wort Friedrich Wilhelm III. dem preußischen
Volke erfüllt werde.
Wiederum wurde gegen Jacoby die Anklage auf Majestäts-
beleidigung und frechen unehrerbietigen Tadel der Landesgesetze erhoben,
und wiederum ward er in erster Instanz zu zweieinhalb Jahren Festungs-
strafe verurtheilt, in zweiter Instanz frcigesprochen.
Schon aber vernahm man den Donnergang der Sonne eines neuen
Tages. In Paris, Wien, Berlin bäumte das Straßenpflaster zn
Barrikaden ans, und es erfüllte sich die Prophezeiung Börne's aus
dem Februar von 1832, daß in Frankfurt am Main das deutsche
Parlament tagen werde. Johann Jacoby gehörte zu den Vertrauens-
männern der deutschen Nation, die dort zunächst alö Fünfziger-Ausschuß
in ein Vorparlament zusammentraten. Schon hier fand er Gelegen-
heit, seinen Standpunkt zu markiren, indem er gegen die Absicht des
Vorparlaments, die Regierungsform Deutschlands im Voraus zu be-
stimmen, nachdrücklich und siegreich für die Volkssouveränetät, deren
Willen allein zu entscheiden habe, sich erhob. Und dafür, daß der
Volkswille thatsächlich in seiner vollen sittlichen Berechtigung anerkannt
werden müsse, sollte man nicht unter dem Schein konstitutioneller Frei-
heit um das Wesen der Freiheit betrogen werden, sprach er sich auch
am 5. Juni 1848 in seiner Rede an die Berliner Wähler aus, die
ihn in die preußische Nationalversammlung gewählt hatten. Noch ein
anderer Umstand macht diese Rede in: höchsten Grade beachtenswerth.
Die Geschichte zeige uns, sagt er, daß es vornehmlich zwei Handhaben
seien, deren herrschsüchtige Fürsten sich zum Umstürze volksthümlicher *
* Gesammelte Schriften und Reden von Or. Johann Jacoby, 2. Auch
Hamburg, Otto Meißner, 1877. 2 Bdc.