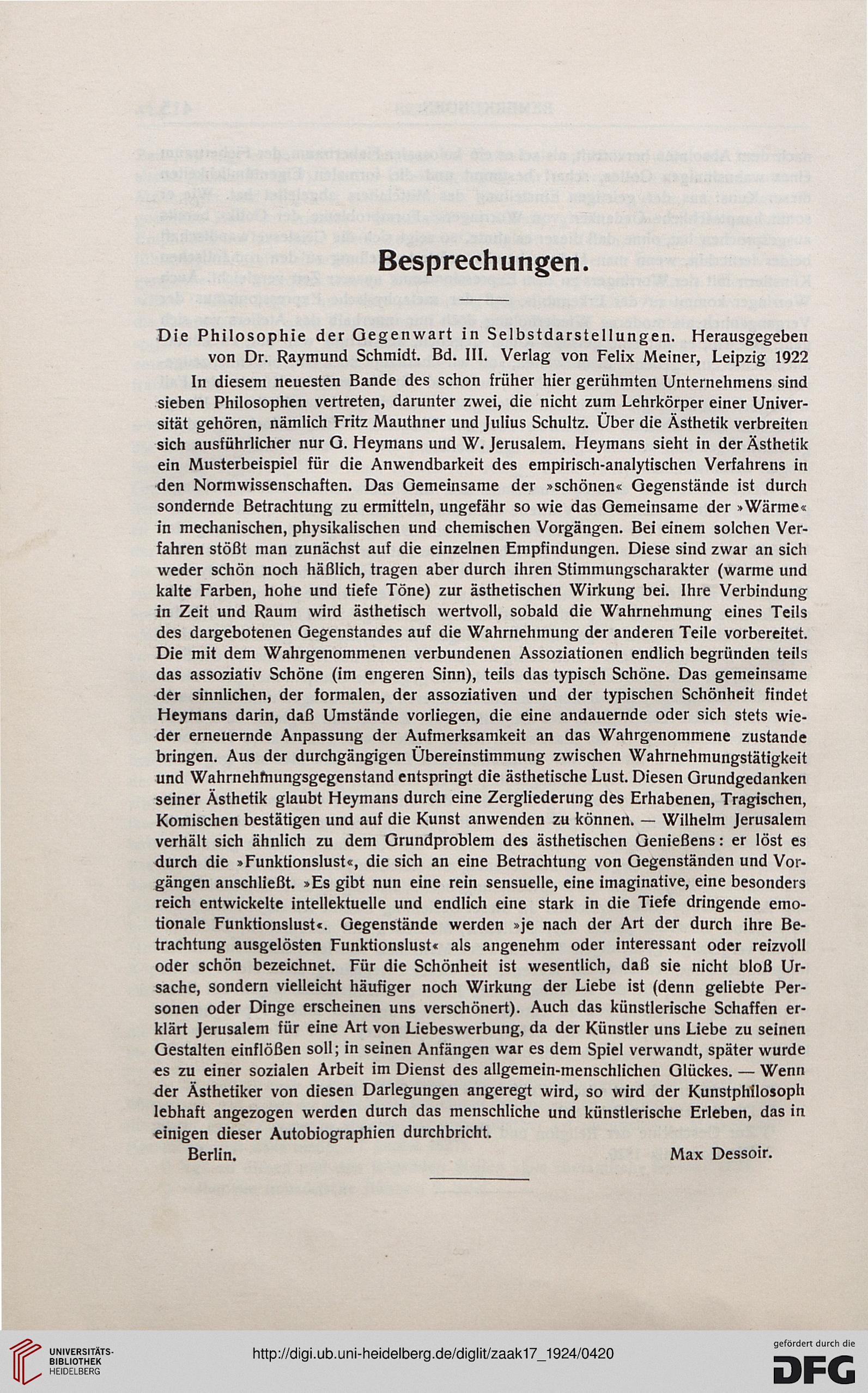Besprechungen.
Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Herausgegeben
von Dr. Raymund Schmidt. Bd. III. Verlag von Felix Meiner, Leipzig 1922
In diesem neuesten Bande des schon früher hier gerühmten Unternehmens sind
sieben Philosophen vertreten, darunter zwei, die nicht zum Lehrkörper einer Univer-
sität gehören, nämlich Fritz Mauthner und Julius Schultz. Über die Ästhetik verbreiten
sich ausführlicher nur G. Heymans und W. Jerusalem. Heymans sieht in der Ästhetik
ein Musterbeispiel für die Anwendbarkeit des empirisch-analytischen Verfahrens in
den Normwissenschaften. Das Gemeinsame der »schönen« Gegenstände ist durch
sondernde Betrachtung zu ermitteln, ungefähr so wie das Gemeinsame der »Wärme«
in mechanischen, physikalischen und chemischen Vorgängen. Bei einem solchen Ver-
fahren stößt man zunächst auf die einzelnen Empfindungen. Diese sind zwar an sich
weder schön noch häßlich, tragen aber durch ihren Stimmungscharakter (warme und
kalte Farben, hohe und tiefe Töne) zur ästhetischen Wirkung bei. Ihre Verbindung
in Zeit und Raum wird ästhetisch wertvoll, sobald die Wahrnehmung eines Teils
des dargebotenen Gegenstandes auf die Wahrnehmung der anderen Teile vorbereitet.
Die mit dem Wahrgenommenen verbundenen Assoziationen endlich begründen teils
das assoziativ Schöne (im engeren Sinn), teils das typisch Schöne. Das gemeinsame
der sinnlichen, der formalen, der assoziativen und der typischen Schönheit findet
Heymans darin, daß Umstände vorliegen, die eine andauernde oder sich stets wie-
der erneuernde Anpassung der Aufmerksamkeit an das Wahrgenommene zustande
bringen. Aus der durchgängigen Übereinstimmung zwischen Wahrnehmungstätigkeit
und Wahrnehfnungsgegenstand entspringt die ästhetische Lust. Diesen Grundgedanken
seiner Ästhetik glaubt Heymans durch eine Zergliederung des Erhabenen, Tragischen,
Komischen bestätigen und auf die Kunst anwenden zu können. — Wilhelm Jerusalem
verhält sich ähnlich zu dem Grundproblem des ästhetischen Genießens: er löst es
durch die »Funktionslust«, die sich an eine Betrachtung von Gegenständen und Vor-
gängen anschließt. »Es gibt nun eine rein sensuelle, eine imaginative, eine besonders
reich entwickelte intellektuelle und endlich eine stark in die Tiefe dringende emo-
tionale Funktionslust«. Gegenstände werden »je nach der Art der durch ihre Be-
trachtung ausgelösten Funktionslust« als angenehm oder interessant oder reizvoll
oder schön bezeichnet. Für die Schönheit ist wesentlich, daß sie nicht bloß Ur-
sache, sondern vielleicht häufiger noch Wirkung der Liebe ist (denn geliebte Per-
sonen oder Dinge erscheinen uns verschönert). Auch das künstlerische Schaffen er-
klärt Jerusalem für eine Art von Liebeswerbung, da der Künstler uns Liebe zu seinen
Gestalten einflößen soll; in seinen Anfängen war es dem Spiel verwandt, später wurde
es zu einer sozialen Arbeit im Dienst des allgemein-menschlichen Glückes. — Wenn
der Ästhetiker von diesen Darlegungen angeregt wird, so wird der Kunstphilosoph
lebhaft angezogen werden durch das menschliche und künstlerische Erleben, das in
einigen dieser Autobiographien durchbricht.
Berlin. Max Dessoir.
Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Herausgegeben
von Dr. Raymund Schmidt. Bd. III. Verlag von Felix Meiner, Leipzig 1922
In diesem neuesten Bande des schon früher hier gerühmten Unternehmens sind
sieben Philosophen vertreten, darunter zwei, die nicht zum Lehrkörper einer Univer-
sität gehören, nämlich Fritz Mauthner und Julius Schultz. Über die Ästhetik verbreiten
sich ausführlicher nur G. Heymans und W. Jerusalem. Heymans sieht in der Ästhetik
ein Musterbeispiel für die Anwendbarkeit des empirisch-analytischen Verfahrens in
den Normwissenschaften. Das Gemeinsame der »schönen« Gegenstände ist durch
sondernde Betrachtung zu ermitteln, ungefähr so wie das Gemeinsame der »Wärme«
in mechanischen, physikalischen und chemischen Vorgängen. Bei einem solchen Ver-
fahren stößt man zunächst auf die einzelnen Empfindungen. Diese sind zwar an sich
weder schön noch häßlich, tragen aber durch ihren Stimmungscharakter (warme und
kalte Farben, hohe und tiefe Töne) zur ästhetischen Wirkung bei. Ihre Verbindung
in Zeit und Raum wird ästhetisch wertvoll, sobald die Wahrnehmung eines Teils
des dargebotenen Gegenstandes auf die Wahrnehmung der anderen Teile vorbereitet.
Die mit dem Wahrgenommenen verbundenen Assoziationen endlich begründen teils
das assoziativ Schöne (im engeren Sinn), teils das typisch Schöne. Das gemeinsame
der sinnlichen, der formalen, der assoziativen und der typischen Schönheit findet
Heymans darin, daß Umstände vorliegen, die eine andauernde oder sich stets wie-
der erneuernde Anpassung der Aufmerksamkeit an das Wahrgenommene zustande
bringen. Aus der durchgängigen Übereinstimmung zwischen Wahrnehmungstätigkeit
und Wahrnehfnungsgegenstand entspringt die ästhetische Lust. Diesen Grundgedanken
seiner Ästhetik glaubt Heymans durch eine Zergliederung des Erhabenen, Tragischen,
Komischen bestätigen und auf die Kunst anwenden zu können. — Wilhelm Jerusalem
verhält sich ähnlich zu dem Grundproblem des ästhetischen Genießens: er löst es
durch die »Funktionslust«, die sich an eine Betrachtung von Gegenständen und Vor-
gängen anschließt. »Es gibt nun eine rein sensuelle, eine imaginative, eine besonders
reich entwickelte intellektuelle und endlich eine stark in die Tiefe dringende emo-
tionale Funktionslust«. Gegenstände werden »je nach der Art der durch ihre Be-
trachtung ausgelösten Funktionslust« als angenehm oder interessant oder reizvoll
oder schön bezeichnet. Für die Schönheit ist wesentlich, daß sie nicht bloß Ur-
sache, sondern vielleicht häufiger noch Wirkung der Liebe ist (denn geliebte Per-
sonen oder Dinge erscheinen uns verschönert). Auch das künstlerische Schaffen er-
klärt Jerusalem für eine Art von Liebeswerbung, da der Künstler uns Liebe zu seinen
Gestalten einflößen soll; in seinen Anfängen war es dem Spiel verwandt, später wurde
es zu einer sozialen Arbeit im Dienst des allgemein-menschlichen Glückes. — Wenn
der Ästhetiker von diesen Darlegungen angeregt wird, so wird der Kunstphilosoph
lebhaft angezogen werden durch das menschliche und künstlerische Erleben, das in
einigen dieser Autobiographien durchbricht.
Berlin. Max Dessoir.