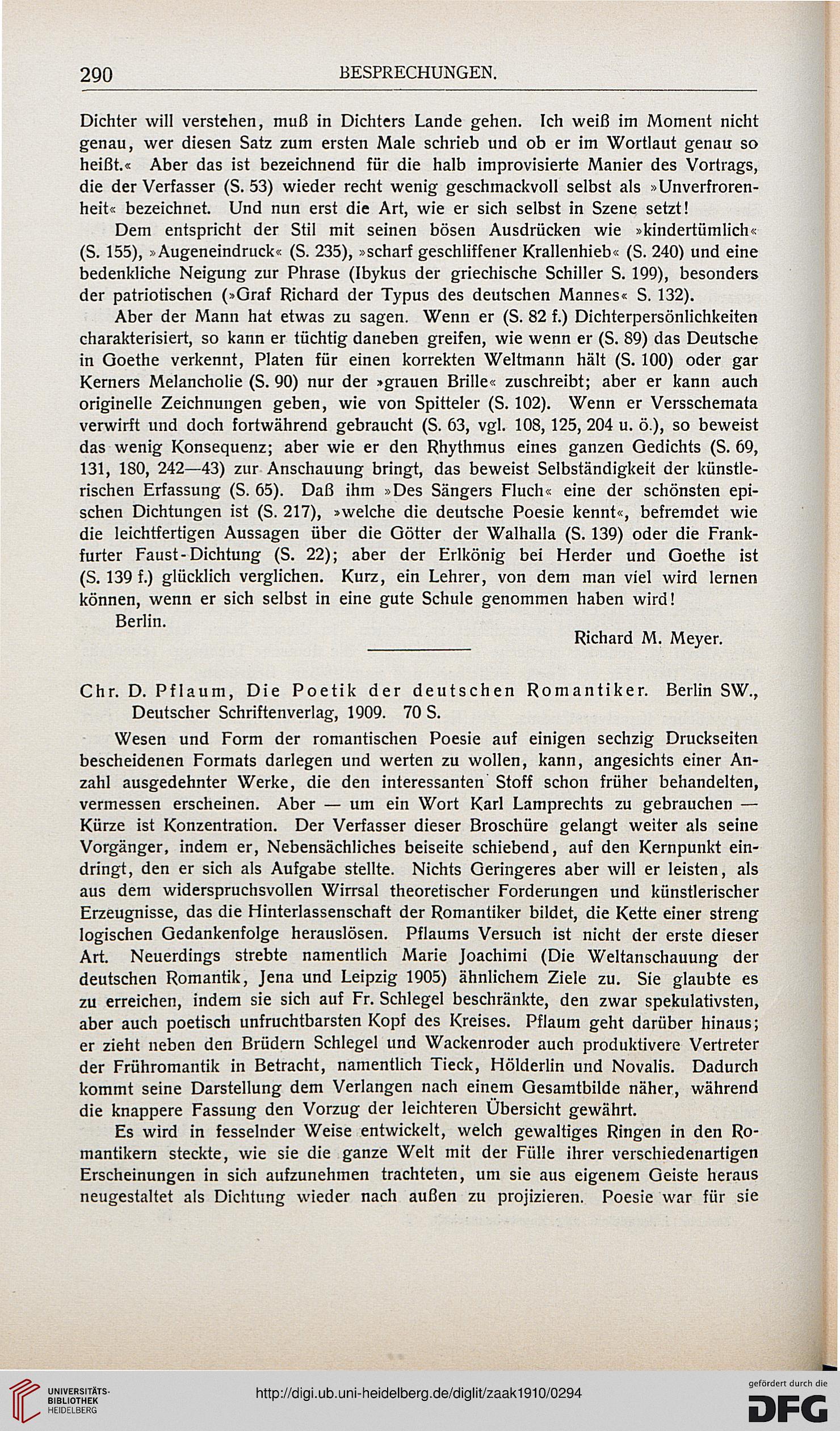290 BESPRECHUNGEN.
Dichter will verstehen, muß in Dichters Lande gehen. Ich weiß im Moment nicht
genau, wer diesen Satz zum ersten Male schrieb und ob er im Wortlaut genau so
heißt.« Aber das ist bezeichnend für die halb improvisierte Manier des Vortrags,
die der Verfasser (S. 53) wieder recht wenig geschmackvoll selbst als »Unverfroren-
heit« bezeichnet. Und nun erst die Art, wie er sich selbst in Szene setzt!
Dem entspricht der Stil mit seinen bösen Ausdrücken wie »kindertümlich«
(S. 155), »Augeneindruck« (S. 235), »scharf geschliffener Krallenhieb« (S. 240) und eine
bedenkliche Neigung zur Phrase (Ibykus der griechische Schiller S. 199), besonders
der patriotischen (»Graf Richard der Typus des deutschen Mannes« S. 132).
Aber der Mann hat etwas zu sagen. Wenn er (S. 82 f.) Dichterpersönlichkeiten
charakterisiert, so kann er tüchtig daneben greifen, wie wenn er (S. 89) das Deutsche
in Goethe verkennt, Platen für einen korrekten Weltmann hält (S. 100) oder gar
Kerners Melancholie (S. 90) nur der >grauen Brille« zuschreibt; aber er kann auch
originelle Zeichnungen geben, wie von Spitteler (S. 102). Wenn er Versschemata
verwirft und doch fortwährend gebraucht (S. 63, vgl. 108, 125, 204 u. ö), so beweist
das wenig Konsequenz; aber wie er den Rhythmus eines ganzen Gedichts (S. 69,
131, 180, 242—43) zur Anschauung bringt, das beweist Selbständigkeit der künstle-
rischen Erfassung (S. 65). Daß ihm »Des Sängers Fluch« eine der schönsten epi-
schen Dichtungen ist (S. 217), »welche die deutsche Poesie kennt«, befremdet wie
die leichtfertigen Aussagen über die Götter der Walhalla (S. 139) oder die Frank-
furter Faust-Dichtung (S. 22); aber der Erlkönig bei Herder und Goethe ist
(S. 139 f.) glücklich verglichen. Kurz, ein Lehrer, von dem man viel wird lernen
können, wenn er sich selbst in eine gute Schule genommen haben wird!
Berlin.
Richard M. Meyer.
Chr. D. Pflaum, Die Poetik der deutschen Romantiker. Berlin SW.,
Deutscher Schriftenverlag, 1909. 70 S.
Wesen und Form der romantischen Poesie auf einigen sechzig Druckseiten
bescheidenen Formats darlegen und werten zu wollen, kann, angesichts einer An-
zahl ausgedehnter Werke, die den interessanten Stoff schon früher behandelten,
vermessen erscheinen. Aber — um ein Wort Karl Lamprechts zu gebrauchen —
Kürze ist Konzentration. Der Verfasser dieser Broschüre gelangt weiter als seine
Vorgänger, indem er, Nebensächliches beiseite schiebend, auf den Kernpunkt ein-
dringt, den er sich als Aufgabe stellte. Nichts Geringeres aber will er leisten, als
aus dem widerspruchsvollen Wirrsal theoretischer Forderungen und künstlerischer
Erzeugnisse, das die Hinterlassenschaft der Romantiker bildet, die Kette einer streng
logischen Gedankenfolge herauslösen. Pflaums Versuch ist nicht der erste dieser
Art. Neuerdings strebte namentlich Marie Joachimi (Die Weltanschauung der
deutschen Romantik, Jena und Leipzig 1905) ähnlichem Ziele zu. Sie glaubte es
zu erreichen, indem sie sich auf Fr. Schlegel beschränkte, den zwar spekulativsten,
aber auch poetisch unfruchtbarsten Kopf des Kreises. Pflaum geht darüber hinaus;
er zieht neben den Brüdern Schlegel und Wackenroder auch produktivere Vertreter
der Frühromantik in Betracht, namentlich Tieck, Hölderlin und Novalis. Dadurch
kommt seine Darstellung dem Verlangen nach einem Gesamtbilde näher, während
die knappere Fassung den Vorzug der leichteren Übersicht gewährt.
Es wird in fesselnder Weise entwickelt, welch gewaltiges Ringen in den Ro-
mantikern steckte, wie sie die ganze Welt mit der Fülle ihrer verschiedenartigen
Erscheinungen in sich aufzunehmen trachteten, um sie aus eigenem Geiste heraus
neugestaltet als Dichtung wieder nach außen zu projizieren. Poesie war für sie
Dichter will verstehen, muß in Dichters Lande gehen. Ich weiß im Moment nicht
genau, wer diesen Satz zum ersten Male schrieb und ob er im Wortlaut genau so
heißt.« Aber das ist bezeichnend für die halb improvisierte Manier des Vortrags,
die der Verfasser (S. 53) wieder recht wenig geschmackvoll selbst als »Unverfroren-
heit« bezeichnet. Und nun erst die Art, wie er sich selbst in Szene setzt!
Dem entspricht der Stil mit seinen bösen Ausdrücken wie »kindertümlich«
(S. 155), »Augeneindruck« (S. 235), »scharf geschliffener Krallenhieb« (S. 240) und eine
bedenkliche Neigung zur Phrase (Ibykus der griechische Schiller S. 199), besonders
der patriotischen (»Graf Richard der Typus des deutschen Mannes« S. 132).
Aber der Mann hat etwas zu sagen. Wenn er (S. 82 f.) Dichterpersönlichkeiten
charakterisiert, so kann er tüchtig daneben greifen, wie wenn er (S. 89) das Deutsche
in Goethe verkennt, Platen für einen korrekten Weltmann hält (S. 100) oder gar
Kerners Melancholie (S. 90) nur der >grauen Brille« zuschreibt; aber er kann auch
originelle Zeichnungen geben, wie von Spitteler (S. 102). Wenn er Versschemata
verwirft und doch fortwährend gebraucht (S. 63, vgl. 108, 125, 204 u. ö), so beweist
das wenig Konsequenz; aber wie er den Rhythmus eines ganzen Gedichts (S. 69,
131, 180, 242—43) zur Anschauung bringt, das beweist Selbständigkeit der künstle-
rischen Erfassung (S. 65). Daß ihm »Des Sängers Fluch« eine der schönsten epi-
schen Dichtungen ist (S. 217), »welche die deutsche Poesie kennt«, befremdet wie
die leichtfertigen Aussagen über die Götter der Walhalla (S. 139) oder die Frank-
furter Faust-Dichtung (S. 22); aber der Erlkönig bei Herder und Goethe ist
(S. 139 f.) glücklich verglichen. Kurz, ein Lehrer, von dem man viel wird lernen
können, wenn er sich selbst in eine gute Schule genommen haben wird!
Berlin.
Richard M. Meyer.
Chr. D. Pflaum, Die Poetik der deutschen Romantiker. Berlin SW.,
Deutscher Schriftenverlag, 1909. 70 S.
Wesen und Form der romantischen Poesie auf einigen sechzig Druckseiten
bescheidenen Formats darlegen und werten zu wollen, kann, angesichts einer An-
zahl ausgedehnter Werke, die den interessanten Stoff schon früher behandelten,
vermessen erscheinen. Aber — um ein Wort Karl Lamprechts zu gebrauchen —
Kürze ist Konzentration. Der Verfasser dieser Broschüre gelangt weiter als seine
Vorgänger, indem er, Nebensächliches beiseite schiebend, auf den Kernpunkt ein-
dringt, den er sich als Aufgabe stellte. Nichts Geringeres aber will er leisten, als
aus dem widerspruchsvollen Wirrsal theoretischer Forderungen und künstlerischer
Erzeugnisse, das die Hinterlassenschaft der Romantiker bildet, die Kette einer streng
logischen Gedankenfolge herauslösen. Pflaums Versuch ist nicht der erste dieser
Art. Neuerdings strebte namentlich Marie Joachimi (Die Weltanschauung der
deutschen Romantik, Jena und Leipzig 1905) ähnlichem Ziele zu. Sie glaubte es
zu erreichen, indem sie sich auf Fr. Schlegel beschränkte, den zwar spekulativsten,
aber auch poetisch unfruchtbarsten Kopf des Kreises. Pflaum geht darüber hinaus;
er zieht neben den Brüdern Schlegel und Wackenroder auch produktivere Vertreter
der Frühromantik in Betracht, namentlich Tieck, Hölderlin und Novalis. Dadurch
kommt seine Darstellung dem Verlangen nach einem Gesamtbilde näher, während
die knappere Fassung den Vorzug der leichteren Übersicht gewährt.
Es wird in fesselnder Weise entwickelt, welch gewaltiges Ringen in den Ro-
mantikern steckte, wie sie die ganze Welt mit der Fülle ihrer verschiedenartigen
Erscheinungen in sich aufzunehmen trachteten, um sie aus eigenem Geiste heraus
neugestaltet als Dichtung wieder nach außen zu projizieren. Poesie war für sie