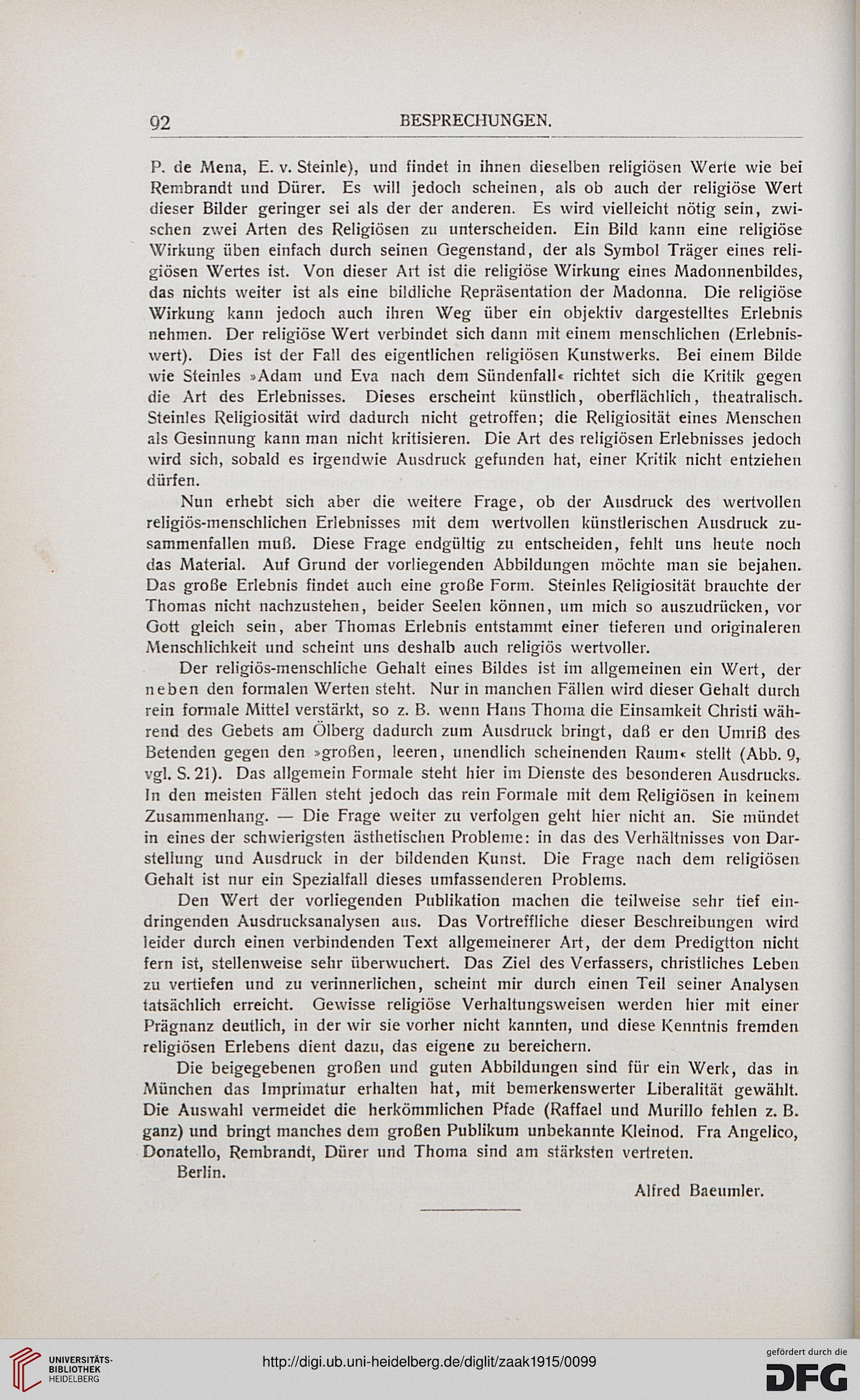92 BESPRECHUNGEN.
P. de Mena, E. v. Steinte), und findet in ihnen dieselben religiösen Werte wie bei
Rembrandt und Dürer. Es will jedoch scheinen, als ob auch der religiöse Wert
dieser Bilder geringer sei als der der anderen. Es wird vielleicht nötig sein, zwi-
schen zwei Arten des Religiösen zu unterscheiden. Ein Bild kann eine religiöse
Wirkung üben einfach durch seinen Gegenstand, der als Symbol Träger eines reli-
giösen Wertes ist. Von dieser Art ist die religiöse Wirkung eines Madonnenbildes,
das nichts weiter ist als eine bildliche Repräsentation der Madonna. Die religiöse
Wirkung kann jedoch auch ihren Weg über ein objektiv dargestelltes Erlebnis
nehmen. Der religiöse Wert verbindet sich dann mit einem menschlichen (Erlebnis-
wert). Dies ist der Fall des eigentlichen religiösen Kunstwerks. Bei einem Bilde
wie Steinles »Adam und Eva nach dem Sündenfall«: richtet sich die Kritik gegen
die Art des Erlebnisses. Dieses erscheint künstlich, oberflächlich, theatralisch.
Steinles Religiosität wird dadurch nicht getroffen; die Religiosität eines Menschen
als Gesinnung kann man nicht kritisieren. Die Art des religiösen Erlebnisses jedoch
wird sich, sobald es irgendwie Ausdruck gefunden hat, einer Kritik nicht entziehen
dürfen.
Nun erhebt sich aber die weitere Frage, ob der Ausdruck des wertvollen
religiös-menschlichen Erlebnisses mit dem wertvollen künstlerischen Ausdruck zu-
sammenfallen muß. Diese Frage endgültig zu entscheiden, fehlt uns heute noch
das Material. Auf Grund der vorliegenden Abbildungen möchte man sie bejahen.
Das große Erlebnis findet auch eine große Form. Steinles Religiosität brauchte der
Thomas nicht nachzustehen, beider Seelen können, um mich so auszudrücken, vor
Gott gleich sein, aber Thomas Erlebnis entstammt einer tieferen und originaleren
Menschlichkeit und scheint uns deshalb auch religiös wertvoller.
Der religiös-menschliche Gehalt eines Bildes ist im allgemeinen ein Wert, der
neben den formalen Werten steht. Nur in manchen Fällen wird dieser Gehalt durch
rein formale Mittel verstärkt, so z. B. wenn Haus Thoma die Einsamkeit Christi wäh-
rend des Gebets am Ölberg dadurch zum Ausdruck bringt, daß er den Umriß des
Betenden gegen den »großen, teeren, unendlich scheinenden Raum« stellt (Abb. 9,
vgl. S. 21). Das allgemein Formale steht hier im Dienste des besonderen Ausdrucks.
In den meisten Fällen steht jedoch das rein Formale mit dem Religiösen in keinem
Zusammenhang. — Die Frage weiter zu verfolgen geht hier nicht an. Sie mündet
in eines der schwierigsten ästhetischen Probleme: in das des Verhältnisses von Dar-
stellung und Ausdruck in der bildenden Kunst. Die Frage nach dem religiösen
Gehalt ist nur ein Spezialfall dieses umfassenderen Problems.
Den Wert der vorliegenden Publikation machen die teilweise sehr tief ein-
dringenden Ausdrucksanalysen aus. Das Vortreffliche dieser Beschreibungen wird
leider durch einen verbindenden Text allgemeinerer Art, der dem Predigtton nicht
fern ist, stellenweise sehr überwuchert. Das Ziel des Verfassers, christliches Leben
zu vertiefen und zu verinnerlichen, scheint mir durch einen Teil seiner Analysen
tatsächlich erreicht. Gewisse religiöse Verhaltungsweisen werden hier mit einer
Prägnanz deutlich, in der wir sie vorher nicht kannten, und diese Kenntnis fremden
religiösen Erlebens dient dazu, das eigene zu bereichern.
Die beigegebenen großen und guten Abbildungen sind für ein Werk, das in
München das Imprimatur erhalten hat, mit bemerkenswerter Liberalität gewählt.
Die Auswahl vermeidet die herkömmlichen Pfade (Raffael und Murillo fehlen z. B.
ganz) und bringt manches dem großen Publikum unbekannte Kleinod. Fra Angelico,
Donatello, Rembrandt, Dürer und Thoma sind am stärksten vertreten.
Berlin.
Alfred Baeumler.
P. de Mena, E. v. Steinte), und findet in ihnen dieselben religiösen Werte wie bei
Rembrandt und Dürer. Es will jedoch scheinen, als ob auch der religiöse Wert
dieser Bilder geringer sei als der der anderen. Es wird vielleicht nötig sein, zwi-
schen zwei Arten des Religiösen zu unterscheiden. Ein Bild kann eine religiöse
Wirkung üben einfach durch seinen Gegenstand, der als Symbol Träger eines reli-
giösen Wertes ist. Von dieser Art ist die religiöse Wirkung eines Madonnenbildes,
das nichts weiter ist als eine bildliche Repräsentation der Madonna. Die religiöse
Wirkung kann jedoch auch ihren Weg über ein objektiv dargestelltes Erlebnis
nehmen. Der religiöse Wert verbindet sich dann mit einem menschlichen (Erlebnis-
wert). Dies ist der Fall des eigentlichen religiösen Kunstwerks. Bei einem Bilde
wie Steinles »Adam und Eva nach dem Sündenfall«: richtet sich die Kritik gegen
die Art des Erlebnisses. Dieses erscheint künstlich, oberflächlich, theatralisch.
Steinles Religiosität wird dadurch nicht getroffen; die Religiosität eines Menschen
als Gesinnung kann man nicht kritisieren. Die Art des religiösen Erlebnisses jedoch
wird sich, sobald es irgendwie Ausdruck gefunden hat, einer Kritik nicht entziehen
dürfen.
Nun erhebt sich aber die weitere Frage, ob der Ausdruck des wertvollen
religiös-menschlichen Erlebnisses mit dem wertvollen künstlerischen Ausdruck zu-
sammenfallen muß. Diese Frage endgültig zu entscheiden, fehlt uns heute noch
das Material. Auf Grund der vorliegenden Abbildungen möchte man sie bejahen.
Das große Erlebnis findet auch eine große Form. Steinles Religiosität brauchte der
Thomas nicht nachzustehen, beider Seelen können, um mich so auszudrücken, vor
Gott gleich sein, aber Thomas Erlebnis entstammt einer tieferen und originaleren
Menschlichkeit und scheint uns deshalb auch religiös wertvoller.
Der religiös-menschliche Gehalt eines Bildes ist im allgemeinen ein Wert, der
neben den formalen Werten steht. Nur in manchen Fällen wird dieser Gehalt durch
rein formale Mittel verstärkt, so z. B. wenn Haus Thoma die Einsamkeit Christi wäh-
rend des Gebets am Ölberg dadurch zum Ausdruck bringt, daß er den Umriß des
Betenden gegen den »großen, teeren, unendlich scheinenden Raum« stellt (Abb. 9,
vgl. S. 21). Das allgemein Formale steht hier im Dienste des besonderen Ausdrucks.
In den meisten Fällen steht jedoch das rein Formale mit dem Religiösen in keinem
Zusammenhang. — Die Frage weiter zu verfolgen geht hier nicht an. Sie mündet
in eines der schwierigsten ästhetischen Probleme: in das des Verhältnisses von Dar-
stellung und Ausdruck in der bildenden Kunst. Die Frage nach dem religiösen
Gehalt ist nur ein Spezialfall dieses umfassenderen Problems.
Den Wert der vorliegenden Publikation machen die teilweise sehr tief ein-
dringenden Ausdrucksanalysen aus. Das Vortreffliche dieser Beschreibungen wird
leider durch einen verbindenden Text allgemeinerer Art, der dem Predigtton nicht
fern ist, stellenweise sehr überwuchert. Das Ziel des Verfassers, christliches Leben
zu vertiefen und zu verinnerlichen, scheint mir durch einen Teil seiner Analysen
tatsächlich erreicht. Gewisse religiöse Verhaltungsweisen werden hier mit einer
Prägnanz deutlich, in der wir sie vorher nicht kannten, und diese Kenntnis fremden
religiösen Erlebens dient dazu, das eigene zu bereichern.
Die beigegebenen großen und guten Abbildungen sind für ein Werk, das in
München das Imprimatur erhalten hat, mit bemerkenswerter Liberalität gewählt.
Die Auswahl vermeidet die herkömmlichen Pfade (Raffael und Murillo fehlen z. B.
ganz) und bringt manches dem großen Publikum unbekannte Kleinod. Fra Angelico,
Donatello, Rembrandt, Dürer und Thoma sind am stärksten vertreten.
Berlin.
Alfred Baeumler.