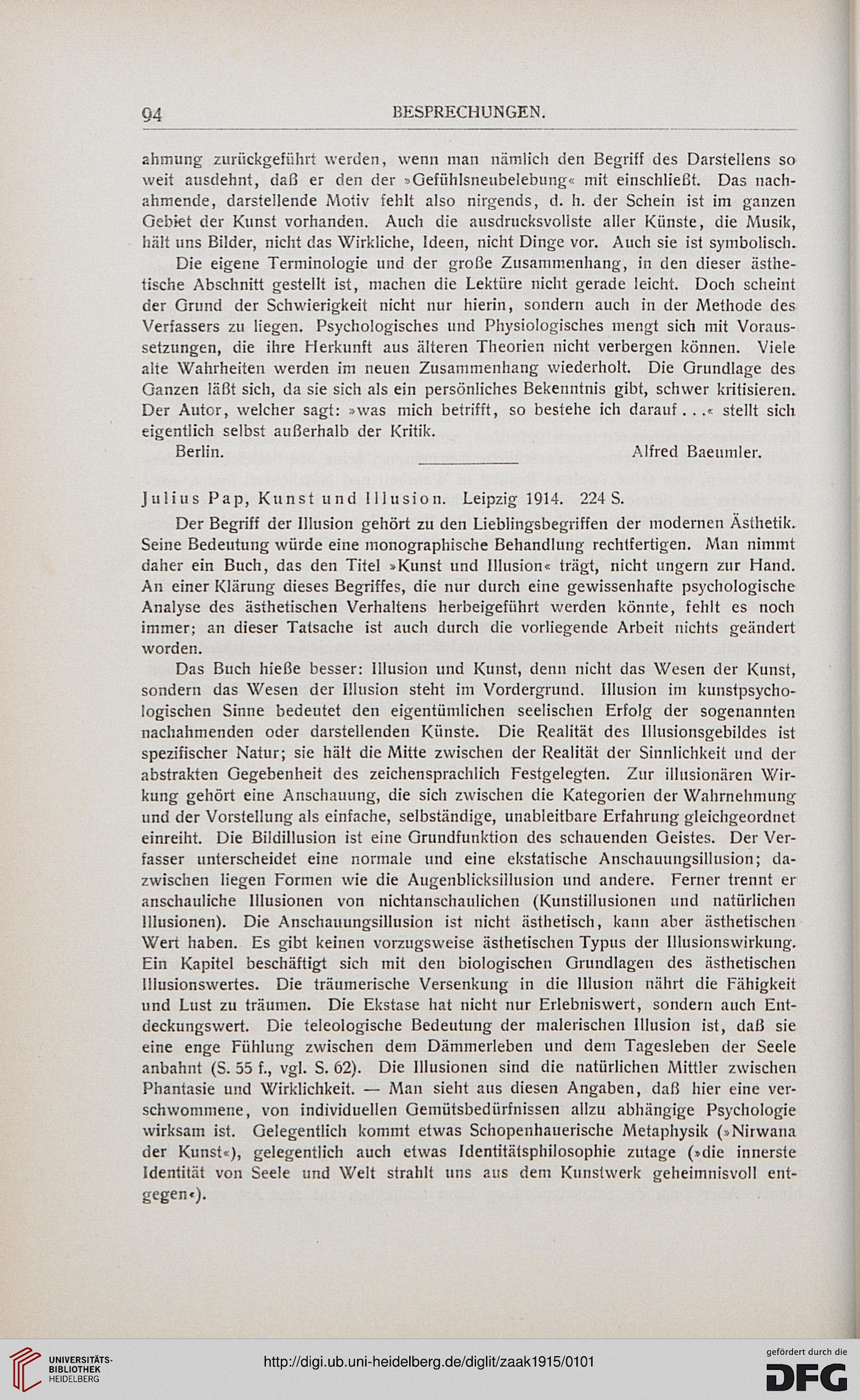94 BESPRECHUNGEN.
ahmung zurückgeführt werden, wenn man nämlich den Begriff des Darstellens so
weit ausdehnt, daß er den der »Gefühlsneubelebung« mit einschließt. Das nach-
ahmende, darstellende Motiv fehlt also nirgends, d. h. der Schein ist im ganzen
Gebiet der Kunst vorhanden. Auch die ausdrucksvollste aller Künste, die Musik,
hält uns Bilder, nicht das Wirkliche, Ideen, nicht Dinge vor. Auch sie ist symbolisch.
Die eigene Terminologie und der große Zusammenhang, in den dieser ästhe-
tische Abschnitt gestellt ist, machen die Lektüre nicht gerade leicht. Doch scheint
der Grund der Schwierigkeit nicht nur hierin, sondern auch in der Methode des
Verfassers zu liegen. Psychologisches und Physiologisches mengt sich mit Voraus-
setzungen, die ihre Herkunft aus älteren Theorien nicht verbergen können. Viele
alte Wahrheiten werden im neuen Zusammenhang wiederholt. Die Grundlage des
Ganzen läßt sich, da sie sich als ein persönliches Bekenntnis gibt, schwer kritisieren.
Der Autor, welcher sagt: :>was mich betrifft, so bestehe ich darauf...« stellt sich
eigentlich selbst außerhalb der Kritik.
Berlin. Alfred Baeumler.
Julius Pap, Kunst und Illusion. Leipzig 1914. 224 S.
Der Begriff der Illusion gehört zu den Lieblingsbegriffen der modernen Ästhetik.
Seine Bedeutung würde eine monographische Behandlung rechtfertigen. Man nimmt
daher ein Buch, das den Titel »Kunst und Illusion« trägt, nicht ungern zur Hand.
An einer Klärung dieses Begriffes, die nur durch eine gewissenhafte psychologische
Analyse des ästhetischen Verhaltens herbeigeführt werden könnte, fehlt es noch
immer; an dieser Tatsache ist auch durch die vorliegende Arbeit nichts geändert
worden.
Das Buch hieße besser: Illusion und Kunst, denn nicht das Wesen der Kunst,
sondern das Wesen der Illusion steht im Vordergrund. Illusion im kunstpsycho-
logischen Sinne bedeutet den eigentümlichen seelischen Erfolg der sogenannten
nachahmenden oder darstellenden Künste. Die Realität des lllusionsgebildes ist
spezifischer Natur; sie hält die Mitte zwischen der Realität der Sinnlichkeit und der
abstrakten Gegebenheit des zeichensprachlich Festgelegten. Zur illusionären Wir-
kung gehört eine Anschauung, die sich zwischen die Kategorien der Wahrnehmung
und der Vorstellung als einfache, selbständige, unableitbare Erfahrung gleichgeordnet
einreiht. Die Bildillusion ist eine Grundfunktion des schauenden Geistes. Der Ver-
fasser unterscheidet eine normale und eine ekstatische Anschauungsillusion; da-
zwischen liegen Formen wie die Augenblicksillusion und andere. Ferner trennt er
anschauliche Illusionen von nichtanschaulichen (Kunstillusionen und natürlichen
Illusionen). Die Anschauungsillusion ist nicht ästhetisch, kann aber ästhetischen
Wert haben. Es gibt keinen vorzugsweise ästhetischen Typus der Illusionswirkung.
Ein Kapitel beschäftigt sich mit den biologischen Grundlagen des ästhetischen
Illusionswertes. Die träumerische Versenkung in die Illusion nährt die Fähigkeit
und Lust zu träumen. Die Ekstase hat nicht nur Erlebniswert, sondern auch Ent-
deckungswert. Die teleologische Bedeutung der malerischen Illusion ist, daß sie
eine enge Fühlung zwischen dem Dämmerleben und dem Tagesleben der Seele
anbahnt (S. 55 f., vgl. S. 62). Die Illusionen sind die natürlichen Mittler zwischen
Phantasie und Wirklichkeit. — Alan sieht aus diesen Angaben, daß hier eine ver-
schwommene, von individuellen Gemütsbedürfnissen allzu abhängige Psychologie
wirksam ist. Gelegentlich kommt etwas Schopenhauerische Metaphysik (»Nirwana
der Kunst«), gelegentlich auch etwas Identitätsphilosophie zutage (»die innerste
Identität von Seele und Welt strahlt uns aus dem Kunstwerk geheimnisvoll ent-
gegen«).
ahmung zurückgeführt werden, wenn man nämlich den Begriff des Darstellens so
weit ausdehnt, daß er den der »Gefühlsneubelebung« mit einschließt. Das nach-
ahmende, darstellende Motiv fehlt also nirgends, d. h. der Schein ist im ganzen
Gebiet der Kunst vorhanden. Auch die ausdrucksvollste aller Künste, die Musik,
hält uns Bilder, nicht das Wirkliche, Ideen, nicht Dinge vor. Auch sie ist symbolisch.
Die eigene Terminologie und der große Zusammenhang, in den dieser ästhe-
tische Abschnitt gestellt ist, machen die Lektüre nicht gerade leicht. Doch scheint
der Grund der Schwierigkeit nicht nur hierin, sondern auch in der Methode des
Verfassers zu liegen. Psychologisches und Physiologisches mengt sich mit Voraus-
setzungen, die ihre Herkunft aus älteren Theorien nicht verbergen können. Viele
alte Wahrheiten werden im neuen Zusammenhang wiederholt. Die Grundlage des
Ganzen läßt sich, da sie sich als ein persönliches Bekenntnis gibt, schwer kritisieren.
Der Autor, welcher sagt: :>was mich betrifft, so bestehe ich darauf...« stellt sich
eigentlich selbst außerhalb der Kritik.
Berlin. Alfred Baeumler.
Julius Pap, Kunst und Illusion. Leipzig 1914. 224 S.
Der Begriff der Illusion gehört zu den Lieblingsbegriffen der modernen Ästhetik.
Seine Bedeutung würde eine monographische Behandlung rechtfertigen. Man nimmt
daher ein Buch, das den Titel »Kunst und Illusion« trägt, nicht ungern zur Hand.
An einer Klärung dieses Begriffes, die nur durch eine gewissenhafte psychologische
Analyse des ästhetischen Verhaltens herbeigeführt werden könnte, fehlt es noch
immer; an dieser Tatsache ist auch durch die vorliegende Arbeit nichts geändert
worden.
Das Buch hieße besser: Illusion und Kunst, denn nicht das Wesen der Kunst,
sondern das Wesen der Illusion steht im Vordergrund. Illusion im kunstpsycho-
logischen Sinne bedeutet den eigentümlichen seelischen Erfolg der sogenannten
nachahmenden oder darstellenden Künste. Die Realität des lllusionsgebildes ist
spezifischer Natur; sie hält die Mitte zwischen der Realität der Sinnlichkeit und der
abstrakten Gegebenheit des zeichensprachlich Festgelegten. Zur illusionären Wir-
kung gehört eine Anschauung, die sich zwischen die Kategorien der Wahrnehmung
und der Vorstellung als einfache, selbständige, unableitbare Erfahrung gleichgeordnet
einreiht. Die Bildillusion ist eine Grundfunktion des schauenden Geistes. Der Ver-
fasser unterscheidet eine normale und eine ekstatische Anschauungsillusion; da-
zwischen liegen Formen wie die Augenblicksillusion und andere. Ferner trennt er
anschauliche Illusionen von nichtanschaulichen (Kunstillusionen und natürlichen
Illusionen). Die Anschauungsillusion ist nicht ästhetisch, kann aber ästhetischen
Wert haben. Es gibt keinen vorzugsweise ästhetischen Typus der Illusionswirkung.
Ein Kapitel beschäftigt sich mit den biologischen Grundlagen des ästhetischen
Illusionswertes. Die träumerische Versenkung in die Illusion nährt die Fähigkeit
und Lust zu träumen. Die Ekstase hat nicht nur Erlebniswert, sondern auch Ent-
deckungswert. Die teleologische Bedeutung der malerischen Illusion ist, daß sie
eine enge Fühlung zwischen dem Dämmerleben und dem Tagesleben der Seele
anbahnt (S. 55 f., vgl. S. 62). Die Illusionen sind die natürlichen Mittler zwischen
Phantasie und Wirklichkeit. — Alan sieht aus diesen Angaben, daß hier eine ver-
schwommene, von individuellen Gemütsbedürfnissen allzu abhängige Psychologie
wirksam ist. Gelegentlich kommt etwas Schopenhauerische Metaphysik (»Nirwana
der Kunst«), gelegentlich auch etwas Identitätsphilosophie zutage (»die innerste
Identität von Seele und Welt strahlt uns aus dem Kunstwerk geheimnisvoll ent-
gegen«).