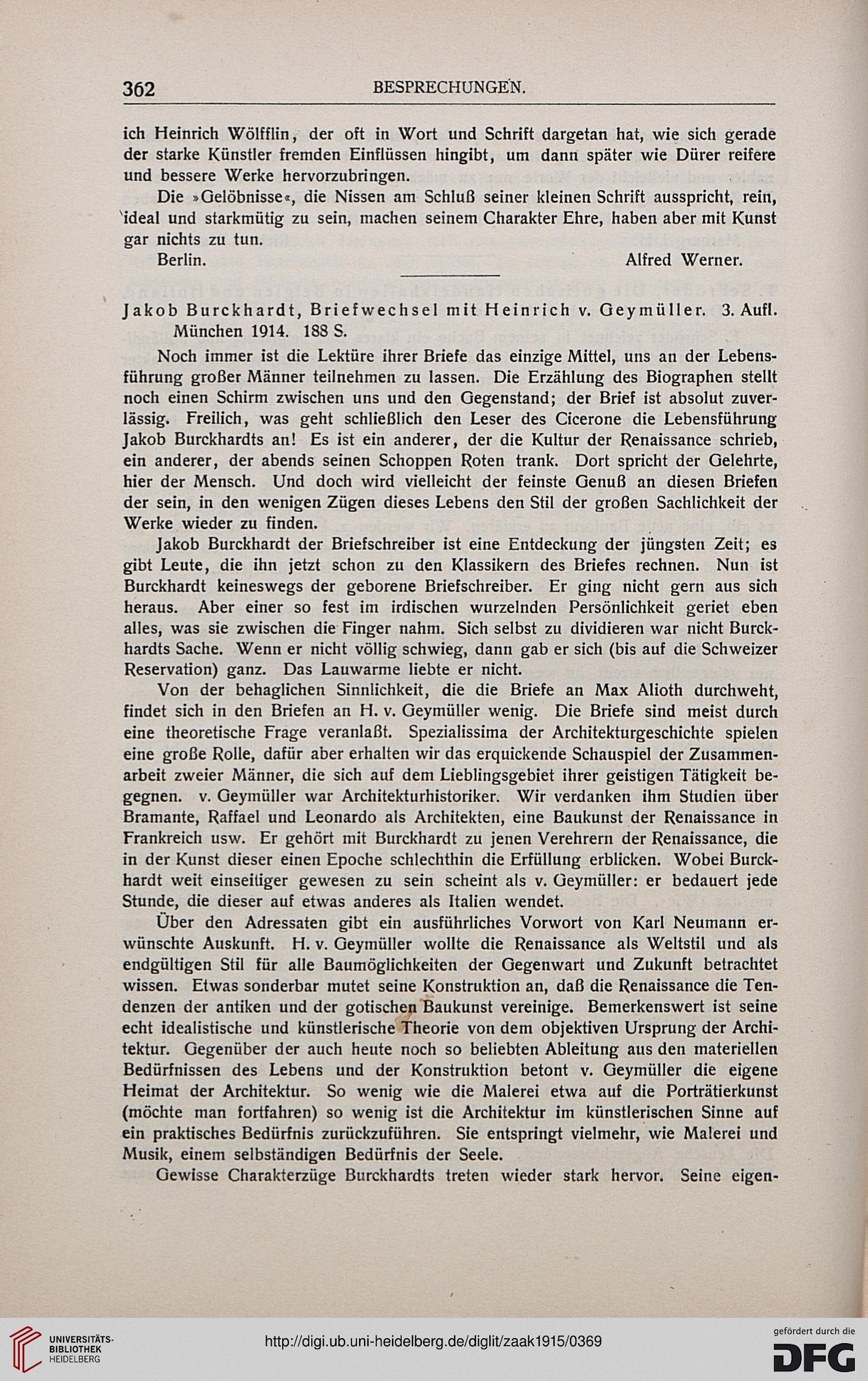362 BESPRECHUNGEN.
ich Heinrich Wölfflin, der oft in Wort und Schrift dargetan hat, wie sich gerade
der starke Künstler fremden Einflüssen hingibt, um dann später wie Dürer reifere
und bessere Werke hervorzubringen.
Die »Gelöbnisse«, die Nissen am Schluß seiner kleinen Schrift ausspricht, rein,
'ideal und starkmütig zu sein, machen seinem Charakter Ehre, haben aber mit Kunst
gar nichts zu tun.
Berlin. Alfred Werner.
Jakob Burckhardt, Briefwechsel mit Heinrich v. Geymüller. 3. Aufl.
München 1914. 188 S.
Noch immer ist die Lektüre ihrer Briefe das einzige Mittel, uns an der Lebens-
führung großer Männer teilnehmen zu lassen. Die Erzählung des Biographen stellt
noch einen Schirm zwischen uns und den Gegenstand; der Brief ist absolut zuver-
lässig. Freilich, was geht schließlich den Leser des Cicerone die Lebensführung
Jakob Burckhardts an! Es ist ein anderer, der die Kultur der Renaissance schrieb,
ein anderer, der abends seinen Schoppen Roten trank. Dort spricht der Gelehrte,
hier der Mensch. Und doch wird vielleicht der feinste Genuß an diesen Briefen
der sein, in den wenigen Zügen dieses Lebens den Stil der großen Sachlichkeit der
Werke wieder zu finden.
Jakob Burckhardt der Briefschreiber ist eine Entdeckung der jüngsten Zeit; es
gibt Leute, die ihn jetzt schon zu den Klassikern des Briefes rechnen. Nun ist
Burckhardt keineswegs der geborene Briefschreiber. Er ging nicht gern aus sich
heraus. Aber einer so fest im irdischen wurzelnden Persönlichkeit geriet eben
alles, was sie zwischen die Finger nahm. Sich selbst zu dividieren war nicht Burck-
hardts Sache. Wenn er nicht völlig schwieg, dann gab er sich (bis auf die Schweizer
Reservation) ganz. Das Lauwarme liebte er nicht.
Von der behaglichen Sinnlichkeit, die die Briefe an Max Alioth durchweht,
findet sich in den Briefen an H. v. Geymüller wenig. Die Briefe sind meist durch
eine theoretische Frage veranlaßt. Spezialissima der Architekturgeschichte spielen
eine große Rolle, dafür aber erhalten wir das erquickende Schauspiel der Zusammen-
arbeit zweier Männer, die sich auf dem Lieblingsgebiet ihrer geistigen Tätigkeit be-
gegnen, v. Geymüller war Architekturhistoriker. Wir verdanken ihm Studien über
Bramante, Raffael und Leonardo als Architekten, eine Baukunst der Renaissance in
Frankreich usw. Er gehört mit Burckhardt zu jenen Verehrern der Renaissance, die
in der Kunst dieser einen Epoche schlechthin die Erfüllung erblicken. Wobei Burck-
hardt weit einseiliger gewesen zu sein scheint als v. Geymüller: er bedauert jede
Stunde, die dieser auf etwas anderes als Italien wendet.
Über den Adressaten gibt ein ausführliches Vorwort von Karl Neumann er-
wünschte Auskunft. H. v. Geymüller wollte die Renaissance als Weltstil und als
endgültigen Stil für alle Baumöglichkeiten der Gegenwart und Zukunft betrachtet
wissen. Etwas sonderbar mutet seine Konstruktion an, daß die Renaissance die Ten-
denzen der antiken und der gotischen Baukunst vereinige. Bemerkenswert ist seine
echt idealistische und künstlerische Theorie von dem objektiven Ursprung der Archi-
tektur. Gegenüber der auch heute noch so beliebten Ableitung aus den materiellen
Bedürfnissen des Lebens und der Konstruktion betont v. Geymüller die eigene
Heimat der Architektur. So wenig wie die Malerei etwa auf die Porträtierkunst
(möchte man fortfahren) so wenig ist die Architektur im künstlerischen Sinne auf
ein praktisches Bedürfnis zurückzuführen. Sie entspringt vielmehr, wie Malerei und
Musik, einem selbständigen Bedürfnis der Seele.
Gewisse Charakterzüge Burckhardts treten wieder stark hervor. Seine eigen-
ich Heinrich Wölfflin, der oft in Wort und Schrift dargetan hat, wie sich gerade
der starke Künstler fremden Einflüssen hingibt, um dann später wie Dürer reifere
und bessere Werke hervorzubringen.
Die »Gelöbnisse«, die Nissen am Schluß seiner kleinen Schrift ausspricht, rein,
'ideal und starkmütig zu sein, machen seinem Charakter Ehre, haben aber mit Kunst
gar nichts zu tun.
Berlin. Alfred Werner.
Jakob Burckhardt, Briefwechsel mit Heinrich v. Geymüller. 3. Aufl.
München 1914. 188 S.
Noch immer ist die Lektüre ihrer Briefe das einzige Mittel, uns an der Lebens-
führung großer Männer teilnehmen zu lassen. Die Erzählung des Biographen stellt
noch einen Schirm zwischen uns und den Gegenstand; der Brief ist absolut zuver-
lässig. Freilich, was geht schließlich den Leser des Cicerone die Lebensführung
Jakob Burckhardts an! Es ist ein anderer, der die Kultur der Renaissance schrieb,
ein anderer, der abends seinen Schoppen Roten trank. Dort spricht der Gelehrte,
hier der Mensch. Und doch wird vielleicht der feinste Genuß an diesen Briefen
der sein, in den wenigen Zügen dieses Lebens den Stil der großen Sachlichkeit der
Werke wieder zu finden.
Jakob Burckhardt der Briefschreiber ist eine Entdeckung der jüngsten Zeit; es
gibt Leute, die ihn jetzt schon zu den Klassikern des Briefes rechnen. Nun ist
Burckhardt keineswegs der geborene Briefschreiber. Er ging nicht gern aus sich
heraus. Aber einer so fest im irdischen wurzelnden Persönlichkeit geriet eben
alles, was sie zwischen die Finger nahm. Sich selbst zu dividieren war nicht Burck-
hardts Sache. Wenn er nicht völlig schwieg, dann gab er sich (bis auf die Schweizer
Reservation) ganz. Das Lauwarme liebte er nicht.
Von der behaglichen Sinnlichkeit, die die Briefe an Max Alioth durchweht,
findet sich in den Briefen an H. v. Geymüller wenig. Die Briefe sind meist durch
eine theoretische Frage veranlaßt. Spezialissima der Architekturgeschichte spielen
eine große Rolle, dafür aber erhalten wir das erquickende Schauspiel der Zusammen-
arbeit zweier Männer, die sich auf dem Lieblingsgebiet ihrer geistigen Tätigkeit be-
gegnen, v. Geymüller war Architekturhistoriker. Wir verdanken ihm Studien über
Bramante, Raffael und Leonardo als Architekten, eine Baukunst der Renaissance in
Frankreich usw. Er gehört mit Burckhardt zu jenen Verehrern der Renaissance, die
in der Kunst dieser einen Epoche schlechthin die Erfüllung erblicken. Wobei Burck-
hardt weit einseiliger gewesen zu sein scheint als v. Geymüller: er bedauert jede
Stunde, die dieser auf etwas anderes als Italien wendet.
Über den Adressaten gibt ein ausführliches Vorwort von Karl Neumann er-
wünschte Auskunft. H. v. Geymüller wollte die Renaissance als Weltstil und als
endgültigen Stil für alle Baumöglichkeiten der Gegenwart und Zukunft betrachtet
wissen. Etwas sonderbar mutet seine Konstruktion an, daß die Renaissance die Ten-
denzen der antiken und der gotischen Baukunst vereinige. Bemerkenswert ist seine
echt idealistische und künstlerische Theorie von dem objektiven Ursprung der Archi-
tektur. Gegenüber der auch heute noch so beliebten Ableitung aus den materiellen
Bedürfnissen des Lebens und der Konstruktion betont v. Geymüller die eigene
Heimat der Architektur. So wenig wie die Malerei etwa auf die Porträtierkunst
(möchte man fortfahren) so wenig ist die Architektur im künstlerischen Sinne auf
ein praktisches Bedürfnis zurückzuführen. Sie entspringt vielmehr, wie Malerei und
Musik, einem selbständigen Bedürfnis der Seele.
Gewisse Charakterzüge Burckhardts treten wieder stark hervor. Seine eigen-