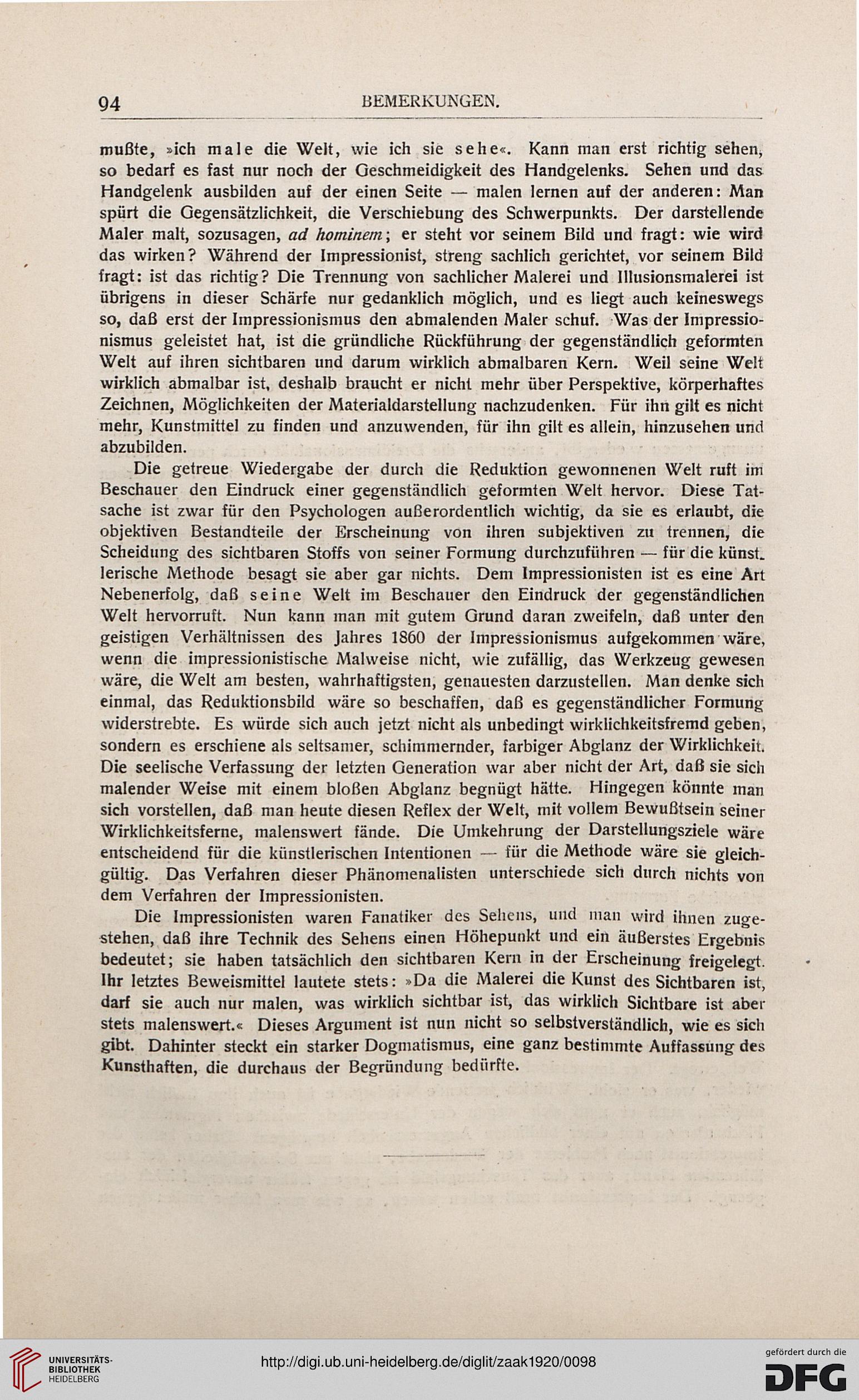94 BEMERKUNGEN.
mußte, »ich male die Welt, wie ich sie sehe«. Kann man erst richtig sehen,
so bedarf es fast nur noch der Geschmeidigkeit des Handgelenks. Sehen und das
Handgelenk ausbilden auf der einen Seite — malen lernen auf der anderen: Man
spürt die Gegensätzlichkeit, die Verschiebung des Schwerpunkts. Der darstellende
Maler malt, sozusagen, ad hominem; er steht vor seinem Bild und fragt: wie wird
das wirken? Während der Impressionist, streng sachlich gerichtet, vor seinem Bild
fragt: ist das richtig? Die Trennung von sachlicher Malerei und Illusionsmalerei ist
übrigens in dieser Schärfe nur gedanklich möglich, und es liegt auch keineswegs
so, daß erst der Impressionismus den abmalenden Maler schuf. Was der Impressio-
nismus geleistet hat, ist die gründliche Rückführung der gegenständlich geformten
Welt auf ihren sichtbaren und darum wirklich abmalbaren Kern. Weil seine Welt
wirklich abmalbar ist, deshalb braucht er nicht mehr über Perspektive, körperhaftes
Zeichnen, Möglichkeiten der Materialdarstellung nachzudenken. Für ihn gilt es nicht
mehr, Kunstmittel zu finden und anzuwenden, für ihn gilt es allein, hinzusehen und
abzubilden.
Die getreue Wiedergabe der durch die Reduktion gewonnenen Welt ruft im
Beschauer den Eindruck einer gegenständlich geformten Welt hervor. Diese Tat-
sache ist zwar für den Psychologen außerordentlich wichtig, da sie es erlaubt, die
objektiven Bestandteile der Erscheinung von ihren subjektiven zu trennen, die
Scheidung des sichtbaren Stoffs von seiner Formung durchzuführen — für die künst.
Ierische Methode besagt sie aber gar nichts. Dem Impressionisten ist es eine Art
Nebenerfolg, daß seine Welt im Beschauer den Eindruck der gegenständlichen
Welt hervorruft. Nun kann man mit gutem Grund daran zweifeln, daß unter den
geistigen Verhältnissen des Jahres 1860 der Impressionismus aufgekommen wäre,
wenn die impressionistische Malweise nicht, wie zufällig, das Werkzeug gewesen
wäre, die Welt am besten, wahrhaftigsten, genauesten darzustellen. Man denke sich
einmal, das Reduktionsbild wäre so beschaffen, daß es gegenständlicher Formung
widerstrebte. Es würde sich auch jetzt nicht als unbedingt wirklichkeitsfremd geben,
sondern es erschiene als seltsamer, schimmernder, farbiger Abglanz der Wirklichkeit.
Die seelische Verfassung der letzten Generation war aber nicht der Art, daß sie sich
malender Weise mit einem bloßen Abglanz begnügt hätte. Hingegen könnte man
sich vorstellen, daß man heute diesen Reflex der Welt, mit vollem Bewußtsein seiner
Wirklichkeitsferne, malenswert fände. Die Umkehrung der Darstellungsziele wäre
entscheidend für die künstlerischen Intentionen — für die Methode wäre sie gleich-
gültig. Das Verfahren dieser Phänomenalisten unterschiede sich durch nichts von
dem Verfahren der Impressionisten.
Die Impressionisten waren Fanatiker des Sehens, und man wird ihnen zuge-
stehen, daß ihre Technik des Sehens einen Höhepunkt und ein äußerstes Ergebnis
bedeutet; sie haben tatsächlich den sichtbaren Kern in der Erscheinung freigelegt.
Ihr letztes Beweismittel lautete stets: »Da die Malerei die Kunst des Sichtbaren ist,
darf sie auch nur malen, was wirklich sichtbar ist, das wirklich Sichtbare ist aber
stets malenswert.« Dieses Argument ist nun nicht so selbstverständlich, wie es sich
gibt. Dahinter steckt ein starker Dogmatismus, eine ganz bestimmte Auffassung des
Kunsthaften, die durchaus der Begründung bedürfte.
mußte, »ich male die Welt, wie ich sie sehe«. Kann man erst richtig sehen,
so bedarf es fast nur noch der Geschmeidigkeit des Handgelenks. Sehen und das
Handgelenk ausbilden auf der einen Seite — malen lernen auf der anderen: Man
spürt die Gegensätzlichkeit, die Verschiebung des Schwerpunkts. Der darstellende
Maler malt, sozusagen, ad hominem; er steht vor seinem Bild und fragt: wie wird
das wirken? Während der Impressionist, streng sachlich gerichtet, vor seinem Bild
fragt: ist das richtig? Die Trennung von sachlicher Malerei und Illusionsmalerei ist
übrigens in dieser Schärfe nur gedanklich möglich, und es liegt auch keineswegs
so, daß erst der Impressionismus den abmalenden Maler schuf. Was der Impressio-
nismus geleistet hat, ist die gründliche Rückführung der gegenständlich geformten
Welt auf ihren sichtbaren und darum wirklich abmalbaren Kern. Weil seine Welt
wirklich abmalbar ist, deshalb braucht er nicht mehr über Perspektive, körperhaftes
Zeichnen, Möglichkeiten der Materialdarstellung nachzudenken. Für ihn gilt es nicht
mehr, Kunstmittel zu finden und anzuwenden, für ihn gilt es allein, hinzusehen und
abzubilden.
Die getreue Wiedergabe der durch die Reduktion gewonnenen Welt ruft im
Beschauer den Eindruck einer gegenständlich geformten Welt hervor. Diese Tat-
sache ist zwar für den Psychologen außerordentlich wichtig, da sie es erlaubt, die
objektiven Bestandteile der Erscheinung von ihren subjektiven zu trennen, die
Scheidung des sichtbaren Stoffs von seiner Formung durchzuführen — für die künst.
Ierische Methode besagt sie aber gar nichts. Dem Impressionisten ist es eine Art
Nebenerfolg, daß seine Welt im Beschauer den Eindruck der gegenständlichen
Welt hervorruft. Nun kann man mit gutem Grund daran zweifeln, daß unter den
geistigen Verhältnissen des Jahres 1860 der Impressionismus aufgekommen wäre,
wenn die impressionistische Malweise nicht, wie zufällig, das Werkzeug gewesen
wäre, die Welt am besten, wahrhaftigsten, genauesten darzustellen. Man denke sich
einmal, das Reduktionsbild wäre so beschaffen, daß es gegenständlicher Formung
widerstrebte. Es würde sich auch jetzt nicht als unbedingt wirklichkeitsfremd geben,
sondern es erschiene als seltsamer, schimmernder, farbiger Abglanz der Wirklichkeit.
Die seelische Verfassung der letzten Generation war aber nicht der Art, daß sie sich
malender Weise mit einem bloßen Abglanz begnügt hätte. Hingegen könnte man
sich vorstellen, daß man heute diesen Reflex der Welt, mit vollem Bewußtsein seiner
Wirklichkeitsferne, malenswert fände. Die Umkehrung der Darstellungsziele wäre
entscheidend für die künstlerischen Intentionen — für die Methode wäre sie gleich-
gültig. Das Verfahren dieser Phänomenalisten unterschiede sich durch nichts von
dem Verfahren der Impressionisten.
Die Impressionisten waren Fanatiker des Sehens, und man wird ihnen zuge-
stehen, daß ihre Technik des Sehens einen Höhepunkt und ein äußerstes Ergebnis
bedeutet; sie haben tatsächlich den sichtbaren Kern in der Erscheinung freigelegt.
Ihr letztes Beweismittel lautete stets: »Da die Malerei die Kunst des Sichtbaren ist,
darf sie auch nur malen, was wirklich sichtbar ist, das wirklich Sichtbare ist aber
stets malenswert.« Dieses Argument ist nun nicht so selbstverständlich, wie es sich
gibt. Dahinter steckt ein starker Dogmatismus, eine ganz bestimmte Auffassung des
Kunsthaften, die durchaus der Begründung bedürfte.