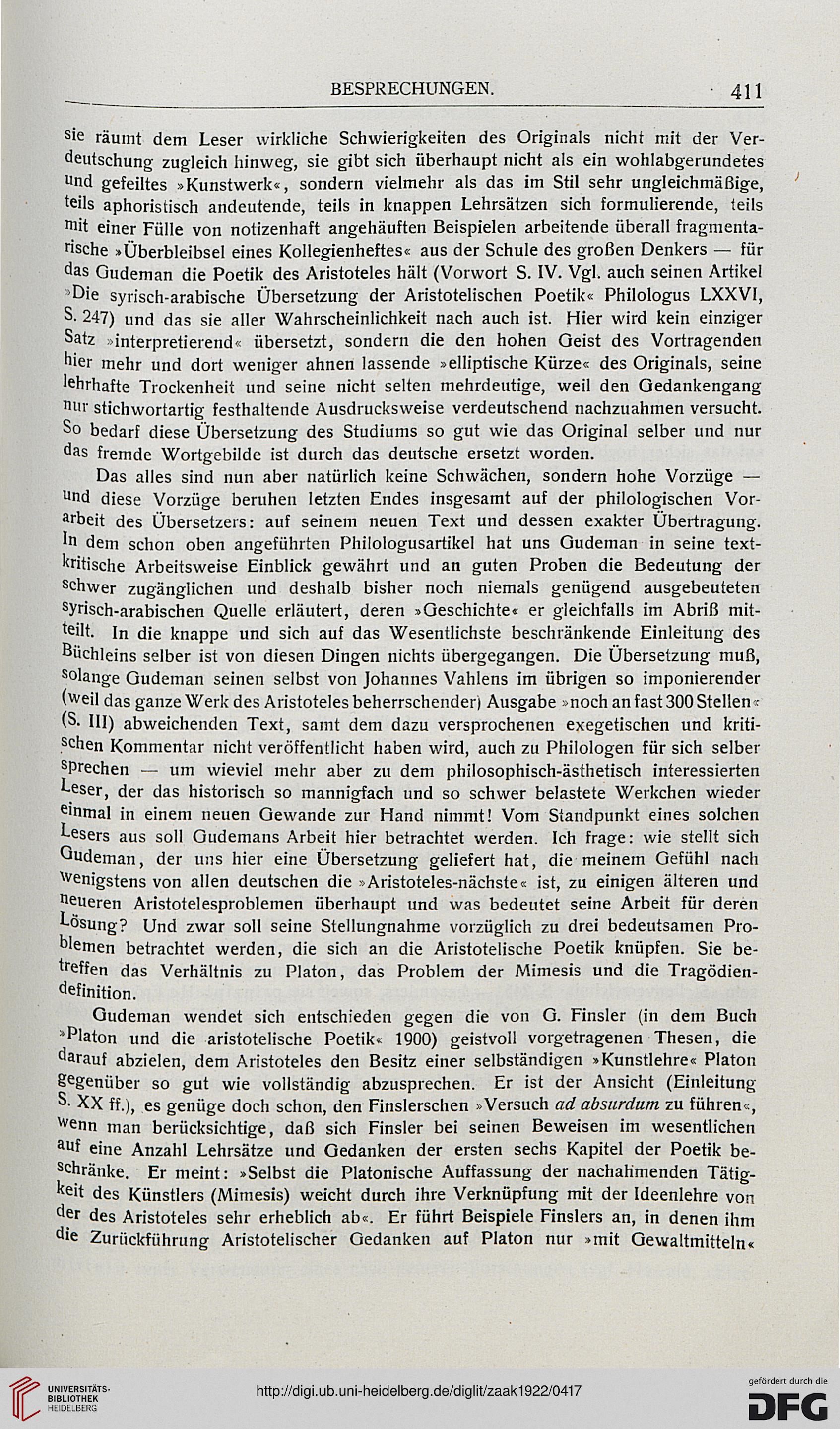BESPRECHUNGEN. ■ 411
sie räumt dem Leser wirkliche Schwierigkeiten des Originals nicht mit der Ver-
deutschung zugleich hinweg, sie gibt sich überhaupt nicht als ein wohlabgerundetes
Und gefeiltes »Kunstwerk«, sondern vielmehr als das im Stil sehr ungleichmäßige,
teils aphoristisch andeutende, teils in knappen Lehrsätzen sich formulierende, teils
Wir einer Fülle von notizenhaft angehäuften Beispielen arbeitende überall fragmenta-
rische »Überbleibsel eines Kollegienheftes« aus der Schule des großen Denkers — für
das Gudeman die Poetik des Aristoteles hält (Vorwort S. IV. Vgl. auch seinen Artikel
'Die syrisch-arabische Übersetzung der Aristotelischen Poetik« Philologus LXXV1,
S- 247) und das sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch ist. Hier wird kein einziger
Satz »interpretierend« übersetzt, sondern die den hohen Oeist des Vortragenden
"ier mehr und dort weniger ahnen lassende »elliptische Kürze« des Originals, seine
'ehrhafte Trockenheit und seine nicht selten mehrdeutige, weil den Gedankengang
nur stichwortartig festhaltende Ausdrucksweise verdeutschend nachzuahmen versucht.
So bedarf diese Übersetzung des Studiums so gut wie das Original selber und nur
das fremde Wortgebilde ist durch das deutsche ersetzt worden.
Das alles sind nun aber natürlich keine Schwächen, sondern hohe Vorzüge —
Ur>d diese Vorzüge beruhen letzten Endes insgesamt auf der philologischen Vor-
arbeit des Übersetzers: auf seinem neuen Text und dessen exakter Übertragung.
'" dem schon oben angeführten Philologusartikel hat uns Gudeman in seine text-
kritische Arbeitsweise Einblick gewährt und an guten Proben die Bedeutung der
schwer zugänglichen und deshalb bisher noch niemals genügend ausgebeuteten
syrisch-arabischen Quelle erläutert, deren »Geschichte« er gleichfalls im Abriß mit-
teilt. In die knappe und sich auf das Wesentlichste beschränkende Einleitung des
Büchleins selber ist von diesen Dingen nichts übergegangen. Die Übersetzung muß,
solange Gudeman seinen selbst von Johannes Vahlens im übrigen so imponierender
(weil das ganze Werk des Aristoteles beherrschender) Ausgabe »noch an fast 300 Stellen t
(S. III) abweichenden Text, samt dem dazu versprochenen exegetischen und kriti-
schen Kommentar nicht veröffentlicht haben wird, auch zu Philologen für sich selber
sprechen — um wieviel mehr aber zu dem philosophisch-ästhetisch interessierten
Leser, der das historisch so mannigfach und so schwer belastete Werkchen wieder
einmal in einem neuen Gewände zur Hand nimmt! Vom Standpunkt eines solchen
Lesers aus soll Gudemans Arbeit hier betrachtet werden. Ich frage: wie stellt sich
Qudeman, der uns hier eine Übersetzung geliefert hat, die meinem Gefühl nach
wenigstens von allen deutschen die »Aristoteles-nächste« ist, zu einigen älteren und
"eueren Aristotelesproblemen überhaupt und was bedeutet seine Arbeit für deren
Lösung? Und zwar soll seine Stellungnahme vorzüglich zu drei bedeutsamen Pro-
°'emen betrachtet werden, die sich an die Aristotelische Poetik knüpfen. Sie be-
reifen das Verhältnis zu Piaton, das Problem der Mimesis und die Tragödien-
definition.
Gudeman wendet sich entschieden gegen die von G. Finsler (in dem Buch
^Platon und die aristotelische Poetik« 1900) geistvoll vorgetragenen Thesen, die
darauf abzielen, dem Aristoteles den Besitz einer selbständigen »Kunstlehre« Piaton
gegenüber so gut wie vollständig abzusprechen. Er ist der Ansicht (Einleitung
S- XX ff.), es genüge doch schon, den Finslerschen »Versuch ad absurdum zu führen«,
Wenn man berücksichtige, daß sich Finsler bei seinen Beweisen im wesentlichen
auf eine Anzahl Lehrsätze und Gedanken der ersten sechs Kapitel der Poetik be-
schränke. Er meint: »Selbst die Platonische Auffassung der nachahmenden Tätig-
keit des Künstlers (Mimesis) weicht durch ihre Verknüpfung mit der Ideenlehre von
der des Aristoteles sehr erheblich ab«. Er führt Beispiele Finslers an, in denen ihm
die Zuriickführung Aristotelischer Gedanken auf Piaton nur »mit Gewaltmitteln«
sie räumt dem Leser wirkliche Schwierigkeiten des Originals nicht mit der Ver-
deutschung zugleich hinweg, sie gibt sich überhaupt nicht als ein wohlabgerundetes
Und gefeiltes »Kunstwerk«, sondern vielmehr als das im Stil sehr ungleichmäßige,
teils aphoristisch andeutende, teils in knappen Lehrsätzen sich formulierende, teils
Wir einer Fülle von notizenhaft angehäuften Beispielen arbeitende überall fragmenta-
rische »Überbleibsel eines Kollegienheftes« aus der Schule des großen Denkers — für
das Gudeman die Poetik des Aristoteles hält (Vorwort S. IV. Vgl. auch seinen Artikel
'Die syrisch-arabische Übersetzung der Aristotelischen Poetik« Philologus LXXV1,
S- 247) und das sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch ist. Hier wird kein einziger
Satz »interpretierend« übersetzt, sondern die den hohen Oeist des Vortragenden
"ier mehr und dort weniger ahnen lassende »elliptische Kürze« des Originals, seine
'ehrhafte Trockenheit und seine nicht selten mehrdeutige, weil den Gedankengang
nur stichwortartig festhaltende Ausdrucksweise verdeutschend nachzuahmen versucht.
So bedarf diese Übersetzung des Studiums so gut wie das Original selber und nur
das fremde Wortgebilde ist durch das deutsche ersetzt worden.
Das alles sind nun aber natürlich keine Schwächen, sondern hohe Vorzüge —
Ur>d diese Vorzüge beruhen letzten Endes insgesamt auf der philologischen Vor-
arbeit des Übersetzers: auf seinem neuen Text und dessen exakter Übertragung.
'" dem schon oben angeführten Philologusartikel hat uns Gudeman in seine text-
kritische Arbeitsweise Einblick gewährt und an guten Proben die Bedeutung der
schwer zugänglichen und deshalb bisher noch niemals genügend ausgebeuteten
syrisch-arabischen Quelle erläutert, deren »Geschichte« er gleichfalls im Abriß mit-
teilt. In die knappe und sich auf das Wesentlichste beschränkende Einleitung des
Büchleins selber ist von diesen Dingen nichts übergegangen. Die Übersetzung muß,
solange Gudeman seinen selbst von Johannes Vahlens im übrigen so imponierender
(weil das ganze Werk des Aristoteles beherrschender) Ausgabe »noch an fast 300 Stellen t
(S. III) abweichenden Text, samt dem dazu versprochenen exegetischen und kriti-
schen Kommentar nicht veröffentlicht haben wird, auch zu Philologen für sich selber
sprechen — um wieviel mehr aber zu dem philosophisch-ästhetisch interessierten
Leser, der das historisch so mannigfach und so schwer belastete Werkchen wieder
einmal in einem neuen Gewände zur Hand nimmt! Vom Standpunkt eines solchen
Lesers aus soll Gudemans Arbeit hier betrachtet werden. Ich frage: wie stellt sich
Qudeman, der uns hier eine Übersetzung geliefert hat, die meinem Gefühl nach
wenigstens von allen deutschen die »Aristoteles-nächste« ist, zu einigen älteren und
"eueren Aristotelesproblemen überhaupt und was bedeutet seine Arbeit für deren
Lösung? Und zwar soll seine Stellungnahme vorzüglich zu drei bedeutsamen Pro-
°'emen betrachtet werden, die sich an die Aristotelische Poetik knüpfen. Sie be-
reifen das Verhältnis zu Piaton, das Problem der Mimesis und die Tragödien-
definition.
Gudeman wendet sich entschieden gegen die von G. Finsler (in dem Buch
^Platon und die aristotelische Poetik« 1900) geistvoll vorgetragenen Thesen, die
darauf abzielen, dem Aristoteles den Besitz einer selbständigen »Kunstlehre« Piaton
gegenüber so gut wie vollständig abzusprechen. Er ist der Ansicht (Einleitung
S- XX ff.), es genüge doch schon, den Finslerschen »Versuch ad absurdum zu führen«,
Wenn man berücksichtige, daß sich Finsler bei seinen Beweisen im wesentlichen
auf eine Anzahl Lehrsätze und Gedanken der ersten sechs Kapitel der Poetik be-
schränke. Er meint: »Selbst die Platonische Auffassung der nachahmenden Tätig-
keit des Künstlers (Mimesis) weicht durch ihre Verknüpfung mit der Ideenlehre von
der des Aristoteles sehr erheblich ab«. Er führt Beispiele Finslers an, in denen ihm
die Zuriickführung Aristotelischer Gedanken auf Piaton nur »mit Gewaltmitteln«