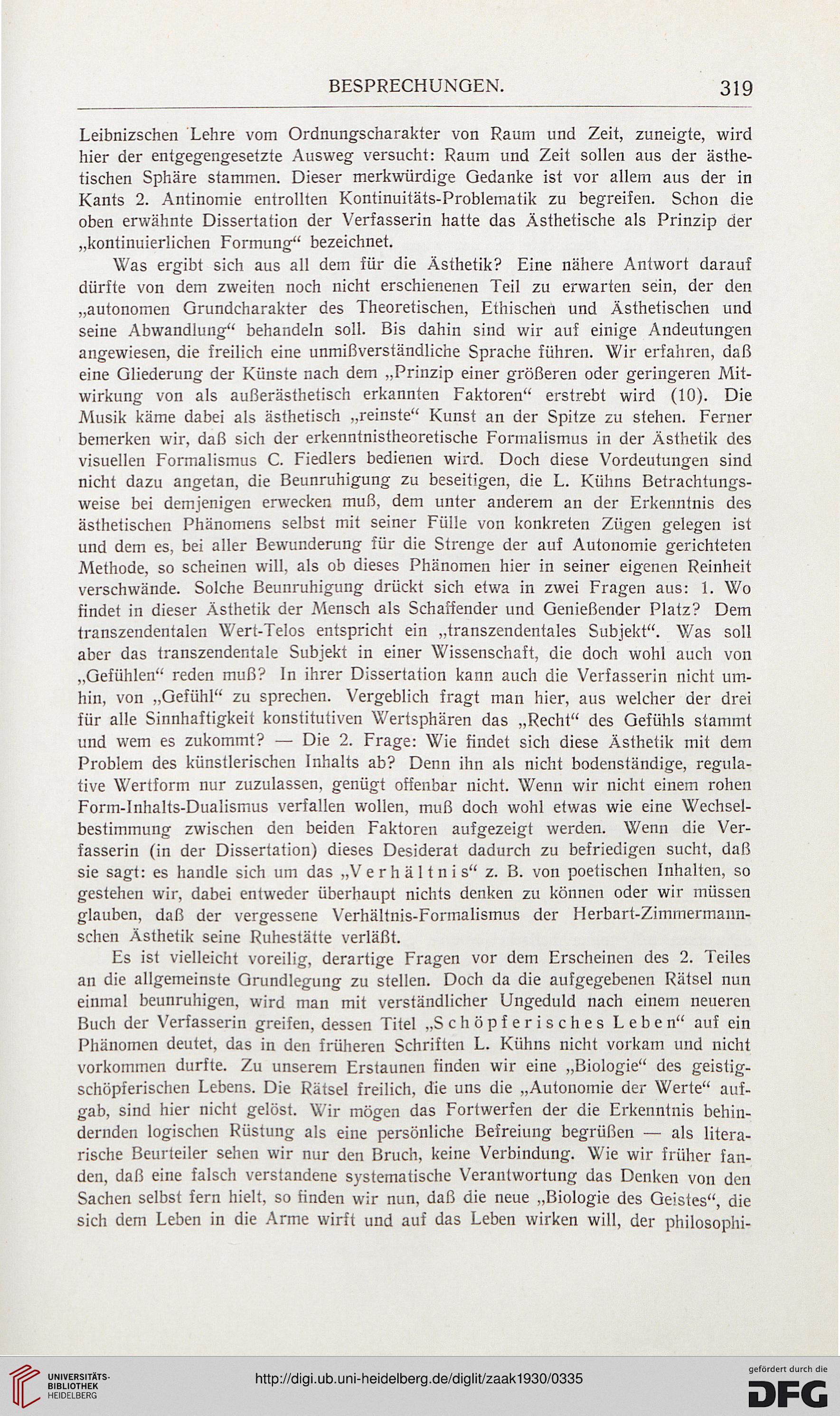BESPRECHUNGEN.
319
Leibnizschen Lehre vom Ordnungscharakter von Raum und Zeit, zuneigte, wird
hier der entgegengesetzte Ausweg versucht: Raum und Zeit sollen aus der ästhe-
tischen Sphäre stammen. Dieser merkwürdige Gedanke ist vor allem aus der in
Kants 2. Antinomie entrollten Kontinuitäts-Problematik zu begreifen. Schon die
oben erwähnte Dissertation der Verfasserin hatte das Ästhetische als Prinzip der
„kontinuierlichen Formung" bezeichnet.
Was ergibt sich aus all dem für die Ästhetik? Eine nähere Antwort darauf
dürfte von dem zweiten noch nicht erschienenen Teil zu erwarten sein, der den
„autonomen Grundcharakter des Theoretischen, Ethischen und Ästhetischen und
seine Abwandlung" behandeln soll. Bis dahin sind wir auf einige Andeutungen
angewiesen, die freilich eine unmißverständliche Sprache führen. Wir erfahren, daß
eine Gliederung der Künste nach dem „Prinzip einer größeren oder geringeren Mit-
wirkung von als außerästhetisch erkannten Faktoren" erstrebt wird (10). Die
Musik käme dabei als ästhetisch „reinste" Kunst an der Spitze zu stehen. Ferner
bemerken wir, daß sich der erkenntnistheoretische Formalismus in der Ästhetik des
visuellen Formalismus C. Fiedlers bedienen wird. Doch diese Vordeutungen sind
nicht dazu angetan, die Beunruhigung zu beseitigen, die L. Kühns Betrachtungs-
weise bei demjenigen erwecken muß, dem unter anderem an der Erkenntnis des
ästhetischen Phänomens selbst mit seiner Fülle von konkreten Zügen gelegen ist
und dem es, bei aller Bewunderung für die Strenge der auf Autonomie gerichteten
Methode, so scheinen will, als ob dieses Phänomen hier in seiner eigenen Reinheit
verschwände. Solche Beunruhigung drückt sich etwa in zwei Fragen aus: 1. Wo
findet in dieser Ästhetik der Mensch als Schaffender und Genießender Platz? Dem
transzendentalen Wert-Telos entspricht ein „transzendentales Subjekt". Was soll
aber das transzendentale Subjekt in einer Wissenschaft, die doch wohl auch von
„Gefühlen" reden muß? In ihrer Dissertation kann auch die Verfasserin nicht um-
hin, von „Gefühl" zu sprechen. Vergeblich fragt man hier, aus welcher der drei
für alle Sinnhaftigkeit konstitutiven Wertsphären das „Recht" des Gefühls stammt
und wem es zukommt? — Die 2. Frage: Wie findet sich diese Ästhetik mit dem
Problem des künstlerischen Inhalts ab? Denn ihn als nicht bodenständige, regula-
tive Wertform nur zuzulassen, genügt offenbar nicht. Wenn wir nicht einem rohen
Form-Inhalts-Dualismus verfallen wollen, muß doch wohl etwas wie eine Wechsel-
bestimmung zwischen den beiden Faktoren aufgezeigt werden. Wenn die Ver-
fasserin (in der Dissertation) dieses Desiderat dadurch zu befriedigen sucht, daß
sie sagt: es handle sich um das „Verhältnis" z. B. von poetischen Inhalten, so
gestehen wir, dabei entweder überhaupt nichts denken zu können oder wir müssen
glauben, daß der vergessene Verhältnis-Formalismus der Herbart-Zimmermaun-
schen Ästhetik seine Ruhestätte verläßt.
Es ist vielleicht voreilig, derartige Fragen vor dem Erscheinen des 2. Teiles
an die allgemeinste Grundlegung zu stellen. Doch da die aufgegebenen Rätsel nun
einmal beunruhigen, wird man mit verständlicher Ungeduld nach einem neueren
Buch der Verfasserin greifen, dessen Titel „Schöpferisches Leben" auf ein
Phänomen deutet, das in den früheren Schriften L. Kühns nicht vorkam und nicht
vorkommen durfte. Zu unserem Erstaunen finden wir eine „Biologie" des geistig-
schöpferischen Lebens. Die Rätsel freilich, die uns die „Autonomie der Werte" auf-
gab, sind hier nicht gelöst. Wir mögen das Fortwerfen der die Erkenntnis behin-
dernden logischen Rüstung als eine persönliche Befreiung begrüßen — als litera-
rische Beurteiler sehen wir nur den Bruch, keine Verbindung. Wie wir früher fan-
den, daß eine falsch verstandene systematische Verantwortung das Denken von den
Sachen selbst fern hielt, so finden wir nun, daß die neue „Biologie des Geistes", die
sich dem Leben in die Arme wirft und auf das Leben wirken will, der philosophi-
319
Leibnizschen Lehre vom Ordnungscharakter von Raum und Zeit, zuneigte, wird
hier der entgegengesetzte Ausweg versucht: Raum und Zeit sollen aus der ästhe-
tischen Sphäre stammen. Dieser merkwürdige Gedanke ist vor allem aus der in
Kants 2. Antinomie entrollten Kontinuitäts-Problematik zu begreifen. Schon die
oben erwähnte Dissertation der Verfasserin hatte das Ästhetische als Prinzip der
„kontinuierlichen Formung" bezeichnet.
Was ergibt sich aus all dem für die Ästhetik? Eine nähere Antwort darauf
dürfte von dem zweiten noch nicht erschienenen Teil zu erwarten sein, der den
„autonomen Grundcharakter des Theoretischen, Ethischen und Ästhetischen und
seine Abwandlung" behandeln soll. Bis dahin sind wir auf einige Andeutungen
angewiesen, die freilich eine unmißverständliche Sprache führen. Wir erfahren, daß
eine Gliederung der Künste nach dem „Prinzip einer größeren oder geringeren Mit-
wirkung von als außerästhetisch erkannten Faktoren" erstrebt wird (10). Die
Musik käme dabei als ästhetisch „reinste" Kunst an der Spitze zu stehen. Ferner
bemerken wir, daß sich der erkenntnistheoretische Formalismus in der Ästhetik des
visuellen Formalismus C. Fiedlers bedienen wird. Doch diese Vordeutungen sind
nicht dazu angetan, die Beunruhigung zu beseitigen, die L. Kühns Betrachtungs-
weise bei demjenigen erwecken muß, dem unter anderem an der Erkenntnis des
ästhetischen Phänomens selbst mit seiner Fülle von konkreten Zügen gelegen ist
und dem es, bei aller Bewunderung für die Strenge der auf Autonomie gerichteten
Methode, so scheinen will, als ob dieses Phänomen hier in seiner eigenen Reinheit
verschwände. Solche Beunruhigung drückt sich etwa in zwei Fragen aus: 1. Wo
findet in dieser Ästhetik der Mensch als Schaffender und Genießender Platz? Dem
transzendentalen Wert-Telos entspricht ein „transzendentales Subjekt". Was soll
aber das transzendentale Subjekt in einer Wissenschaft, die doch wohl auch von
„Gefühlen" reden muß? In ihrer Dissertation kann auch die Verfasserin nicht um-
hin, von „Gefühl" zu sprechen. Vergeblich fragt man hier, aus welcher der drei
für alle Sinnhaftigkeit konstitutiven Wertsphären das „Recht" des Gefühls stammt
und wem es zukommt? — Die 2. Frage: Wie findet sich diese Ästhetik mit dem
Problem des künstlerischen Inhalts ab? Denn ihn als nicht bodenständige, regula-
tive Wertform nur zuzulassen, genügt offenbar nicht. Wenn wir nicht einem rohen
Form-Inhalts-Dualismus verfallen wollen, muß doch wohl etwas wie eine Wechsel-
bestimmung zwischen den beiden Faktoren aufgezeigt werden. Wenn die Ver-
fasserin (in der Dissertation) dieses Desiderat dadurch zu befriedigen sucht, daß
sie sagt: es handle sich um das „Verhältnis" z. B. von poetischen Inhalten, so
gestehen wir, dabei entweder überhaupt nichts denken zu können oder wir müssen
glauben, daß der vergessene Verhältnis-Formalismus der Herbart-Zimmermaun-
schen Ästhetik seine Ruhestätte verläßt.
Es ist vielleicht voreilig, derartige Fragen vor dem Erscheinen des 2. Teiles
an die allgemeinste Grundlegung zu stellen. Doch da die aufgegebenen Rätsel nun
einmal beunruhigen, wird man mit verständlicher Ungeduld nach einem neueren
Buch der Verfasserin greifen, dessen Titel „Schöpferisches Leben" auf ein
Phänomen deutet, das in den früheren Schriften L. Kühns nicht vorkam und nicht
vorkommen durfte. Zu unserem Erstaunen finden wir eine „Biologie" des geistig-
schöpferischen Lebens. Die Rätsel freilich, die uns die „Autonomie der Werte" auf-
gab, sind hier nicht gelöst. Wir mögen das Fortwerfen der die Erkenntnis behin-
dernden logischen Rüstung als eine persönliche Befreiung begrüßen — als litera-
rische Beurteiler sehen wir nur den Bruch, keine Verbindung. Wie wir früher fan-
den, daß eine falsch verstandene systematische Verantwortung das Denken von den
Sachen selbst fern hielt, so finden wir nun, daß die neue „Biologie des Geistes", die
sich dem Leben in die Arme wirft und auf das Leben wirken will, der philosophi-