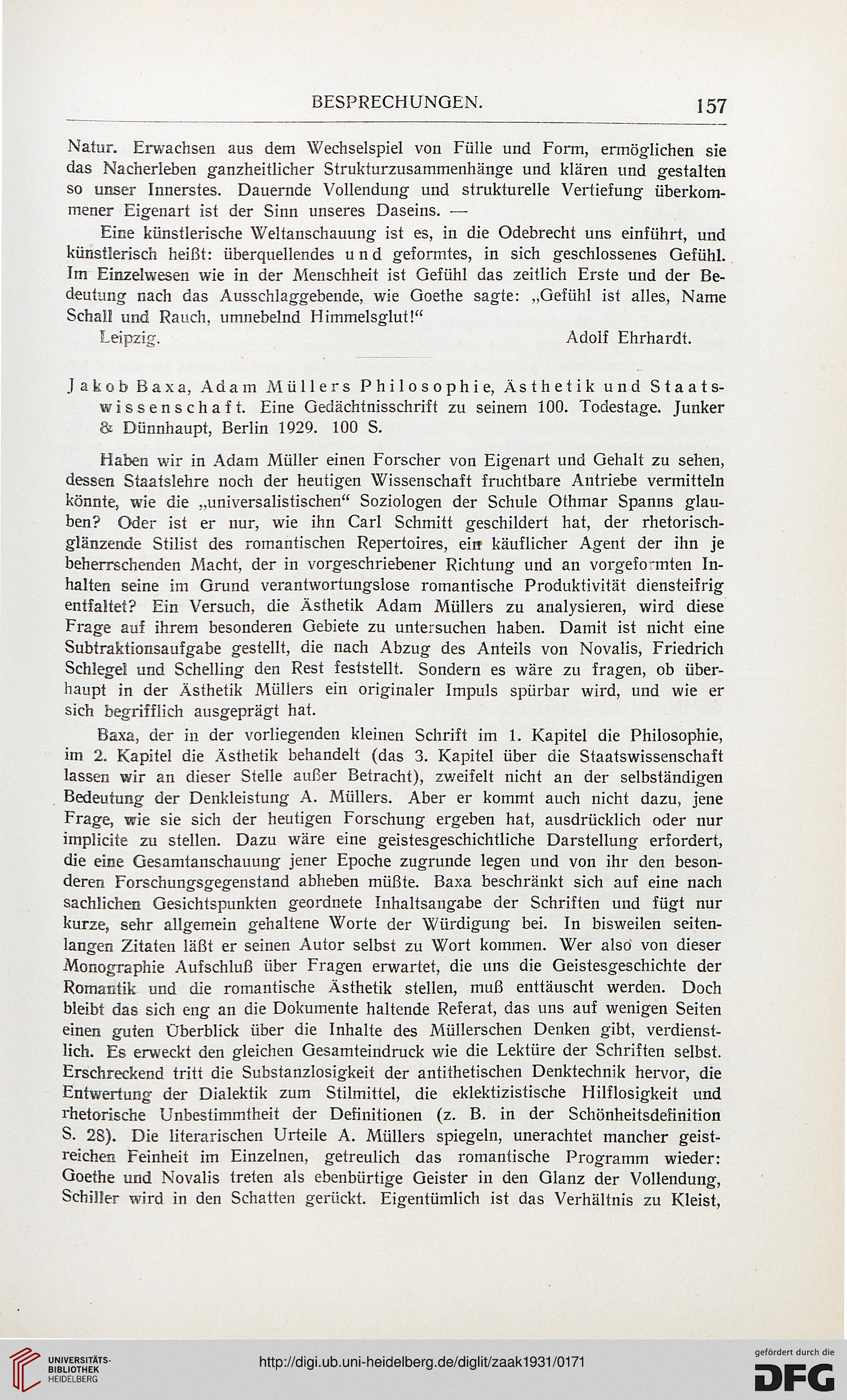BESPRECHUNGEN.
157
Natur. Erwachsen aus dem Wechselspiel von Fülle und Form, ermöglichen sie
das Nacherleben ganzheitlicher Strukturzusammenhänge und klären und gestalten
so unser Innerstes. Dauernde Vollendung und strukturelle Vertiefung überkom-
mener Eigenart ist der Sinn unseres Daseins. —
Eine künstlerische Weltanschauung ist es, in die Odebrecht uns einführt, und
künstlerisch heißt: überquellendes und geformtes, in sich geschlossenes Gefühl.
Im Einzelwesen wie in der Menschheit ist Gefühl das zeitlich Erste und der Be-
deutung nach das Ausschlaggebende, wie Goethe sagte: „Gefühl ist alles, Name
Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut!"
Leipzig. Adolf Ehrhardt.
Jakob Baxa, Adam Müllers Philosophie, Ästhetik und Staats-
wissenschaft. Eine Gedächtnisschrift zu seinem 100. Todestage. Junker
& Dünnhaupt, Berlin 1929. 100 S.
Haben wir in Adam Müller einen Forscher von Eigenart und Gehalt zu sehen,
dessen Staatslehre noch der heutigen Wissenschaft fruchtbare Antriebe vermitteln
könnte, wie die „universalistischen" Soziologen der Schule Othmar Spanns glau-
ben? Oder ist er nur, wie ihn Carl Schmitt geschildert hat, der rhetorisch-
glänzende Stilist des romantischen Repertoires, ein käuflicher Agent der ihn je
beherrschenden Macht, der in vorgeschriebener Richtung und an vorgefo'mten In-
halten seine im Grund verantwortungslose romantische Produktivität diensteifrig
entfaltet? Ein Versuch, die Ästhetik Adam Müllers zu analysieren, wird diese
Frage auf ihrem besonderen Gebiete zu untersuchen haben. Damit ist nicht eine
Subtraktionsaufgabe gestellt, die nach Abzug des Anteils von Novalis, Friedrich
Schlegel und Schelling den Rest feststellt. Sondern es wäre zu fragen, ob über-
haupt in der Ästhetik Müllers ein originaler Impuls spürbar wird, und wie er
sich begrifflich ausgeprägt hat.
Baxa, der in der vorliegenden kleinen Schrift im 1. Kapitel die Philosophie,
im 2. Kapitel die Ästhetik behandelt (das 3. Kapitel über die Staatswissenschaft
lassen wir an dieser Stelle außer Betracht), zweifelt nicht an der selbständigen
Bedeutung der Denkleistung A. Müllers. Aber er kommt auch nicht dazu, jene
Frage, wie sie sich der heutigen Forschung ergeben hat, ausdrücklich oder nur
implicite zu stellen. Dazu wäre eine geistesgeschichtliche Darstellung erfordert,
die eine Gesamtanschauung jener Epoche zugrunde legen und von ihr den beson-
deren Forschungsgegenstand abheben müßte. Baxa beschränkt sich auf eine nach
sachlichen Gesichtspunkten geordnete Inhaltsangabe der Schriften und fügt nur
kurze, sehr allgemein gehaltene Worte der Würdigung bei. In bisweilen seiten-
langen Zitaten läßt er seinen Autor selbst zu Wort kommen. Wer also von dieser
Monographie Aufschluß über Fragen erwartet, die uns die Geistesgeschichte der
Romantik und die romantische Ästhetik stellen, muß enttäuscht werden. Doch
bleibt das sich eng an die Dokumente haltende Referat, das uns auf wenigen Seiten
einen guten Überblick über die Inhalte des Müllerschen Denken gibt, verdienst-
lich. Es erweckt den gleichen Gesamteindruck wie die Lektüre der Schriften selbst.
Erschreckend tritt die Substanzlosigkeit der antithetischen Denktechnik hervor, die
Entwertung der Dialektik zum Stilmittel, die eklektizistische Hilflosigkeit und
rhetorische Unbestimmtheit der Definitionen (z. B. in der Schönheitsdefinition
S. 28). Die literarischen Urteile A. Müllers spiegeln, unerachtet mancher geist-
reichen Feinheit im Einzelnen, getreulich das romantische Programm wieder:
Goethe und Novalis treten als ebenbürtige Geister in den Glanz der Vollendung,
Schiller wird in den Schatten gerückt. Eigentümlich ist das Verhältnis zu Kleist,
157
Natur. Erwachsen aus dem Wechselspiel von Fülle und Form, ermöglichen sie
das Nacherleben ganzheitlicher Strukturzusammenhänge und klären und gestalten
so unser Innerstes. Dauernde Vollendung und strukturelle Vertiefung überkom-
mener Eigenart ist der Sinn unseres Daseins. —
Eine künstlerische Weltanschauung ist es, in die Odebrecht uns einführt, und
künstlerisch heißt: überquellendes und geformtes, in sich geschlossenes Gefühl.
Im Einzelwesen wie in der Menschheit ist Gefühl das zeitlich Erste und der Be-
deutung nach das Ausschlaggebende, wie Goethe sagte: „Gefühl ist alles, Name
Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut!"
Leipzig. Adolf Ehrhardt.
Jakob Baxa, Adam Müllers Philosophie, Ästhetik und Staats-
wissenschaft. Eine Gedächtnisschrift zu seinem 100. Todestage. Junker
& Dünnhaupt, Berlin 1929. 100 S.
Haben wir in Adam Müller einen Forscher von Eigenart und Gehalt zu sehen,
dessen Staatslehre noch der heutigen Wissenschaft fruchtbare Antriebe vermitteln
könnte, wie die „universalistischen" Soziologen der Schule Othmar Spanns glau-
ben? Oder ist er nur, wie ihn Carl Schmitt geschildert hat, der rhetorisch-
glänzende Stilist des romantischen Repertoires, ein käuflicher Agent der ihn je
beherrschenden Macht, der in vorgeschriebener Richtung und an vorgefo'mten In-
halten seine im Grund verantwortungslose romantische Produktivität diensteifrig
entfaltet? Ein Versuch, die Ästhetik Adam Müllers zu analysieren, wird diese
Frage auf ihrem besonderen Gebiete zu untersuchen haben. Damit ist nicht eine
Subtraktionsaufgabe gestellt, die nach Abzug des Anteils von Novalis, Friedrich
Schlegel und Schelling den Rest feststellt. Sondern es wäre zu fragen, ob über-
haupt in der Ästhetik Müllers ein originaler Impuls spürbar wird, und wie er
sich begrifflich ausgeprägt hat.
Baxa, der in der vorliegenden kleinen Schrift im 1. Kapitel die Philosophie,
im 2. Kapitel die Ästhetik behandelt (das 3. Kapitel über die Staatswissenschaft
lassen wir an dieser Stelle außer Betracht), zweifelt nicht an der selbständigen
Bedeutung der Denkleistung A. Müllers. Aber er kommt auch nicht dazu, jene
Frage, wie sie sich der heutigen Forschung ergeben hat, ausdrücklich oder nur
implicite zu stellen. Dazu wäre eine geistesgeschichtliche Darstellung erfordert,
die eine Gesamtanschauung jener Epoche zugrunde legen und von ihr den beson-
deren Forschungsgegenstand abheben müßte. Baxa beschränkt sich auf eine nach
sachlichen Gesichtspunkten geordnete Inhaltsangabe der Schriften und fügt nur
kurze, sehr allgemein gehaltene Worte der Würdigung bei. In bisweilen seiten-
langen Zitaten läßt er seinen Autor selbst zu Wort kommen. Wer also von dieser
Monographie Aufschluß über Fragen erwartet, die uns die Geistesgeschichte der
Romantik und die romantische Ästhetik stellen, muß enttäuscht werden. Doch
bleibt das sich eng an die Dokumente haltende Referat, das uns auf wenigen Seiten
einen guten Überblick über die Inhalte des Müllerschen Denken gibt, verdienst-
lich. Es erweckt den gleichen Gesamteindruck wie die Lektüre der Schriften selbst.
Erschreckend tritt die Substanzlosigkeit der antithetischen Denktechnik hervor, die
Entwertung der Dialektik zum Stilmittel, die eklektizistische Hilflosigkeit und
rhetorische Unbestimmtheit der Definitionen (z. B. in der Schönheitsdefinition
S. 28). Die literarischen Urteile A. Müllers spiegeln, unerachtet mancher geist-
reichen Feinheit im Einzelnen, getreulich das romantische Programm wieder:
Goethe und Novalis treten als ebenbürtige Geister in den Glanz der Vollendung,
Schiller wird in den Schatten gerückt. Eigentümlich ist das Verhältnis zu Kleist,