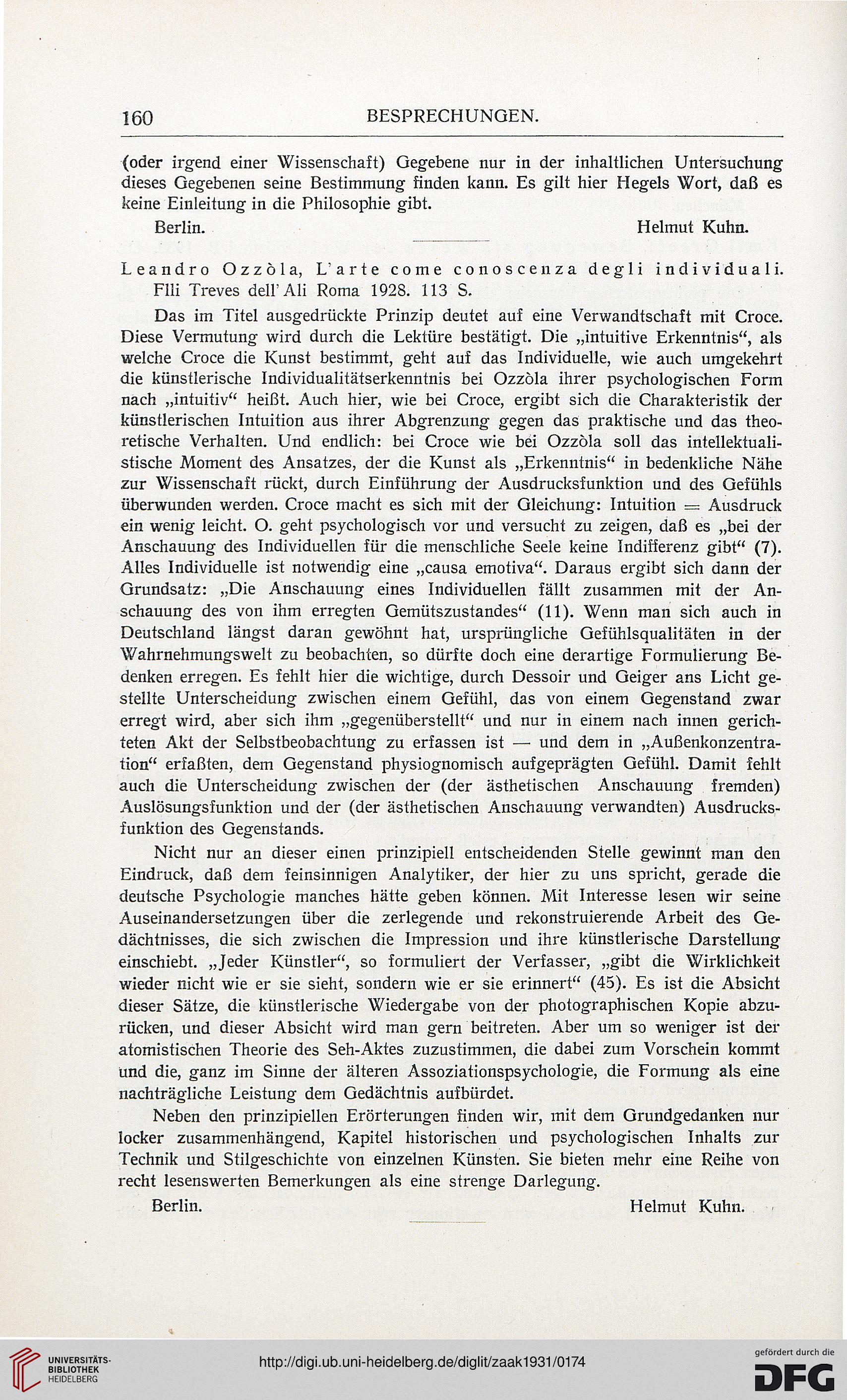160
BESPRECHUNGEN.
(oder irgend einer Wissenschaft) Gegebene nur in der inhaltlichen Untersuchung
dieses Gegebenen seine Bestimmung finden kann. Es gilt hier Hegels Wort, daß es
keine Einleitung in die Philosophie gibt.
Berlin. Helmut Kuhn.
Leandro Ozzöla, L'arte come conoscenza degli individuali.
Flli Treves dell" Ali Roma 1928. 113 S.
Das im Titel ausgedrückte Prinzip deutet auf eine Verwandtschaft mit Croce.
Diese Vermutung wird durch die Lektüre bestätigt. Die „intuitive Erkenntnis", als
welche Croce die Kunst bestimmt, geht auf das Individuelle, wie auch umgekehrt
die künstlerische Individualitätserkenntnis bei Ozzöla ihrer psychologischen Form
nach „intuitiv" heißt. Auch hier, wie bei Croce, ergibt sich die Charakteristik der
künstlerischen Intuition aus ihrer Abgrenzung gegen das praktische und das theo-
retische Verhalten. Und endlich: bei Croce wie bei Ozzöla soll das intellektuali-
stische Moment des Ansatzes, der die Kunst als „Erkenntnis" in bedenkliche Nähe
zur Wissenschaft rückt, durch Einführung der Ausdrucksfunktion und des Gefühls
überwunden werden. Croce macht es sich mit der Gleichung: Intuition = Ausdruck
ein wenig leicht. O. geht psychologisch vor und versucht zu zeigen, daß es „bei der
Anschauung des Individuellen für die menschliche Seele keine Indifferenz gibt" (7).
Alles Individuelle ist notwendig eine „causa emotiva". Daraus ergibt sich dann der
Grundsatz: „Die Anschauung eines Individuellen fällt zusammen mit der An-
schauung des von ihm erregten Gemütszustandes" (11). Wenn man sich auch in
Deutschland längst daran gewöhnt hat, ursprüngliche Gefühlsqualitäten in der
Wahrnehmungswelt zu beobachten, so dürfte doch eine derartige Formulierung Be-
denken erregen. Es fehlt hier die wichtige, durch Dessoir und Geiger ans Licht ge-
stellte Unterscheidung zwischen einem Gefühl, das von einem Gegenstand zwar
erregt wird, aber sich ihm „gegenüberstellt" und nur in einem nach innen gerich-
teten Akt der Selbstbeobachtung zu erfassen ist — und dem in „Außenkonzentra-
tion" erfaßten, dem Gegenstand physiognomisch aufgeprägten Gefühl. Damit fehlt
auch die Unterscheidung zwischen der (der ästhetischen Anschauung fremden)
Auslösungsfunktion und der (der ästhetischen Anschauung verwandten) Ausdrucks-
funktion des Gegenstands.
Nicht nur an dieser einen prinzipiell entscheidenden Stelle gewinnt man den
Eindruck, daß dem feinsinnigen Analytiker, der hier zu uns spricht, gerade die
deutsche Psychologie manches hätte geben können. Mit Interesse lesen wir seine
Auseinandersetzungen über die zerlegende und rekonstruierende Arbeit des Ge-
dächtnisses, die sich zwischen die Impression und ihre künstlerische Darstellung
einschiebt. „Jeder Künstler", so formuliert der Verfasser, „gibt die Wirklichkeit
wieder nicht wie er sie sieht, sondern wie er sie erinnert" (45). Es ist die Absicht
dieser Sätze, die künstlerische Wiedergabe von der photographischen Kopie abzu-
rücken, und dieser Absicht wird man gern beitreten. Aber um so weniger ist der
atomistischen Theorie des Seh-Aktes zuzustimmen, die dabei zum Vorschein kommt
und die, ganz im Sinne der älteren Assoziationspsychologie, die Formung als eine
nachträgliche Leistung dem Gedächtnis aufbürdet.
Neben den prinzipiellen Erörterungen finden wir, mit dem Grundgedanken nur
locker zusammenhängend, Kapitel historischen und psychologischen Inhalts zur
Technik und Stilgeschichte von einzelnen Künsten. Sie bieten mehr eine Reihe von
recht lesenswerten Bemerkungen als eine strenge Darlegung.
Berlin. Helmut Kuhn.
%
BESPRECHUNGEN.
(oder irgend einer Wissenschaft) Gegebene nur in der inhaltlichen Untersuchung
dieses Gegebenen seine Bestimmung finden kann. Es gilt hier Hegels Wort, daß es
keine Einleitung in die Philosophie gibt.
Berlin. Helmut Kuhn.
Leandro Ozzöla, L'arte come conoscenza degli individuali.
Flli Treves dell" Ali Roma 1928. 113 S.
Das im Titel ausgedrückte Prinzip deutet auf eine Verwandtschaft mit Croce.
Diese Vermutung wird durch die Lektüre bestätigt. Die „intuitive Erkenntnis", als
welche Croce die Kunst bestimmt, geht auf das Individuelle, wie auch umgekehrt
die künstlerische Individualitätserkenntnis bei Ozzöla ihrer psychologischen Form
nach „intuitiv" heißt. Auch hier, wie bei Croce, ergibt sich die Charakteristik der
künstlerischen Intuition aus ihrer Abgrenzung gegen das praktische und das theo-
retische Verhalten. Und endlich: bei Croce wie bei Ozzöla soll das intellektuali-
stische Moment des Ansatzes, der die Kunst als „Erkenntnis" in bedenkliche Nähe
zur Wissenschaft rückt, durch Einführung der Ausdrucksfunktion und des Gefühls
überwunden werden. Croce macht es sich mit der Gleichung: Intuition = Ausdruck
ein wenig leicht. O. geht psychologisch vor und versucht zu zeigen, daß es „bei der
Anschauung des Individuellen für die menschliche Seele keine Indifferenz gibt" (7).
Alles Individuelle ist notwendig eine „causa emotiva". Daraus ergibt sich dann der
Grundsatz: „Die Anschauung eines Individuellen fällt zusammen mit der An-
schauung des von ihm erregten Gemütszustandes" (11). Wenn man sich auch in
Deutschland längst daran gewöhnt hat, ursprüngliche Gefühlsqualitäten in der
Wahrnehmungswelt zu beobachten, so dürfte doch eine derartige Formulierung Be-
denken erregen. Es fehlt hier die wichtige, durch Dessoir und Geiger ans Licht ge-
stellte Unterscheidung zwischen einem Gefühl, das von einem Gegenstand zwar
erregt wird, aber sich ihm „gegenüberstellt" und nur in einem nach innen gerich-
teten Akt der Selbstbeobachtung zu erfassen ist — und dem in „Außenkonzentra-
tion" erfaßten, dem Gegenstand physiognomisch aufgeprägten Gefühl. Damit fehlt
auch die Unterscheidung zwischen der (der ästhetischen Anschauung fremden)
Auslösungsfunktion und der (der ästhetischen Anschauung verwandten) Ausdrucks-
funktion des Gegenstands.
Nicht nur an dieser einen prinzipiell entscheidenden Stelle gewinnt man den
Eindruck, daß dem feinsinnigen Analytiker, der hier zu uns spricht, gerade die
deutsche Psychologie manches hätte geben können. Mit Interesse lesen wir seine
Auseinandersetzungen über die zerlegende und rekonstruierende Arbeit des Ge-
dächtnisses, die sich zwischen die Impression und ihre künstlerische Darstellung
einschiebt. „Jeder Künstler", so formuliert der Verfasser, „gibt die Wirklichkeit
wieder nicht wie er sie sieht, sondern wie er sie erinnert" (45). Es ist die Absicht
dieser Sätze, die künstlerische Wiedergabe von der photographischen Kopie abzu-
rücken, und dieser Absicht wird man gern beitreten. Aber um so weniger ist der
atomistischen Theorie des Seh-Aktes zuzustimmen, die dabei zum Vorschein kommt
und die, ganz im Sinne der älteren Assoziationspsychologie, die Formung als eine
nachträgliche Leistung dem Gedächtnis aufbürdet.
Neben den prinzipiellen Erörterungen finden wir, mit dem Grundgedanken nur
locker zusammenhängend, Kapitel historischen und psychologischen Inhalts zur
Technik und Stilgeschichte von einzelnen Künsten. Sie bieten mehr eine Reihe von
recht lesenswerten Bemerkungen als eine strenge Darlegung.
Berlin. Helmut Kuhn.
%