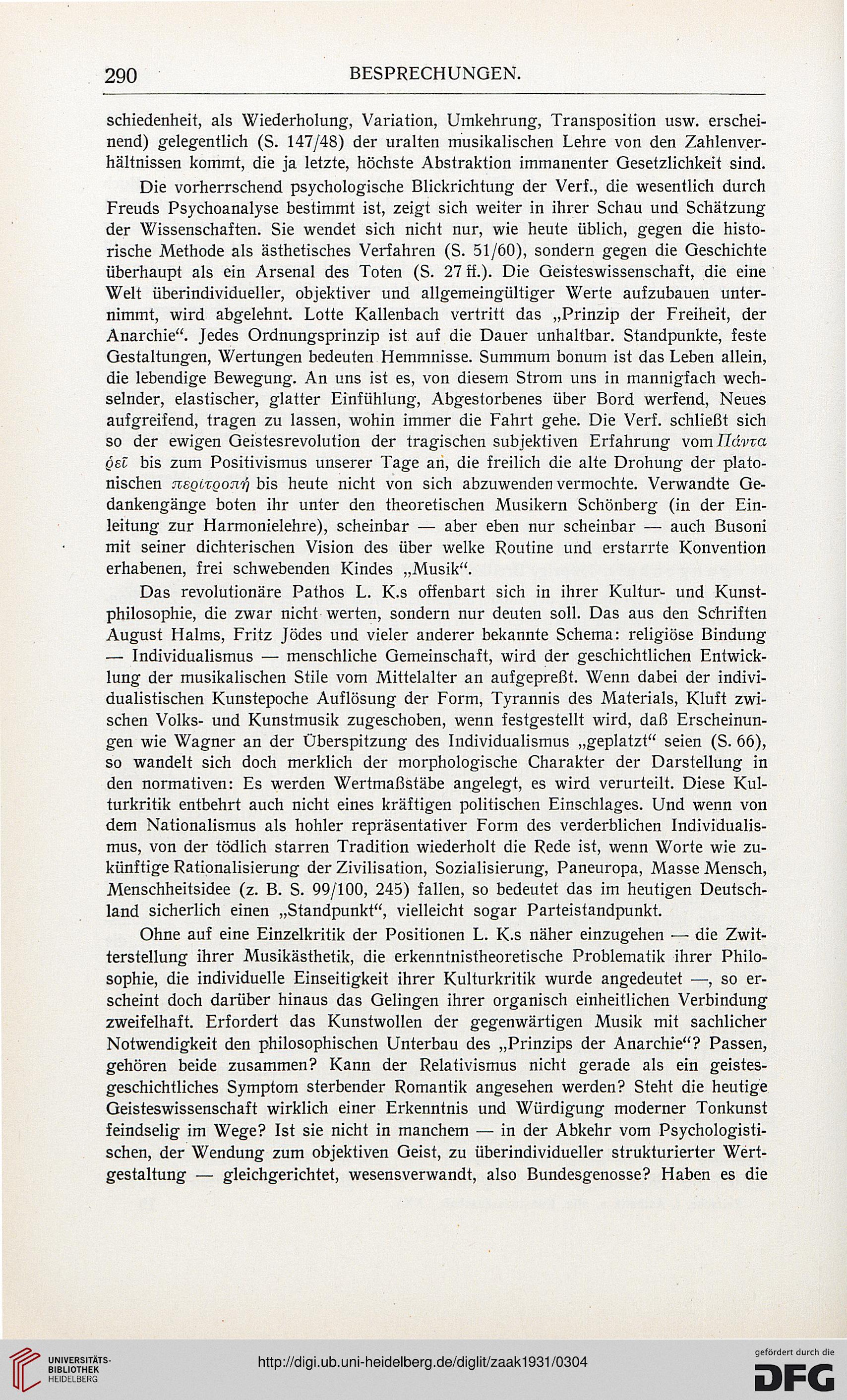290
BESPRECHUNGEN.
schiedenheit, als Wiederholung, Variation, Umkehrung, Transposition usw. erschei-
nend) gelegentlich (S. 147/48) der uralten musikalischen Lehre von den Zahlenver-
hältnissen kommt, die ja letzte, höchste Abstraktion immanenter Gesetzlichkeit sind.
Die vorherrschend psychologische Blickrichtung der Verf., die wesentlich durch
Freuds Psychoanalyse bestimmt ist, zeigt sich weiter in ihrer Schau und Schätzung
der Wissenschaften. Sie wendet sich nicht nur, wie heute üblich, gegen die histo-
rische Methode als ästhetisches Verfahren (S. 51/60), sondern gegen die Geschichte
überhaupt als ein Arsenal des Toten (S. 27 ff.). Die Geisteswissenschaft, die eine
Welt überindividueller, objektiver und allgemeingültiger Werte aufzubauen unter-
nimmt, wird abgelehnt. Lotte Kallenbach vertritt das „Prinzip der Freiheit, der
Anarchie". Jedes Ordnungsprinzip ist auf die Dauer unhaltbar. Standpunkte, feste
Gestaltungen, Wertungen bedeuten Hemmnisse. Summum bonum ist das Leben allein,
die lebendige Bewegung. An uns ist es, von diesem Strom uns in mannigfach wech-
selnder, elastischer, glatter Einfühlung, Abgestorbenes über Bord werfend, Neues
aufgreifend, tragen zu lassen, wohin immer die Fahrt gehe. Die Verf. schließt sich
so der ewigen Geistesrevolution der tragischen subjektiven Erfahrung vom üdwa
gel bis zum Positivismus unserer Tage an, die freilich die alte Drohung der plato-
nischen neoizQon'f) bis heute nicht von sich abzuwenden vermochte. Verwandte Ge-
dankengänge boten ihr unter den theoretischen Musikern Schönberg (in der Ein-
leitung zur Harmonielehre), scheinbar — aber eben nur scheinbar — auch Busoni
mit seiner dichterischen Vision des über welke Routine und erstarrte Konvention
erhabenen, frei schwebenden Kindes „Musik".
Das revolutionäre Pathos L. K.s offenbart sich in ihrer Kultur- und Kunst-
philosophie, die zwar nicht werten, sondern nur deuten soll. Das aus den Schriften
August Halms, Fritz Jodes und vieler anderer bekannte Schema: religiöse Bindung
— Individualismus — menschliche Gemeinschaft, wird der geschichtlichen Entwick-
lung der musikalischen Stile vom Mittelalter an aufgepreßt. Wenn dabei der indivi-
dualistischen Kunstepoche Auflösung der Form, Tyrannis des Materials, Kluft zwi-
schen Volks- und Kunstmusik zugeschoben, wenn festgestellt wird, daß Erscheinun-
gen wie Wagner an der Überspitzung des Individualismus „geplatzt" seien (S. 66),
so wandelt sich doch merklich der morphologische Charakter der Darstellung in
den normativen: Es werden Wertmaßstäbe angelegt, es wird verurteilt. Diese Kul-
turkritik entbehrt auch nicht eines kräftigen politischen Einschlages. Und wenn von
dem Nationalismus als hohler repräsentativer Form des verderblichen Individualis-
mus, von der tödlich starren Tradition wiederholt die Rede ist, wenn Worte wie zu-
künftige Rationalisierung der Zivilisation, Sozialisierung, Paneuropa, Masse Mensch,
Menschheitsidee (z. B. S. 99/100, 245) fallen, so bedeutet das im heutigen Deutsch-
land sicherlich einen „Standpunkt", vielleicht sogar Parteistandpunkt.
Ohne auf eine Einzelkritik der Positionen L. K.s näher einzugehen — die Zwit-
terstellung ihrer Musikästhetik, die erkenntnistheoretische Problematik ihrer Philo-
sophie, die individuelle Einseitigkeit ihrer Kulturkritik wurde angedeutet —, so er-
scheint doch darüber hinaus das Gelingen ihrer organisch einheitlichen Verbindung
zweifelhaft. Erfordert das Kunstwollen der gegenwärtigen Musik mit sachlicher
Notwendigkeit den philosophischen Unterbau des „Prinzips der Anarchie"? Passen,
gehören beide zusammen? Kann der Relativismus nicht gerade als ein geistes-
geschichtliches Symptom sterbender Romantik angesehen werden? Steht die heutige
Geisteswissenschaft wirklich einer Erkenntnis und Würdigung moderner Tonkunst
feindselig im Wege? Ist sie nicht in manchem — in der Abkehr vom Psychologisti-
schen, der Wendung zum objektiven Geist, zu überindividueller strukturierter Wert-
gestaltung — gleichgerichtet, wesensverwandt, also Bundesgenosse? Haben es die
BESPRECHUNGEN.
schiedenheit, als Wiederholung, Variation, Umkehrung, Transposition usw. erschei-
nend) gelegentlich (S. 147/48) der uralten musikalischen Lehre von den Zahlenver-
hältnissen kommt, die ja letzte, höchste Abstraktion immanenter Gesetzlichkeit sind.
Die vorherrschend psychologische Blickrichtung der Verf., die wesentlich durch
Freuds Psychoanalyse bestimmt ist, zeigt sich weiter in ihrer Schau und Schätzung
der Wissenschaften. Sie wendet sich nicht nur, wie heute üblich, gegen die histo-
rische Methode als ästhetisches Verfahren (S. 51/60), sondern gegen die Geschichte
überhaupt als ein Arsenal des Toten (S. 27 ff.). Die Geisteswissenschaft, die eine
Welt überindividueller, objektiver und allgemeingültiger Werte aufzubauen unter-
nimmt, wird abgelehnt. Lotte Kallenbach vertritt das „Prinzip der Freiheit, der
Anarchie". Jedes Ordnungsprinzip ist auf die Dauer unhaltbar. Standpunkte, feste
Gestaltungen, Wertungen bedeuten Hemmnisse. Summum bonum ist das Leben allein,
die lebendige Bewegung. An uns ist es, von diesem Strom uns in mannigfach wech-
selnder, elastischer, glatter Einfühlung, Abgestorbenes über Bord werfend, Neues
aufgreifend, tragen zu lassen, wohin immer die Fahrt gehe. Die Verf. schließt sich
so der ewigen Geistesrevolution der tragischen subjektiven Erfahrung vom üdwa
gel bis zum Positivismus unserer Tage an, die freilich die alte Drohung der plato-
nischen neoizQon'f) bis heute nicht von sich abzuwenden vermochte. Verwandte Ge-
dankengänge boten ihr unter den theoretischen Musikern Schönberg (in der Ein-
leitung zur Harmonielehre), scheinbar — aber eben nur scheinbar — auch Busoni
mit seiner dichterischen Vision des über welke Routine und erstarrte Konvention
erhabenen, frei schwebenden Kindes „Musik".
Das revolutionäre Pathos L. K.s offenbart sich in ihrer Kultur- und Kunst-
philosophie, die zwar nicht werten, sondern nur deuten soll. Das aus den Schriften
August Halms, Fritz Jodes und vieler anderer bekannte Schema: religiöse Bindung
— Individualismus — menschliche Gemeinschaft, wird der geschichtlichen Entwick-
lung der musikalischen Stile vom Mittelalter an aufgepreßt. Wenn dabei der indivi-
dualistischen Kunstepoche Auflösung der Form, Tyrannis des Materials, Kluft zwi-
schen Volks- und Kunstmusik zugeschoben, wenn festgestellt wird, daß Erscheinun-
gen wie Wagner an der Überspitzung des Individualismus „geplatzt" seien (S. 66),
so wandelt sich doch merklich der morphologische Charakter der Darstellung in
den normativen: Es werden Wertmaßstäbe angelegt, es wird verurteilt. Diese Kul-
turkritik entbehrt auch nicht eines kräftigen politischen Einschlages. Und wenn von
dem Nationalismus als hohler repräsentativer Form des verderblichen Individualis-
mus, von der tödlich starren Tradition wiederholt die Rede ist, wenn Worte wie zu-
künftige Rationalisierung der Zivilisation, Sozialisierung, Paneuropa, Masse Mensch,
Menschheitsidee (z. B. S. 99/100, 245) fallen, so bedeutet das im heutigen Deutsch-
land sicherlich einen „Standpunkt", vielleicht sogar Parteistandpunkt.
Ohne auf eine Einzelkritik der Positionen L. K.s näher einzugehen — die Zwit-
terstellung ihrer Musikästhetik, die erkenntnistheoretische Problematik ihrer Philo-
sophie, die individuelle Einseitigkeit ihrer Kulturkritik wurde angedeutet —, so er-
scheint doch darüber hinaus das Gelingen ihrer organisch einheitlichen Verbindung
zweifelhaft. Erfordert das Kunstwollen der gegenwärtigen Musik mit sachlicher
Notwendigkeit den philosophischen Unterbau des „Prinzips der Anarchie"? Passen,
gehören beide zusammen? Kann der Relativismus nicht gerade als ein geistes-
geschichtliches Symptom sterbender Romantik angesehen werden? Steht die heutige
Geisteswissenschaft wirklich einer Erkenntnis und Würdigung moderner Tonkunst
feindselig im Wege? Ist sie nicht in manchem — in der Abkehr vom Psychologisti-
schen, der Wendung zum objektiven Geist, zu überindividueller strukturierter Wert-
gestaltung — gleichgerichtet, wesensverwandt, also Bundesgenosse? Haben es die