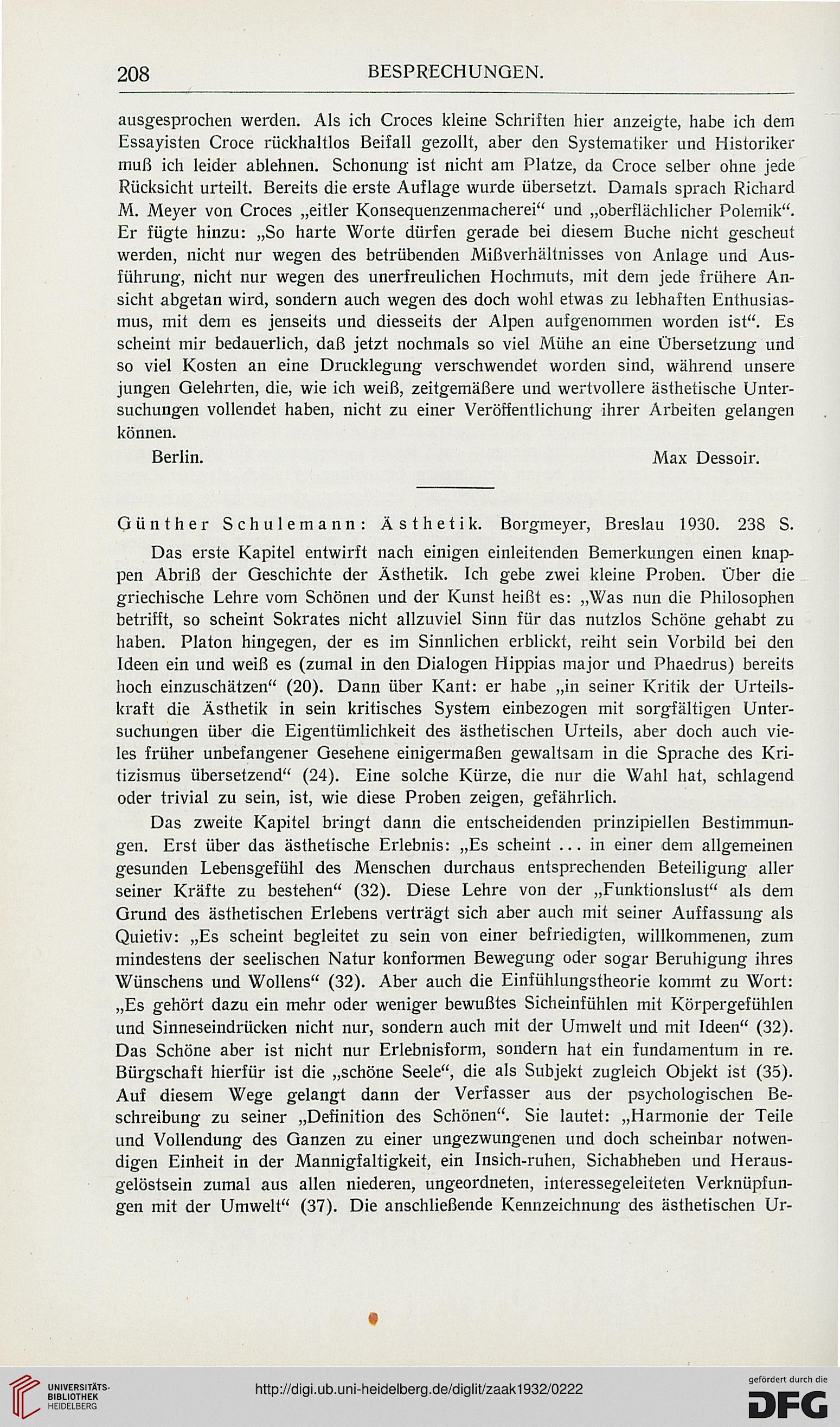208
BESPRECHUNGEN.
ausgesprochen werden. Als ich Croces kleine Schriften hier anzeigte, habe ich dem
Essayisten Croce rückhaltlos Beifall gezollt, aber den Systematiker und Historiker
muß ich leider ablehnen. Schonung ist nicht am Platze, da Croce selber ohne jede
Rücksicht urteilt. Bereits die erste Auflage wurde übersetzt. Damals sprach Richard
M. Meyer von Croces „eitler Konsequenzenmacherei" und „oberflächlicher Polemik".
Er fügte hinzu: „So harte Worte dürfen gerade bei diesem Buche nicht gescheut
werden, nicht nur wegen des betrübenden Mißverhältnisses von Anlage und Aus-
führung, nicht nur wegen des unerfreulichen Hochmuts, mit dem jede frühere An-
sicht abgetan wird, sondern auch wegen des doch wohl etwas zu lebhaften Enthusias-
mus, mit dem es jenseits und diesseits der Alpen aufgenommen worden ist". Es
scheint mir bedauerlich, daß jetzt nochmals so viel Mühe an eine Übersetzung und
so viel Kosten an eine Drucklegung verschwendet worden sind, während unsere
jungen Gelehrten, die, wie ich weiß, zeitgemäßere und wertvollere ästhetische Unter-
suchungen vollendet haben, nicht zu einer Veröffentlichung ihrer Arbeiten gelangen
können.
Berlin. Max Dessoir.
Günther Schulemann: Ästhetik. Borgmeyer, Breslau 1930. 238 S.
Das erste Kapitel entwirft nach einigen einleitenden Bemerkungen einen knap-
pen Abriß der Geschichte der Ästhetik. Ich gebe zwei kleine Proben. Über die
griechische Lehre vom Schönen und der Kunst heißt es: „Was nun die Philosophen
betrifft, so scheint Sokrates nicht allzuviel Sinn für das nutzlos Schöne gehabt zu
haben. Piaton hingegen, der es im Sinnlichen erblickt, reiht sein Vorbild bei den
Ideen ein und weiß es (zumal in den Dialogen Hippias major und Phaedrus) bereits
hoch einzuschätzen" (20). Dann über Kant: er habe „in seiner Kritik der Urteils-
kraft die Ästhetik in sein kritisches System einbezogen mit sorgfältigen Unter-
suchungen über die Eigentümlichkeit des ästhetischen Urteils, aber doch auch vie-
les früher unbefangener Gesehene einigermaßen gewaltsam in die Sprache des Kri-
tizismus übersetzend" (24). Eine solche Kürze, die nur die Wahl hat, schlagend
oder trivial zu sein, ist, wie diese Proben zeigen, gefährlich.
Das zweite Kapitel bringt dann die entscheidenden prinzipiellen Bestimmun-
gen. Erst über das ästhetische Erlebnis: „Es scheint ... in einer dem allgemeinen
gesunden Lebensgefühl des Menschen durchaus entsprechenden Beteiligung aller
seiner Kräfte zu bestehen" (32). Diese Lehre von der „Funktionslust" als dem
Grund des ästhetischen Erlebens verträgt sich aber auch mit seiner Auffassung als
Quietiv: „Es scheint begleitet zu sein von einer befriedigten, willkommenen, zum
mindestens der seelischen Natur konformen Bewegung oder sogar Beruhigung ihres
Wünschens und Wollens" (32). Aber auch die Einfühlungstheorie kommt zu Wort:
„Es gehört dazu ein mehr oder weniger bewußtes Sicheinfühlen mit Körpergefühlen
und Sinneseindrücken nicht nur, sondern auch mit der Umwelt und mit Ideen" (32).
Das Schöne aber ist nicht nur Erlebnisform, sondern hat ein fundamentum in re.
Bürgschaft hierfür ist die „schöne Seele", die als Subjekt zugleich Objekt ist (35).
Auf diesem Wege gelangt dann der Verfasser aus der psychologischen Be-
schreibung zu seiner „Definition des Schönen". Sie lautet: „Harmonie der Teile
und Vollendung des Ganzen zu einer ungezwungenen und doch scheinbar notwen-
digen Einheit in der Mannigfaltigkeit, ein Insich-ruhen, Sichabheben und Heraus-
gelöstsein zumal aus allen niederen, ungeordneten, interessegeleiteten Verknüpfun-
gen mit der Umwelt" (37). Die anschließende Kennzeichnung des ästhetischen Ur-
BESPRECHUNGEN.
ausgesprochen werden. Als ich Croces kleine Schriften hier anzeigte, habe ich dem
Essayisten Croce rückhaltlos Beifall gezollt, aber den Systematiker und Historiker
muß ich leider ablehnen. Schonung ist nicht am Platze, da Croce selber ohne jede
Rücksicht urteilt. Bereits die erste Auflage wurde übersetzt. Damals sprach Richard
M. Meyer von Croces „eitler Konsequenzenmacherei" und „oberflächlicher Polemik".
Er fügte hinzu: „So harte Worte dürfen gerade bei diesem Buche nicht gescheut
werden, nicht nur wegen des betrübenden Mißverhältnisses von Anlage und Aus-
führung, nicht nur wegen des unerfreulichen Hochmuts, mit dem jede frühere An-
sicht abgetan wird, sondern auch wegen des doch wohl etwas zu lebhaften Enthusias-
mus, mit dem es jenseits und diesseits der Alpen aufgenommen worden ist". Es
scheint mir bedauerlich, daß jetzt nochmals so viel Mühe an eine Übersetzung und
so viel Kosten an eine Drucklegung verschwendet worden sind, während unsere
jungen Gelehrten, die, wie ich weiß, zeitgemäßere und wertvollere ästhetische Unter-
suchungen vollendet haben, nicht zu einer Veröffentlichung ihrer Arbeiten gelangen
können.
Berlin. Max Dessoir.
Günther Schulemann: Ästhetik. Borgmeyer, Breslau 1930. 238 S.
Das erste Kapitel entwirft nach einigen einleitenden Bemerkungen einen knap-
pen Abriß der Geschichte der Ästhetik. Ich gebe zwei kleine Proben. Über die
griechische Lehre vom Schönen und der Kunst heißt es: „Was nun die Philosophen
betrifft, so scheint Sokrates nicht allzuviel Sinn für das nutzlos Schöne gehabt zu
haben. Piaton hingegen, der es im Sinnlichen erblickt, reiht sein Vorbild bei den
Ideen ein und weiß es (zumal in den Dialogen Hippias major und Phaedrus) bereits
hoch einzuschätzen" (20). Dann über Kant: er habe „in seiner Kritik der Urteils-
kraft die Ästhetik in sein kritisches System einbezogen mit sorgfältigen Unter-
suchungen über die Eigentümlichkeit des ästhetischen Urteils, aber doch auch vie-
les früher unbefangener Gesehene einigermaßen gewaltsam in die Sprache des Kri-
tizismus übersetzend" (24). Eine solche Kürze, die nur die Wahl hat, schlagend
oder trivial zu sein, ist, wie diese Proben zeigen, gefährlich.
Das zweite Kapitel bringt dann die entscheidenden prinzipiellen Bestimmun-
gen. Erst über das ästhetische Erlebnis: „Es scheint ... in einer dem allgemeinen
gesunden Lebensgefühl des Menschen durchaus entsprechenden Beteiligung aller
seiner Kräfte zu bestehen" (32). Diese Lehre von der „Funktionslust" als dem
Grund des ästhetischen Erlebens verträgt sich aber auch mit seiner Auffassung als
Quietiv: „Es scheint begleitet zu sein von einer befriedigten, willkommenen, zum
mindestens der seelischen Natur konformen Bewegung oder sogar Beruhigung ihres
Wünschens und Wollens" (32). Aber auch die Einfühlungstheorie kommt zu Wort:
„Es gehört dazu ein mehr oder weniger bewußtes Sicheinfühlen mit Körpergefühlen
und Sinneseindrücken nicht nur, sondern auch mit der Umwelt und mit Ideen" (32).
Das Schöne aber ist nicht nur Erlebnisform, sondern hat ein fundamentum in re.
Bürgschaft hierfür ist die „schöne Seele", die als Subjekt zugleich Objekt ist (35).
Auf diesem Wege gelangt dann der Verfasser aus der psychologischen Be-
schreibung zu seiner „Definition des Schönen". Sie lautet: „Harmonie der Teile
und Vollendung des Ganzen zu einer ungezwungenen und doch scheinbar notwen-
digen Einheit in der Mannigfaltigkeit, ein Insich-ruhen, Sichabheben und Heraus-
gelöstsein zumal aus allen niederen, ungeordneten, interessegeleiteten Verknüpfun-
gen mit der Umwelt" (37). Die anschließende Kennzeichnung des ästhetischen Ur-