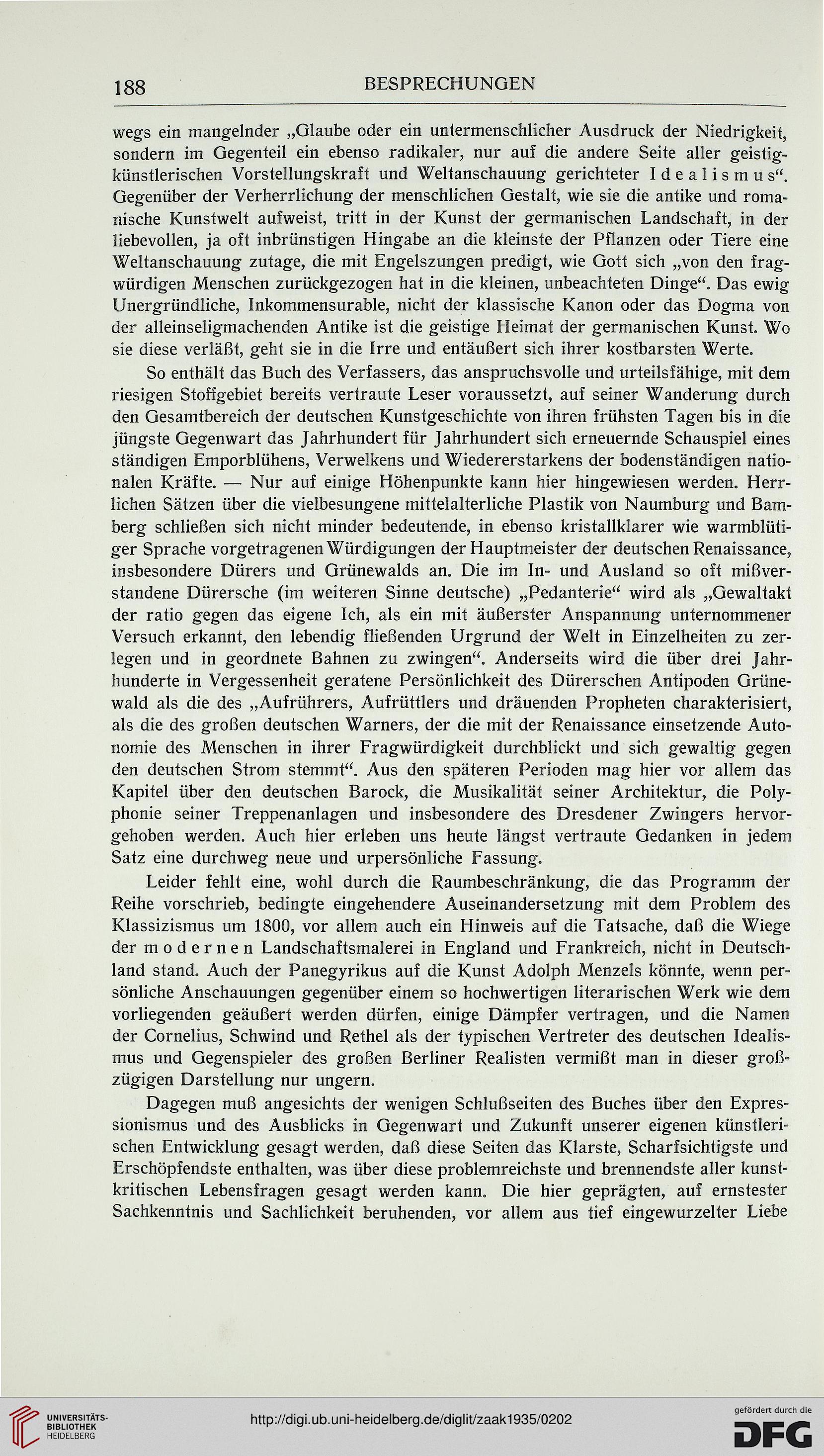188
BESPRECHUNGEN
wegs ein mangelnder „Glaube oder ein untermenschlicher Ausdruck der Niedrigkeit,
sondern im Gegenteil ein ebenso radikaler, nur auf die andere Seite aller geistig-
künstlerischen Vorstellungskraft und Weltanschauung gerichteter I d e a 1 i s m u s".
Gegenüber der Verherrlichung der menschlichen Gestalt, wie sie die antike und roma-
nische Kunstwelt aufweist, tritt in der Kunst der germanischen Landschaft, in der
liebevollen, ja oft inbrünstigen Hingabe an die kleinste der Pflanzen oder Tiere eine
Weltanschauung zutage, die mit Engelszungen predigt, wie Gott sich „von den frag-
würdigen Menschen zurückgezogen hat in die kleinen, unbeachteten Dinge". Das ewig
Unergründliche, Inkommensurable, nicht der klassische Kanon oder das Dogma von
der alleinseligmachenden Antike ist die geistige Heimat der germanischen Kunst. Wo
sie diese verläßt, geht sie in die Irre und entäußert sich ihrer kostbarsten Werte.
So enthält das Buch des Verfassers, das anspruchsvolle und urteilsfähige, mit dem
riesigen Stoffgebiet bereits vertraute Leser voraussetzt, auf seiner Wanderung durch
den Gesamtbereich der deutschen Kunstgeschichte von ihren frühsten Tagen bis in die
jüngste Gegenwart das Jahrhundert für Jahrhundert sich erneuernde Schauspiel eines
ständigen Emporblühens, Verwelkens und Wiedererstarkens der bodenständigen natio-
nalen Kräfte. — Nur auf einige Höhenpunkte kann hier hingewiesen werden. Herr-
lichen Sätzen über die vielbesungene mittelalterliche Plastik von Naumburg und Bam-
berg schließen sich nicht minder bedeutende, in ebenso kristallklarer wie warmblüti-
ger Sprache vorgetragenen Würdigungen der Hauptmeister der deutschen Renaissance,
insbesondere Dürers und Grünewalds an. Die im In- und Ausland so oft mißver-
standene Dürersche (im weiteren Sinne deutsche) „Pedanterie" wird als „Gewaltakt
der ratio gegen das eigene Ich, als ein mit äußerster Anspannung unternommener
Versuch erkannt, den lebendig fließenden Urgrund der Welt in Einzelheiten zu zer-
legen und in geordnete Bahnen zu zwingen". Anderseits wird die über drei Jahr-
hunderte in Vergessenheit geratene Persönlichkeit des Dürerschen Antipoden Grüne-
wald als die des „Aufrührers, Aufrüttlers und dräuenden Propheten charakterisiert,
als die des großen deutschen Warners, der die mit der Renaissance einsetzende Auto-
nomie des Menschen in ihrer Fragwürdigkeit durchblickt und sich gewaltig gegen
den deutschen Strom stemmt". Aus den späteren Perioden mag hier vor allem das
Kapitel über den deutschen Barock, die Musikalität seiner Architektur, die Poly-
phonie seiner Treppenanlagen und insbesondere des Dresdener Zwingers hervor-
gehoben werden. Auch hier erleben uns heute längst vertraute Gedanken in jedem
Satz eine durchweg neue und urpersönliche Fassung.
Leider fehlt eine, wohl durch die Raumbeschränkung, die das Programm der
Reihe vorschrieb, bedingte eingehendere Auseinandersetzung mit dem Problem des
Klassizismus um 1800, vor allem auch ein Hinweis auf die Tatsache, daß die Wiege
der modernen Landschaftsmalerei in England und Frankreich, nicht in Deutsch-
land stand. Auch der Panegyrikus auf die Kunst Adolph Menzels könnte, wenn per-
sönliche Anschauungen gegenüber einem so hochwertigen literarischen Werk wie dem
vorliegenden geäußert werden dürfen, einige Dämpfer vertragen, und die Namen
der Cornelius, Schwind und Rethel als der typischen Vertreter des deutschen Idealis-
mus und Gegenspieler des großen Berliner Realisten vermißt man in dieser groß-
zügigen Darstellung nur ungern.
Dagegen muß angesichts der wenigen Schlußseiten des Buches über den Expres-
sionismus und des Ausblicks in Gegenwart und Zukunft unserer eigenen künstleri-
schen Entwicklung gesagt werden, daß diese Seiten das Klarste, Scharfsichtigste und
Erschöpfendste enthalten, was über diese problemreichste und brennendste aller kunst-
kritischen Lebensfragen gesagt werden kann. Die hier geprägten, auf ernstester
Sachkenntnis und Sachlichkeit beruhenden, vor allem aus tief eingewurzelter Liebe
BESPRECHUNGEN
wegs ein mangelnder „Glaube oder ein untermenschlicher Ausdruck der Niedrigkeit,
sondern im Gegenteil ein ebenso radikaler, nur auf die andere Seite aller geistig-
künstlerischen Vorstellungskraft und Weltanschauung gerichteter I d e a 1 i s m u s".
Gegenüber der Verherrlichung der menschlichen Gestalt, wie sie die antike und roma-
nische Kunstwelt aufweist, tritt in der Kunst der germanischen Landschaft, in der
liebevollen, ja oft inbrünstigen Hingabe an die kleinste der Pflanzen oder Tiere eine
Weltanschauung zutage, die mit Engelszungen predigt, wie Gott sich „von den frag-
würdigen Menschen zurückgezogen hat in die kleinen, unbeachteten Dinge". Das ewig
Unergründliche, Inkommensurable, nicht der klassische Kanon oder das Dogma von
der alleinseligmachenden Antike ist die geistige Heimat der germanischen Kunst. Wo
sie diese verläßt, geht sie in die Irre und entäußert sich ihrer kostbarsten Werte.
So enthält das Buch des Verfassers, das anspruchsvolle und urteilsfähige, mit dem
riesigen Stoffgebiet bereits vertraute Leser voraussetzt, auf seiner Wanderung durch
den Gesamtbereich der deutschen Kunstgeschichte von ihren frühsten Tagen bis in die
jüngste Gegenwart das Jahrhundert für Jahrhundert sich erneuernde Schauspiel eines
ständigen Emporblühens, Verwelkens und Wiedererstarkens der bodenständigen natio-
nalen Kräfte. — Nur auf einige Höhenpunkte kann hier hingewiesen werden. Herr-
lichen Sätzen über die vielbesungene mittelalterliche Plastik von Naumburg und Bam-
berg schließen sich nicht minder bedeutende, in ebenso kristallklarer wie warmblüti-
ger Sprache vorgetragenen Würdigungen der Hauptmeister der deutschen Renaissance,
insbesondere Dürers und Grünewalds an. Die im In- und Ausland so oft mißver-
standene Dürersche (im weiteren Sinne deutsche) „Pedanterie" wird als „Gewaltakt
der ratio gegen das eigene Ich, als ein mit äußerster Anspannung unternommener
Versuch erkannt, den lebendig fließenden Urgrund der Welt in Einzelheiten zu zer-
legen und in geordnete Bahnen zu zwingen". Anderseits wird die über drei Jahr-
hunderte in Vergessenheit geratene Persönlichkeit des Dürerschen Antipoden Grüne-
wald als die des „Aufrührers, Aufrüttlers und dräuenden Propheten charakterisiert,
als die des großen deutschen Warners, der die mit der Renaissance einsetzende Auto-
nomie des Menschen in ihrer Fragwürdigkeit durchblickt und sich gewaltig gegen
den deutschen Strom stemmt". Aus den späteren Perioden mag hier vor allem das
Kapitel über den deutschen Barock, die Musikalität seiner Architektur, die Poly-
phonie seiner Treppenanlagen und insbesondere des Dresdener Zwingers hervor-
gehoben werden. Auch hier erleben uns heute längst vertraute Gedanken in jedem
Satz eine durchweg neue und urpersönliche Fassung.
Leider fehlt eine, wohl durch die Raumbeschränkung, die das Programm der
Reihe vorschrieb, bedingte eingehendere Auseinandersetzung mit dem Problem des
Klassizismus um 1800, vor allem auch ein Hinweis auf die Tatsache, daß die Wiege
der modernen Landschaftsmalerei in England und Frankreich, nicht in Deutsch-
land stand. Auch der Panegyrikus auf die Kunst Adolph Menzels könnte, wenn per-
sönliche Anschauungen gegenüber einem so hochwertigen literarischen Werk wie dem
vorliegenden geäußert werden dürfen, einige Dämpfer vertragen, und die Namen
der Cornelius, Schwind und Rethel als der typischen Vertreter des deutschen Idealis-
mus und Gegenspieler des großen Berliner Realisten vermißt man in dieser groß-
zügigen Darstellung nur ungern.
Dagegen muß angesichts der wenigen Schlußseiten des Buches über den Expres-
sionismus und des Ausblicks in Gegenwart und Zukunft unserer eigenen künstleri-
schen Entwicklung gesagt werden, daß diese Seiten das Klarste, Scharfsichtigste und
Erschöpfendste enthalten, was über diese problemreichste und brennendste aller kunst-
kritischen Lebensfragen gesagt werden kann. Die hier geprägten, auf ernstester
Sachkenntnis und Sachlichkeit beruhenden, vor allem aus tief eingewurzelter Liebe