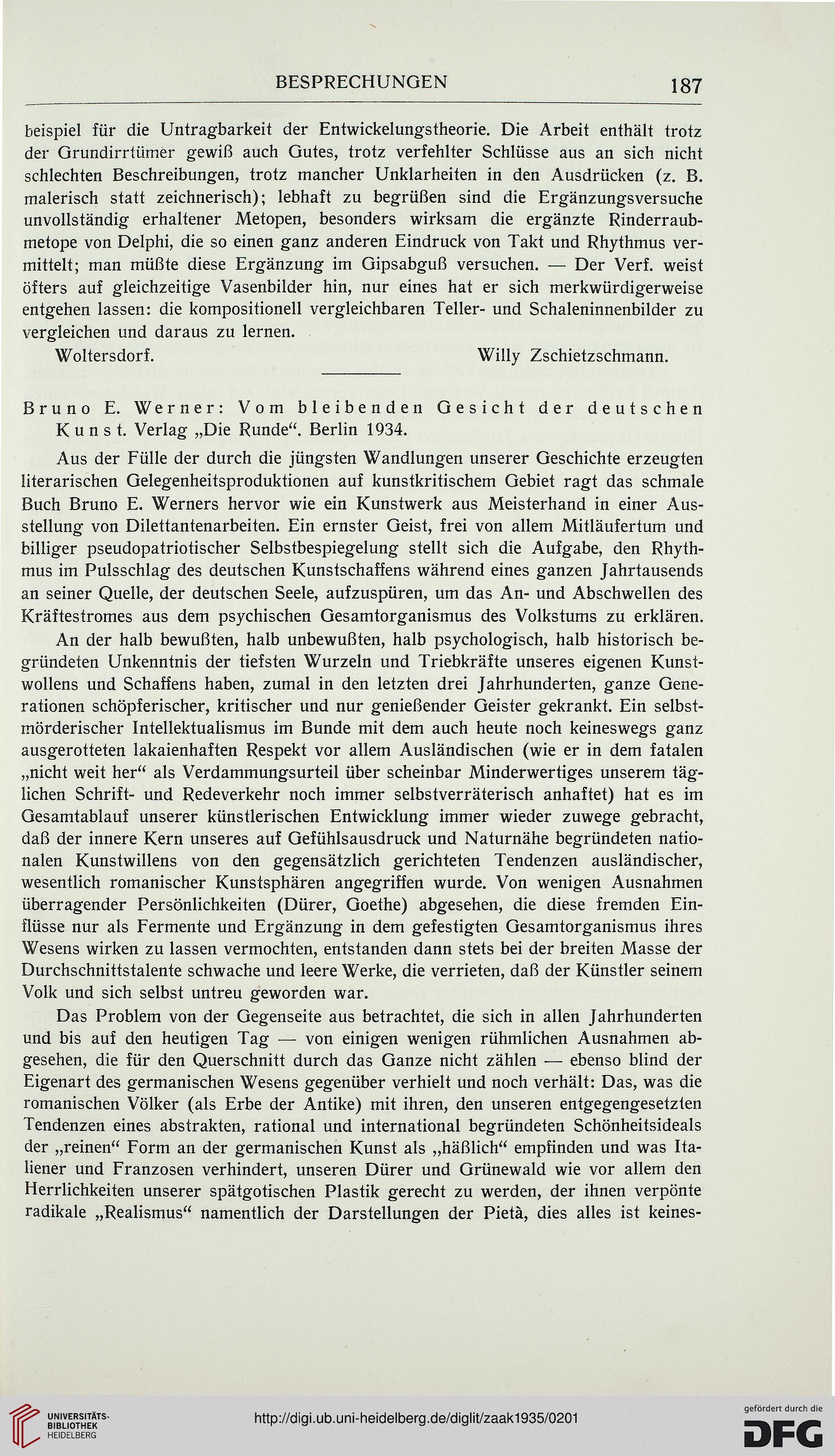BESPRECHUNGEN 137
beispiel für die Untragbarkeit der Entwicklungstheorie. Die Arbeit enthält trotz
der Grundirrtümer gewiß auch Gutes, trotz verfehlter Schlüsse aus an sich nicht
schlechten Beschreibungen, trotz mancher Unklarheiten in den Ausdrücken (z. B.
malerisch statt zeichnerisch); lebhaft zu begrüßen sind die Ergänzungsversuche
unvollständig erhaltener Metopen, besonders wirksam die ergänzte Rinderraub-
metope von Delphi, die so einen ganz anderen Eindruck von Takt und Rhythmus ver-
mittelt; man müßte diese Ergänzung im Gipsabguß versuchen. — Der Verf. weist
öfters auf gleichzeitige Vasenbilder hin, nur eines hat er sich merkwürdigerweise
entgehen lassen: die kompositioneil vergleichbaren Teller- und Schaleninnenbilder zu
vergleichen und daraus zu lernen.
Woltersdorf. Willy Zschietzschmann.
Bruno E. Werner: Vom bleibenden Gesicht der deutschen
Kunst. Verlag „Die Runde". Berlin 1934.
Aus der Fülle der durch die jüngsten Wandlungen unserer Geschichte erzeugten
literarischen Gelegenheitsproduktionen auf kunstkritischem Gebiet ragt das schmale
Buch Bruno E. Werners hervor wie ein Kunstwerk aus Meisterhand in einer Aus-
stellung von Dilettantenarbeiten. Ein ernster Geist, frei von allem Mitläufertum und
billiger pseudopatriotischer Selbstbespiegelung stellt sich die Aufgabe, den Rhyth-
mus im Pulsschlag des deutschen Kunstschaffens während eines ganzen Jahrtausends
an seiner Quelle, der deutschen Seele, aufzuspüren, um das An- und Abschwellen des
Kräftestromes aus dem psychischen Gesamtorganismus des Volkstums zu erklären.
An der halb bewußten, halb unbewußten, halb psychologisch, halb historisch be-
gründeten Unkenntnis der tiefsten Wurzeln und Triebkräfte unseres eigenen Kunst-
wollens und Schaffens haben, zumal in den letzten drei Jahrhunderten, ganze Gene-
rationen schöpferischer, kritischer und nur genießender Geister gekrankt. Ein selbst-
mörderischer Intellektualismus im Bunde mit dem auch heute noch keineswegs ganz
ausgerotteten lakaienhaften Respekt vor allem Ausländischen (wie er in dem fatalen
„nicht weit her" als Verdammungsurteil über scheinbar Minderwertiges unserem täg-
lichen Schrift- und Redeverkehr noch immer selbstverräterisch anhaftet) hat es im
Gesamtablauf unserer künstlerischen Entwicklung immer wieder zuwege gebracht,
daß der innere Kern unseres auf Gefühlsausdruck und Naturnähe begründeten natio-
nalen Kunstwillens von den gegensätzlich gerichteten Tendenzen ausländischer,
wesentlich romanischer Kunstsphären angegriffen wurde. Von wenigen Ausnahmen
überragender Persönlichkeiten (Dürer, Goethe) abgesehen, die diese fremden Ein-
flüsse nur als Fermente und Ergänzung in dem gefestigten Gesamtorganismus ihres
Wesens wirken zu lassen vermochten, entstanden dann stets bei der breiten Masse der
Durchschnittstalente schwache und leere Werke, die verrieten, daß der Künstler seinem
Volk und sich selbst untreu geworden war.
Das Problem von der Gegenseite aus betrachtet, die sich in allen Jahrhunderten
und bis auf den heutigen Tag — von einigen wenigen rühmlichen Ausnahmen ab-
gesehen, die für den Querschnitt durch das Ganze nicht zählen — ebenso blind der
Eigenart des germanischen Wesens gegenüber verhielt und noch verhält: Das, was die
romanischen Völker (als Erbe der Antike) mit ihren, den unseren entgegengesetzten
Tendenzen eines abstrakten, rational und international begründeten Schönheitsideals
der „reinen" Form an der germanischen Kunst als „häßlich" empfinden und was Ita-
liener und Franzosen verhindert, unseren Dürer und Grünewald wie vor allem den
Herrlichkeiten unserer spätgotischen Plastik gerecht zu werden, der ihnen verpönte
radikale „Realismus" namentlich der Darstellungen der Pietä, dies alles ist keines-
beispiel für die Untragbarkeit der Entwicklungstheorie. Die Arbeit enthält trotz
der Grundirrtümer gewiß auch Gutes, trotz verfehlter Schlüsse aus an sich nicht
schlechten Beschreibungen, trotz mancher Unklarheiten in den Ausdrücken (z. B.
malerisch statt zeichnerisch); lebhaft zu begrüßen sind die Ergänzungsversuche
unvollständig erhaltener Metopen, besonders wirksam die ergänzte Rinderraub-
metope von Delphi, die so einen ganz anderen Eindruck von Takt und Rhythmus ver-
mittelt; man müßte diese Ergänzung im Gipsabguß versuchen. — Der Verf. weist
öfters auf gleichzeitige Vasenbilder hin, nur eines hat er sich merkwürdigerweise
entgehen lassen: die kompositioneil vergleichbaren Teller- und Schaleninnenbilder zu
vergleichen und daraus zu lernen.
Woltersdorf. Willy Zschietzschmann.
Bruno E. Werner: Vom bleibenden Gesicht der deutschen
Kunst. Verlag „Die Runde". Berlin 1934.
Aus der Fülle der durch die jüngsten Wandlungen unserer Geschichte erzeugten
literarischen Gelegenheitsproduktionen auf kunstkritischem Gebiet ragt das schmale
Buch Bruno E. Werners hervor wie ein Kunstwerk aus Meisterhand in einer Aus-
stellung von Dilettantenarbeiten. Ein ernster Geist, frei von allem Mitläufertum und
billiger pseudopatriotischer Selbstbespiegelung stellt sich die Aufgabe, den Rhyth-
mus im Pulsschlag des deutschen Kunstschaffens während eines ganzen Jahrtausends
an seiner Quelle, der deutschen Seele, aufzuspüren, um das An- und Abschwellen des
Kräftestromes aus dem psychischen Gesamtorganismus des Volkstums zu erklären.
An der halb bewußten, halb unbewußten, halb psychologisch, halb historisch be-
gründeten Unkenntnis der tiefsten Wurzeln und Triebkräfte unseres eigenen Kunst-
wollens und Schaffens haben, zumal in den letzten drei Jahrhunderten, ganze Gene-
rationen schöpferischer, kritischer und nur genießender Geister gekrankt. Ein selbst-
mörderischer Intellektualismus im Bunde mit dem auch heute noch keineswegs ganz
ausgerotteten lakaienhaften Respekt vor allem Ausländischen (wie er in dem fatalen
„nicht weit her" als Verdammungsurteil über scheinbar Minderwertiges unserem täg-
lichen Schrift- und Redeverkehr noch immer selbstverräterisch anhaftet) hat es im
Gesamtablauf unserer künstlerischen Entwicklung immer wieder zuwege gebracht,
daß der innere Kern unseres auf Gefühlsausdruck und Naturnähe begründeten natio-
nalen Kunstwillens von den gegensätzlich gerichteten Tendenzen ausländischer,
wesentlich romanischer Kunstsphären angegriffen wurde. Von wenigen Ausnahmen
überragender Persönlichkeiten (Dürer, Goethe) abgesehen, die diese fremden Ein-
flüsse nur als Fermente und Ergänzung in dem gefestigten Gesamtorganismus ihres
Wesens wirken zu lassen vermochten, entstanden dann stets bei der breiten Masse der
Durchschnittstalente schwache und leere Werke, die verrieten, daß der Künstler seinem
Volk und sich selbst untreu geworden war.
Das Problem von der Gegenseite aus betrachtet, die sich in allen Jahrhunderten
und bis auf den heutigen Tag — von einigen wenigen rühmlichen Ausnahmen ab-
gesehen, die für den Querschnitt durch das Ganze nicht zählen — ebenso blind der
Eigenart des germanischen Wesens gegenüber verhielt und noch verhält: Das, was die
romanischen Völker (als Erbe der Antike) mit ihren, den unseren entgegengesetzten
Tendenzen eines abstrakten, rational und international begründeten Schönheitsideals
der „reinen" Form an der germanischen Kunst als „häßlich" empfinden und was Ita-
liener und Franzosen verhindert, unseren Dürer und Grünewald wie vor allem den
Herrlichkeiten unserer spätgotischen Plastik gerecht zu werden, der ihnen verpönte
radikale „Realismus" namentlich der Darstellungen der Pietä, dies alles ist keines-