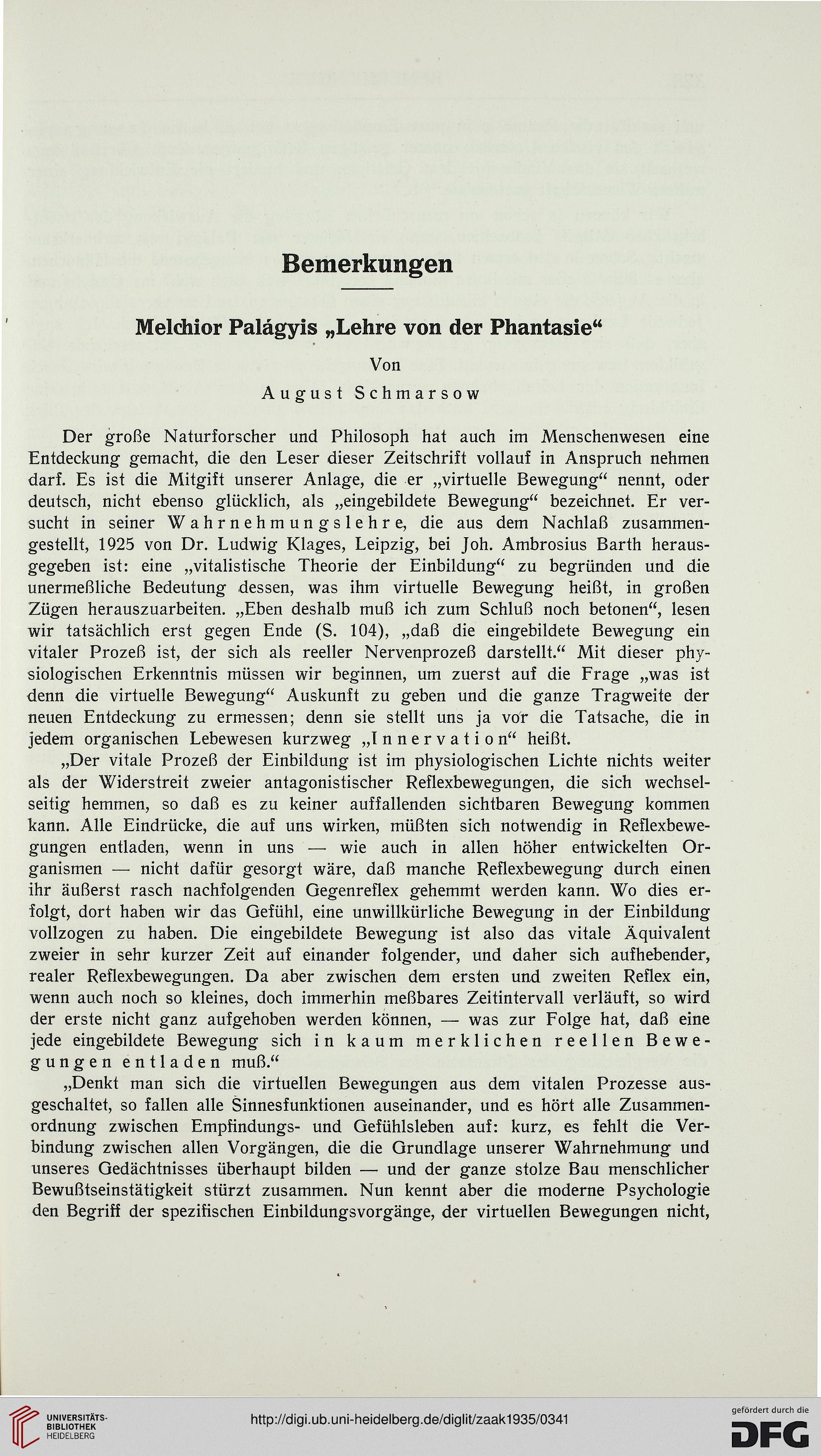Bemerkungen
Melchior Palägyis „Lehre von der Phantasie"
Von
August Schmarsow
Der große Naturforscher und Philosoph hat auch im Menschenwesen eine
Entdeckung gemacht, die den Leser dieser Zeitschrift vollauf in Anspruch nehmen
darf. Es ist die Mitgift unserer Anlage, die er „virtuelle Bewegung" nennt, oder
deutsch, nicht ebenso glücklich, als „eingebildete Bewegung" bezeichnet. Er ver-
sucht in seiner Wahrnehmungslehre, die aus dem Nachlaß zusammen-
gestellt, 1925 von Dr. Ludwig Klages, Leipzig, bei Joh. Ambrosius Barth heraus-
gegeben ist: eine „vitalistische Theorie der Einbildung" zu begründen und die
unermeßliche Bedeutung dessen, was ihm virtuelle Bewegung heißt, in großen
Zügen herauszuarbeiten. „Eben deshalb muß ich zum Schluß noch betonen", lesen
wir tatsächlich erst gegen Ende (S. 104), „daß die eingebildete Bewegung ein
vitaler Prozeß ist, der sich als reeller Nervenprozeß darstellt." Mit dieser phy-
siologischen Erkenntnis müssen wir beginnen, um zuerst auf die Frage „was ist
denn die virtuelle Bewegung" Auskunft zu geben und die ganze Tragweite der
neuen Entdeckung zu ermessen; denn sie stellt uns ja vor die Tatsache, die in
jedem organischen Lebewesen kurzweg „Innervation" heißt.
„Der vitale Prozeß der Einbildung ist im physiologischen Lichte nichts weiter
als der Widerstreit zweier antagonistischer Reflexbewegungen, die sich wechsel-
seitig hemmen, so daß es zu keiner auffallenden sichtbaren Bewegung kommen
kann. Alle Eindrücke, die auf uns wirken, müßten sich notwendig in Reflexbewe-
gungen entladen, wenn in uns — wie auch in allen höher entwickelten Or-
ganismen — nicht dafür gesorgt wäre, daß manche Reflexbewegung durch einen
ihr äußerst rasch nachfolgenden Gegenreflex gehemmt werden kann. Wo dies er-
folgt, dort haben wir das Gefühl, eine unwillkürliche Bewegung in der Einbildung
vollzogen zu haben. Die eingebildete Bewegung ist also das vitale Äquivalent
zweier in sehr kurzer Zeit auf einander folgender, und daher sich aufhebender,
realer Reflexbewegungen. Da aber zwischen dem ersten und zweiten Reflex ein,
wenn auch noch so kleines, doch immerhin meßbares Zeitintervall verläuft, so wird
der erste nicht ganz aufgehoben werden können, — was zur Folge hat, daß eine
jede eingebildete Bewegung sich in kaum merklichen reellen Bewe-
gungen entladen muß."
„Denkt man sich die virtuellen Bewegungen aus dem vitalen Prozesse aus-
geschaltet, so fallen alle Sinnesfunktionen auseinander, und es hört alle Zusammen-
ordnung zwischen Empfindungs- und Gefühlsleben auf: kurz, es fehlt die Ver-
bindung zwischen allen Vorgängen, die die Grundlage unserer Wahrnehmung und
unseres Gedächtnisses überhaupt bilden — und der ganze stolze Bau menschlicher
Bewußtseinstätigkeit stürzt zusammen. Nun kennt aber die moderne Psychologie
den Begriff der spezifischen Einbildungsvorgänge, der virtuellen Bewegungen nicht,
Melchior Palägyis „Lehre von der Phantasie"
Von
August Schmarsow
Der große Naturforscher und Philosoph hat auch im Menschenwesen eine
Entdeckung gemacht, die den Leser dieser Zeitschrift vollauf in Anspruch nehmen
darf. Es ist die Mitgift unserer Anlage, die er „virtuelle Bewegung" nennt, oder
deutsch, nicht ebenso glücklich, als „eingebildete Bewegung" bezeichnet. Er ver-
sucht in seiner Wahrnehmungslehre, die aus dem Nachlaß zusammen-
gestellt, 1925 von Dr. Ludwig Klages, Leipzig, bei Joh. Ambrosius Barth heraus-
gegeben ist: eine „vitalistische Theorie der Einbildung" zu begründen und die
unermeßliche Bedeutung dessen, was ihm virtuelle Bewegung heißt, in großen
Zügen herauszuarbeiten. „Eben deshalb muß ich zum Schluß noch betonen", lesen
wir tatsächlich erst gegen Ende (S. 104), „daß die eingebildete Bewegung ein
vitaler Prozeß ist, der sich als reeller Nervenprozeß darstellt." Mit dieser phy-
siologischen Erkenntnis müssen wir beginnen, um zuerst auf die Frage „was ist
denn die virtuelle Bewegung" Auskunft zu geben und die ganze Tragweite der
neuen Entdeckung zu ermessen; denn sie stellt uns ja vor die Tatsache, die in
jedem organischen Lebewesen kurzweg „Innervation" heißt.
„Der vitale Prozeß der Einbildung ist im physiologischen Lichte nichts weiter
als der Widerstreit zweier antagonistischer Reflexbewegungen, die sich wechsel-
seitig hemmen, so daß es zu keiner auffallenden sichtbaren Bewegung kommen
kann. Alle Eindrücke, die auf uns wirken, müßten sich notwendig in Reflexbewe-
gungen entladen, wenn in uns — wie auch in allen höher entwickelten Or-
ganismen — nicht dafür gesorgt wäre, daß manche Reflexbewegung durch einen
ihr äußerst rasch nachfolgenden Gegenreflex gehemmt werden kann. Wo dies er-
folgt, dort haben wir das Gefühl, eine unwillkürliche Bewegung in der Einbildung
vollzogen zu haben. Die eingebildete Bewegung ist also das vitale Äquivalent
zweier in sehr kurzer Zeit auf einander folgender, und daher sich aufhebender,
realer Reflexbewegungen. Da aber zwischen dem ersten und zweiten Reflex ein,
wenn auch noch so kleines, doch immerhin meßbares Zeitintervall verläuft, so wird
der erste nicht ganz aufgehoben werden können, — was zur Folge hat, daß eine
jede eingebildete Bewegung sich in kaum merklichen reellen Bewe-
gungen entladen muß."
„Denkt man sich die virtuellen Bewegungen aus dem vitalen Prozesse aus-
geschaltet, so fallen alle Sinnesfunktionen auseinander, und es hört alle Zusammen-
ordnung zwischen Empfindungs- und Gefühlsleben auf: kurz, es fehlt die Ver-
bindung zwischen allen Vorgängen, die die Grundlage unserer Wahrnehmung und
unseres Gedächtnisses überhaupt bilden — und der ganze stolze Bau menschlicher
Bewußtseinstätigkeit stürzt zusammen. Nun kennt aber die moderne Psychologie
den Begriff der spezifischen Einbildungsvorgänge, der virtuellen Bewegungen nicht,