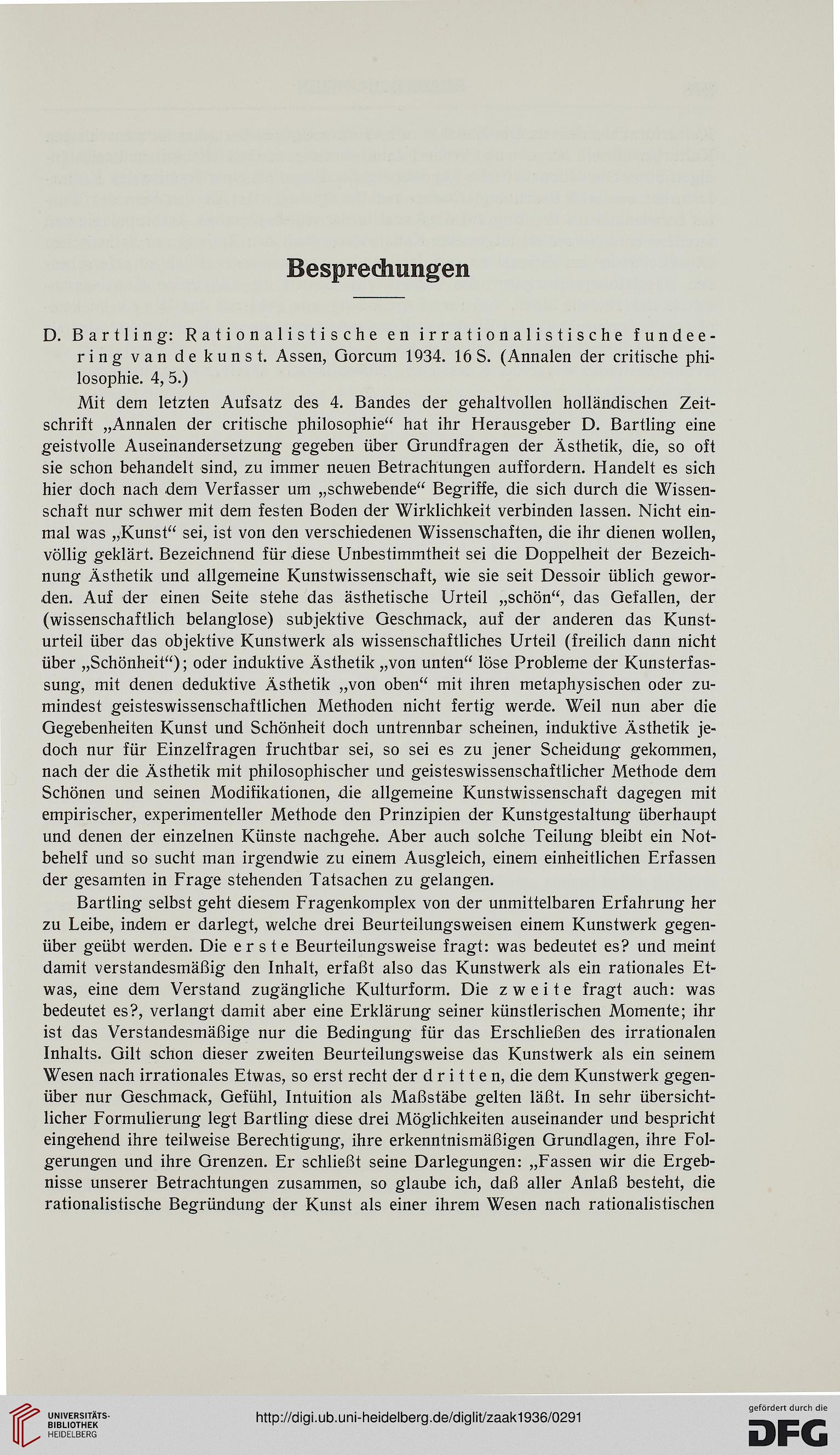Besprechungen
D. Bartling: Rationalistische en irrationalistische fundee-
ring van de kunst. Assen, Gorcum 1934. 16 S. (Annalen der critische Phi-
losophie. 4, 5.)
Mit dem letzten Aufsatz des 4. Bandes der gehaltvollen holländischen Zeit-
schrift „Annalen der critische philosophie" hat ihr Herausgeber D. Bartling eine
geistvolle Auseinandersetzung gegeben über Grundfragen der Ästhetik, die, so oft
sie schon behandelt sind, zu immer neuen Betrachtungen auffordern. Handelt es sich
hier doch nach dem Verfasser um „schwebende" Begriffe, die sich durch die Wissen-
schaft nur schwer mit dem festen Boden der Wirklichkeit verbinden lassen. Nicht ein-
mal was „Kunst" sei, ist von den verschiedenen Wissenschaften, die ihr dienen wollen,
völlig geklärt. Bezeichnend für diese Unbestimmtheit sei die Doppelheit der Bezeich-
nung Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, wie sie seit Dessoir üblich gewor-
den. Auf der einen Seite stehe das ästhetische Urteil „schön", das Gefallen, der
(wissenschaftlich belanglose) subjektive Geschmack, auf der anderen das Kunst-
urteil über das objektive Kunstwerk als wissenschaftliches Urteil (freilich dann nicht
über „Schönheit"); oder induktive Ästhetik „von unten" löse Probleme der Kunsterfas-
sung, mit denen deduktive Ästhetik „von oben" mit ihren metaphysischen oder zu-
mindest geisteswissenschaftlichen Methoden nicht fertig werde. Weil nun aber die
Gegebenheiten Kunst und Schönheit doch untrennbar scheinen, induktive Ästhetik je-
doch nur für Einzelfragen fruchtbar sei, so sei es zu jener Scheidung gekommen,
nach der die Ästhetik mit philosophischer und geisteswissenschaftlicher Methode dem
Schönen und seinen Modifikationen, die allgemeine Kunstwissenschaft dagegen mit
empirischer, experimenteller Methode den Prinzipien der Kunstgestaltung überhaupt
und denen der einzelnen Künste nachgehe. Aber auch solche Teilung bleibt ein Not-
behelf und so sucht man irgendwie zu einem Ausgleich, einem einheitlichen Erfassen
der gesamten in Frage stehenden Tatsachen zu gelangen.
Bartling selbst geht diesem Fragenkomplex von der unmittelbaren Erfahrung her
zu Leibe, indem er darlegt, welche drei Beurteilungsweisen einem Kunstwerk gegen-
über geübt werden. Die erste Beurteilungsweise fragt: was bedeutet es? und meint
damit verstandesmäßig den Inhalt, erfaßt also das Kunstwerk als ein rationales Et-
was, eine dem Verstand zugängliche Kulturform. Die zweite fragt auch: was
bedeutet es?, verlangt damit aber eine Erklärung seiner künstlerischen Momente; ihr
ist das Verstandesmäßige nur die Bedingung für das Erschließen des irrationalen
Inhalts. Gilt schon dieser zweiten Beurteilungsweise das Kunstwerk als ein seinem
Wesen nach irrationales Etwas, so erst recht der d r i 11 e n, die dem Kunstwerk gegen-
über nur Geschmack, Gefühl, Intuition als Maßstäbe gelten läßt. In sehr übersicht-
licher Formulierung legt Bartling diese drei Möglichkeiten auseinander und bespricht
eingehend ihre teilweise Berechtigung, ihre erkenntnismäßigen Grundlagen, ihre Fol-
gerungen und ihre Grenzen. Er schließt seine Darlegungen: „Fassen wir die Ergeb-
nisse unserer Betrachtungen zusammen, so glaube ich, daß aller Anlaß besteht, die
rationalistische Begründung der Kunst als einer ihrem Wesen nach rationalistischen
D. Bartling: Rationalistische en irrationalistische fundee-
ring van de kunst. Assen, Gorcum 1934. 16 S. (Annalen der critische Phi-
losophie. 4, 5.)
Mit dem letzten Aufsatz des 4. Bandes der gehaltvollen holländischen Zeit-
schrift „Annalen der critische philosophie" hat ihr Herausgeber D. Bartling eine
geistvolle Auseinandersetzung gegeben über Grundfragen der Ästhetik, die, so oft
sie schon behandelt sind, zu immer neuen Betrachtungen auffordern. Handelt es sich
hier doch nach dem Verfasser um „schwebende" Begriffe, die sich durch die Wissen-
schaft nur schwer mit dem festen Boden der Wirklichkeit verbinden lassen. Nicht ein-
mal was „Kunst" sei, ist von den verschiedenen Wissenschaften, die ihr dienen wollen,
völlig geklärt. Bezeichnend für diese Unbestimmtheit sei die Doppelheit der Bezeich-
nung Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, wie sie seit Dessoir üblich gewor-
den. Auf der einen Seite stehe das ästhetische Urteil „schön", das Gefallen, der
(wissenschaftlich belanglose) subjektive Geschmack, auf der anderen das Kunst-
urteil über das objektive Kunstwerk als wissenschaftliches Urteil (freilich dann nicht
über „Schönheit"); oder induktive Ästhetik „von unten" löse Probleme der Kunsterfas-
sung, mit denen deduktive Ästhetik „von oben" mit ihren metaphysischen oder zu-
mindest geisteswissenschaftlichen Methoden nicht fertig werde. Weil nun aber die
Gegebenheiten Kunst und Schönheit doch untrennbar scheinen, induktive Ästhetik je-
doch nur für Einzelfragen fruchtbar sei, so sei es zu jener Scheidung gekommen,
nach der die Ästhetik mit philosophischer und geisteswissenschaftlicher Methode dem
Schönen und seinen Modifikationen, die allgemeine Kunstwissenschaft dagegen mit
empirischer, experimenteller Methode den Prinzipien der Kunstgestaltung überhaupt
und denen der einzelnen Künste nachgehe. Aber auch solche Teilung bleibt ein Not-
behelf und so sucht man irgendwie zu einem Ausgleich, einem einheitlichen Erfassen
der gesamten in Frage stehenden Tatsachen zu gelangen.
Bartling selbst geht diesem Fragenkomplex von der unmittelbaren Erfahrung her
zu Leibe, indem er darlegt, welche drei Beurteilungsweisen einem Kunstwerk gegen-
über geübt werden. Die erste Beurteilungsweise fragt: was bedeutet es? und meint
damit verstandesmäßig den Inhalt, erfaßt also das Kunstwerk als ein rationales Et-
was, eine dem Verstand zugängliche Kulturform. Die zweite fragt auch: was
bedeutet es?, verlangt damit aber eine Erklärung seiner künstlerischen Momente; ihr
ist das Verstandesmäßige nur die Bedingung für das Erschließen des irrationalen
Inhalts. Gilt schon dieser zweiten Beurteilungsweise das Kunstwerk als ein seinem
Wesen nach irrationales Etwas, so erst recht der d r i 11 e n, die dem Kunstwerk gegen-
über nur Geschmack, Gefühl, Intuition als Maßstäbe gelten läßt. In sehr übersicht-
licher Formulierung legt Bartling diese drei Möglichkeiten auseinander und bespricht
eingehend ihre teilweise Berechtigung, ihre erkenntnismäßigen Grundlagen, ihre Fol-
gerungen und ihre Grenzen. Er schließt seine Darlegungen: „Fassen wir die Ergeb-
nisse unserer Betrachtungen zusammen, so glaube ich, daß aller Anlaß besteht, die
rationalistische Begründung der Kunst als einer ihrem Wesen nach rationalistischen