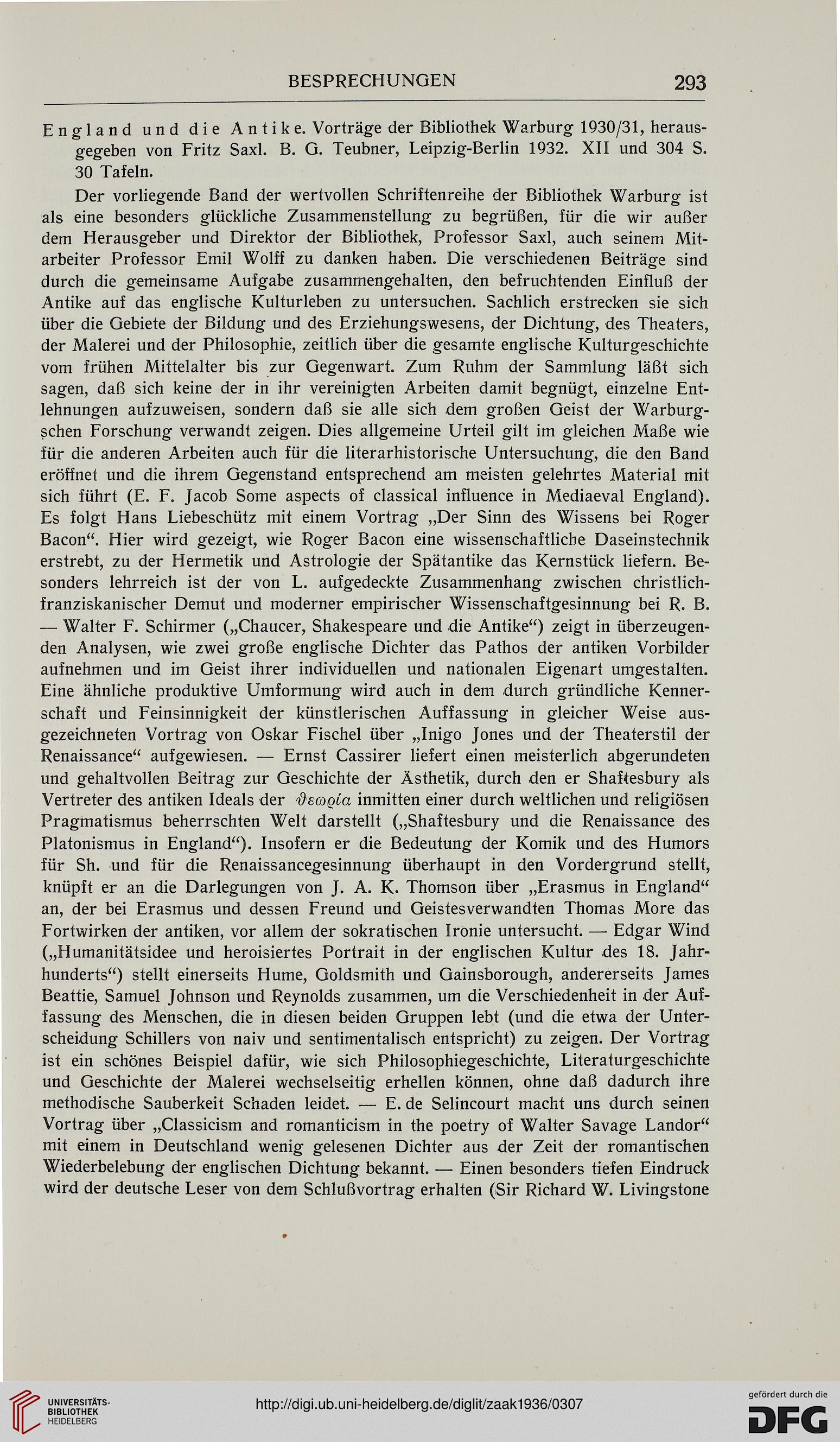England und die Antike. Vorträge der Bibliothek Warburg 1930/31, heraus-
gegeben von Fritz Saxl. B. G. Teubner, Leipzig-Berlin 1932. XII und 304 S.
30 Tafeln.
Der vorliegende Band der wertvollen Schriftenreihe der Bibliothek Warburg ist
als eine besonders glückliche Zusammenstellung zu begrüßen, für die wir außer
dem Herausgeber und Direktor der Bibliothek, Professor Saxl, auch seinem Mit-
arbeiter Professor Emil Wolff zu danken haben. Die verschiedenen Beiträge sind
durch die gemeinsame Aufgabe zusammengehalten, den befruchtenden Einfluß der
Antike auf das englische Kulturleben zu untersuchen. Sachlich erstrecken sie sich
über die Gebiete der Bildung und des Erziehungswesens, der Dichtung, des Theaters,
der Malerei und der Philosophie, zeitlich über die gesamte englische Kulturgeschichte
vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. Zum Ruhm der Sammlung läßt sich
sagen, daß sich keine der in ihr vereinigten Arbeiten damit begnügt, einzelne Ent-
lehnungen aufzuweisen, sondern daß sie alle sich dem großen Geist der Warburg-
schen Forschung verwandt zeigen. Dies allgemeine Urteil gilt im gleichen Maße wie
für die anderen Arbeiten auch für die literarhistorische Untersuchung, die den Band
eröffnet und die ihrem Gegenstand entsprechend am meisten gelehrtes Material mit
sich führt (E. F. Jacob Some aspects of classical influence in Mediaeval England).
Es folgt Hans Liebeschütz mit einem Vortrag „Der Sinn des Wissens bei Roger
Bacon". Hier wird gezeigt, wie Roger Bacon eine wissenschaftliche Daseinstechnik
erstrebt, zu der Hermetik und Astrologie der Spätantike das Kernstück liefern. Be-
sonders lehrreich ist der von L. aufgedeckte Zusammenhang zwischen christlich-
franziskanischer Demut und moderner empirischer Wissenschaftgesinnung bei R. B.
— Walter F. Schirmer („Chaucer, Shakespeare und die Antike") zeigt in überzeugen-
den Analysen, wie zwei große englische Dichter das Pathos der antiken Vorbilder
aufnehmen und im Geist ihrer individuellen und nationalen Eigenart umgestalten.
Eine ähnliche produktive Umformung wird auch in dem durch gründliche Kenner-
schaft und Feinsinnigkeit der künstlerischen Auffassung in gleicher Weise aus-
gezeichneten Vortrag von Oskar Fischel über „Inigo Jones und der Theaterstil der
Renaissance" aufgewiesen. — Ernst Cassirer liefert einen meisterlich abgerundeten
und gehaltvollen Beitrag zur Geschichte der Ästhetik, durch den er Shaftesbury als
Vertreter des antiken Ideals der decogia inmitten einer durch weltlichen und religiösen
Pragmatismus beherrschten Welt darstellt („Shaftesbury und die Renaissance des
Piatonismus in England"). Insofern er die Bedeutung der Komik und des Humors
für Sh. und für die Renaissancegesinnung überhaupt in den Vordergrund stellt,
knüpft er an die Darlegungen von J. A. K. Thomson über „Erasmus in England"
an, der bei Erasmus und dessen Freund und Geistesverwandten Thomas More das
Fortwirken der antiken, vor allem der sokratischen Ironie untersucht. — Edgar Wind
(„Humanitätsidee und heroisiertes Portrait in der englischen Kultur des 18. Jahr-
hunderts") stellt einerseits Hume, Goldsmith und Gainsborough, andererseits James
Beattie, Samuel Johnson und Reynolds zusammen, um die Verschiedenheit in der Auf-
fassung des Menschen, die in diesen beiden Gruppen lebt (und die etwa der Unter-
scheidung Schillers von naiv und sentimentalisch entspricht) zu zeigen. Der Vortrag
ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich Philosophiegeschichte, Literaturgeschichte
und Geschichte der Malerei wechselseitig erhellen können, ohne daß dadurch ihre
methodische Sauberkeit Schaden leidet. — E. de Selincourt macht uns durch seinen
Vortrag über „Classicism and romanticism in the poetry of Walter Savage Landor"
mit einem in Deutschland wenig gelesenen Dichter aus der Zeit der romantischen
Wiederbelebung der englischen Dichtung bekannt. — Einen besonders tiefen Eindruck
wird der deutsche Leser von dem Schlußvortrag erhalten (Sir Richard W. Livingstone
gegeben von Fritz Saxl. B. G. Teubner, Leipzig-Berlin 1932. XII und 304 S.
30 Tafeln.
Der vorliegende Band der wertvollen Schriftenreihe der Bibliothek Warburg ist
als eine besonders glückliche Zusammenstellung zu begrüßen, für die wir außer
dem Herausgeber und Direktor der Bibliothek, Professor Saxl, auch seinem Mit-
arbeiter Professor Emil Wolff zu danken haben. Die verschiedenen Beiträge sind
durch die gemeinsame Aufgabe zusammengehalten, den befruchtenden Einfluß der
Antike auf das englische Kulturleben zu untersuchen. Sachlich erstrecken sie sich
über die Gebiete der Bildung und des Erziehungswesens, der Dichtung, des Theaters,
der Malerei und der Philosophie, zeitlich über die gesamte englische Kulturgeschichte
vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. Zum Ruhm der Sammlung läßt sich
sagen, daß sich keine der in ihr vereinigten Arbeiten damit begnügt, einzelne Ent-
lehnungen aufzuweisen, sondern daß sie alle sich dem großen Geist der Warburg-
schen Forschung verwandt zeigen. Dies allgemeine Urteil gilt im gleichen Maße wie
für die anderen Arbeiten auch für die literarhistorische Untersuchung, die den Band
eröffnet und die ihrem Gegenstand entsprechend am meisten gelehrtes Material mit
sich führt (E. F. Jacob Some aspects of classical influence in Mediaeval England).
Es folgt Hans Liebeschütz mit einem Vortrag „Der Sinn des Wissens bei Roger
Bacon". Hier wird gezeigt, wie Roger Bacon eine wissenschaftliche Daseinstechnik
erstrebt, zu der Hermetik und Astrologie der Spätantike das Kernstück liefern. Be-
sonders lehrreich ist der von L. aufgedeckte Zusammenhang zwischen christlich-
franziskanischer Demut und moderner empirischer Wissenschaftgesinnung bei R. B.
— Walter F. Schirmer („Chaucer, Shakespeare und die Antike") zeigt in überzeugen-
den Analysen, wie zwei große englische Dichter das Pathos der antiken Vorbilder
aufnehmen und im Geist ihrer individuellen und nationalen Eigenart umgestalten.
Eine ähnliche produktive Umformung wird auch in dem durch gründliche Kenner-
schaft und Feinsinnigkeit der künstlerischen Auffassung in gleicher Weise aus-
gezeichneten Vortrag von Oskar Fischel über „Inigo Jones und der Theaterstil der
Renaissance" aufgewiesen. — Ernst Cassirer liefert einen meisterlich abgerundeten
und gehaltvollen Beitrag zur Geschichte der Ästhetik, durch den er Shaftesbury als
Vertreter des antiken Ideals der decogia inmitten einer durch weltlichen und religiösen
Pragmatismus beherrschten Welt darstellt („Shaftesbury und die Renaissance des
Piatonismus in England"). Insofern er die Bedeutung der Komik und des Humors
für Sh. und für die Renaissancegesinnung überhaupt in den Vordergrund stellt,
knüpft er an die Darlegungen von J. A. K. Thomson über „Erasmus in England"
an, der bei Erasmus und dessen Freund und Geistesverwandten Thomas More das
Fortwirken der antiken, vor allem der sokratischen Ironie untersucht. — Edgar Wind
(„Humanitätsidee und heroisiertes Portrait in der englischen Kultur des 18. Jahr-
hunderts") stellt einerseits Hume, Goldsmith und Gainsborough, andererseits James
Beattie, Samuel Johnson und Reynolds zusammen, um die Verschiedenheit in der Auf-
fassung des Menschen, die in diesen beiden Gruppen lebt (und die etwa der Unter-
scheidung Schillers von naiv und sentimentalisch entspricht) zu zeigen. Der Vortrag
ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich Philosophiegeschichte, Literaturgeschichte
und Geschichte der Malerei wechselseitig erhellen können, ohne daß dadurch ihre
methodische Sauberkeit Schaden leidet. — E. de Selincourt macht uns durch seinen
Vortrag über „Classicism and romanticism in the poetry of Walter Savage Landor"
mit einem in Deutschland wenig gelesenen Dichter aus der Zeit der romantischen
Wiederbelebung der englischen Dichtung bekannt. — Einen besonders tiefen Eindruck
wird der deutsche Leser von dem Schlußvortrag erhalten (Sir Richard W. Livingstone