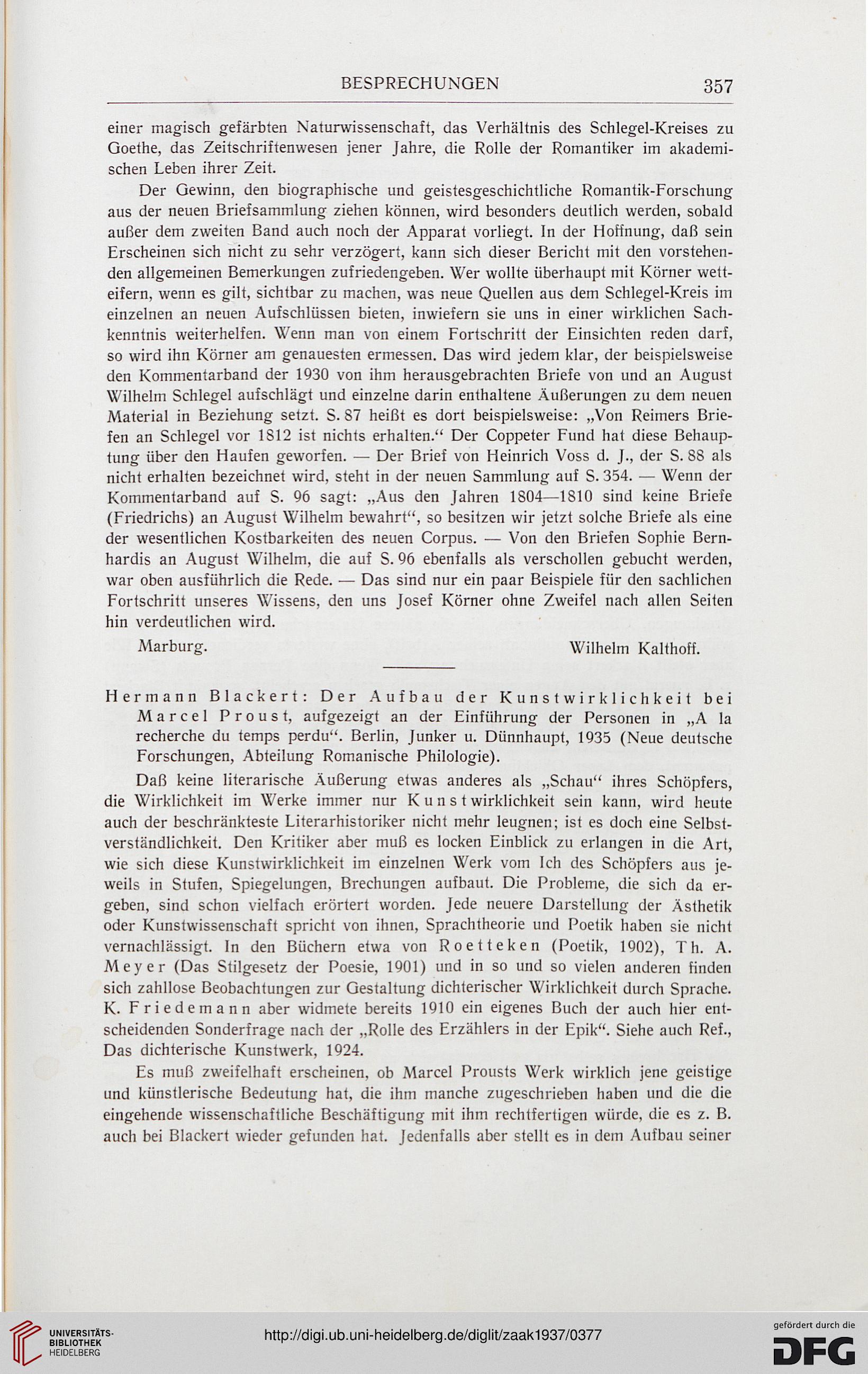BESPRECHUNGEN
357
einer magisch gefärbten Naturwissenschaft, das Verhältnis des Schlegel-Kreises zu
Goethe, das Zeitschriftenwesen jener Jahre, die Rolle der Romantiker im akademi-
schen Leben ihrer Zeit.
Der Gewinn, den biographische und geistesgeschichtliche Romantik-Forschung
aus der neuen Briefsammlung ziehen können, wird besonders deutlich werden, sobald
außer dem zweiten Band auch noch der Apparat vorliegt. In der Hoffnung, daß sein
Erscheinen sich nicht zu sehr verzögert, kann sich dieser Bericht mit den vorstehen-
den allgemeinen Bemerkungen zufriedengeben. Wer wollte überhaupt mit Körner wett-
eifern, wenn es gilt, sichtbar zu machen, was neue Quellen aus dem Schlegel-Kreis im
einzelnen an neuen Aufschlüssen bieten, inwiefern sie uns in einer wirklichen Sach-
kenntnis weiterhelfen. Wenn man von einem Fortschritt der Einsichten reden darf,
so wird ihn Körner am genauesten ermessen. Das wird jedem klar, der beispielsweise
den Kommentarband der 1930 von ihm herausgebrachten Briefe von und an August
Wilhelm Schlegel aufschlägt und einzelne darin enthaltene Äußerungen zu dem neuen
Material in Beziehung setzt. S. 87 heißt es dort beispielsweise: „Von Reimers Brie-
fen an Schlegel vor 1812 ist nichts erhalten." Der Coppeter Fund hat diese Behaup-
tung über den Haufen geworfen. — Der Brief von Heinrich Voss d. J., der S. 88 als
nicht erhalten bezeichnet wird, steht in der neuen Sammlung auf S. 354. — Wenn der
Kommentarband auf S. 96 sagt: „Aus den Jahren 1804—1810 sind keine Briefe
(Friedrichs) an August Wilhelm bewahrt", so besitzen wir jetzt solche Briefe als eine
der wesentlichen Kostbarkeiten des neuen Corpus. — Von den Briefen Sophie Bern-
hardis an August Wilhelm, die auf S. 96 ebenfalls als verschollen gebucht werden,
war oben ausführlich die Rede. — Das sind nur ein paar Beispiele für den sachlichen
Fortschritt unseres Wissens, den uns Josef Körner ohne Zweifel nach allen Seiten
hin verdeutlichen wird.
Marburg. Wilhelm Kalthoff.
Hermann Blackert: Der Aufbau der Kunstwirklichkeit bei
Marcel Proust, aufgezeigt an der Einführung der Personen in „A la
recherche du temps perdu". Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1935 (Neue deutsche
Forschungen, Abteilung Romanische Philologie).
Daß keine literarische Äußerung etwas anderes als „Schau" ihres Schöpfers,
die Wirklichkeit im Werke immer nur Kunst Wirklichkeit sein kann, wird heute
auch der beschränkteste Literarhistoriker nicht mehr leugnen; ist es doch eine Selbst-
verständlichkeit. Den Kritiker aber muß es locken Einblick zu erlangen in die Art,
wie sich diese Kunstwirklichkeit im einzelnen Werk vom Ich des Schöpfers aus je-
weils in Stufen, Spiegelungen, Brechungen aufbaut. Die Probleme, die sich da er-
geben, sind schon vielfach erörtert worden. Jede neuere Darstellung der Ästhetik
oder Kunstwissenschaft spricht von ihnen, Sprachtheorie und Poetik haben sie nicht
vernachlässigt. In den Büchern etwa von Roetteken (Poetik, 1902), Th. A.
Meyer (Das Stilgesetz der Poesie, 1901) und in so und so vielen anderen finden
sich zahllose Beobachtungen zur Gestaltung dichterischer Wirklichkeit durch Sprache.
K. Friedemann aber widmete bereits 1910 ein eigenes Buch der auch hier ent-
scheidenden Sonderfrage nach der „Rolle des Erzählers in der Epik". Siehe auch Ref.,
Das dichterische Kunstwerk, 1924.
Es muß zweifelhaft erscheinen, ob Marcel Prousts Werk wirklich jene geistige
und künstlerische Bedeutung hat, die ihm manche zugeschrieben haben und die die
eingehende wissenschaftliche Beschäftigung mit ihm rechtfertigen würde, die es z. B.
auch bei Blackert wieder gefunden hat. Jedenfalls aber stellt es in dem Aufbau seiner
357
einer magisch gefärbten Naturwissenschaft, das Verhältnis des Schlegel-Kreises zu
Goethe, das Zeitschriftenwesen jener Jahre, die Rolle der Romantiker im akademi-
schen Leben ihrer Zeit.
Der Gewinn, den biographische und geistesgeschichtliche Romantik-Forschung
aus der neuen Briefsammlung ziehen können, wird besonders deutlich werden, sobald
außer dem zweiten Band auch noch der Apparat vorliegt. In der Hoffnung, daß sein
Erscheinen sich nicht zu sehr verzögert, kann sich dieser Bericht mit den vorstehen-
den allgemeinen Bemerkungen zufriedengeben. Wer wollte überhaupt mit Körner wett-
eifern, wenn es gilt, sichtbar zu machen, was neue Quellen aus dem Schlegel-Kreis im
einzelnen an neuen Aufschlüssen bieten, inwiefern sie uns in einer wirklichen Sach-
kenntnis weiterhelfen. Wenn man von einem Fortschritt der Einsichten reden darf,
so wird ihn Körner am genauesten ermessen. Das wird jedem klar, der beispielsweise
den Kommentarband der 1930 von ihm herausgebrachten Briefe von und an August
Wilhelm Schlegel aufschlägt und einzelne darin enthaltene Äußerungen zu dem neuen
Material in Beziehung setzt. S. 87 heißt es dort beispielsweise: „Von Reimers Brie-
fen an Schlegel vor 1812 ist nichts erhalten." Der Coppeter Fund hat diese Behaup-
tung über den Haufen geworfen. — Der Brief von Heinrich Voss d. J., der S. 88 als
nicht erhalten bezeichnet wird, steht in der neuen Sammlung auf S. 354. — Wenn der
Kommentarband auf S. 96 sagt: „Aus den Jahren 1804—1810 sind keine Briefe
(Friedrichs) an August Wilhelm bewahrt", so besitzen wir jetzt solche Briefe als eine
der wesentlichen Kostbarkeiten des neuen Corpus. — Von den Briefen Sophie Bern-
hardis an August Wilhelm, die auf S. 96 ebenfalls als verschollen gebucht werden,
war oben ausführlich die Rede. — Das sind nur ein paar Beispiele für den sachlichen
Fortschritt unseres Wissens, den uns Josef Körner ohne Zweifel nach allen Seiten
hin verdeutlichen wird.
Marburg. Wilhelm Kalthoff.
Hermann Blackert: Der Aufbau der Kunstwirklichkeit bei
Marcel Proust, aufgezeigt an der Einführung der Personen in „A la
recherche du temps perdu". Berlin, Junker u. Dünnhaupt, 1935 (Neue deutsche
Forschungen, Abteilung Romanische Philologie).
Daß keine literarische Äußerung etwas anderes als „Schau" ihres Schöpfers,
die Wirklichkeit im Werke immer nur Kunst Wirklichkeit sein kann, wird heute
auch der beschränkteste Literarhistoriker nicht mehr leugnen; ist es doch eine Selbst-
verständlichkeit. Den Kritiker aber muß es locken Einblick zu erlangen in die Art,
wie sich diese Kunstwirklichkeit im einzelnen Werk vom Ich des Schöpfers aus je-
weils in Stufen, Spiegelungen, Brechungen aufbaut. Die Probleme, die sich da er-
geben, sind schon vielfach erörtert worden. Jede neuere Darstellung der Ästhetik
oder Kunstwissenschaft spricht von ihnen, Sprachtheorie und Poetik haben sie nicht
vernachlässigt. In den Büchern etwa von Roetteken (Poetik, 1902), Th. A.
Meyer (Das Stilgesetz der Poesie, 1901) und in so und so vielen anderen finden
sich zahllose Beobachtungen zur Gestaltung dichterischer Wirklichkeit durch Sprache.
K. Friedemann aber widmete bereits 1910 ein eigenes Buch der auch hier ent-
scheidenden Sonderfrage nach der „Rolle des Erzählers in der Epik". Siehe auch Ref.,
Das dichterische Kunstwerk, 1924.
Es muß zweifelhaft erscheinen, ob Marcel Prousts Werk wirklich jene geistige
und künstlerische Bedeutung hat, die ihm manche zugeschrieben haben und die die
eingehende wissenschaftliche Beschäftigung mit ihm rechtfertigen würde, die es z. B.
auch bei Blackert wieder gefunden hat. Jedenfalls aber stellt es in dem Aufbau seiner