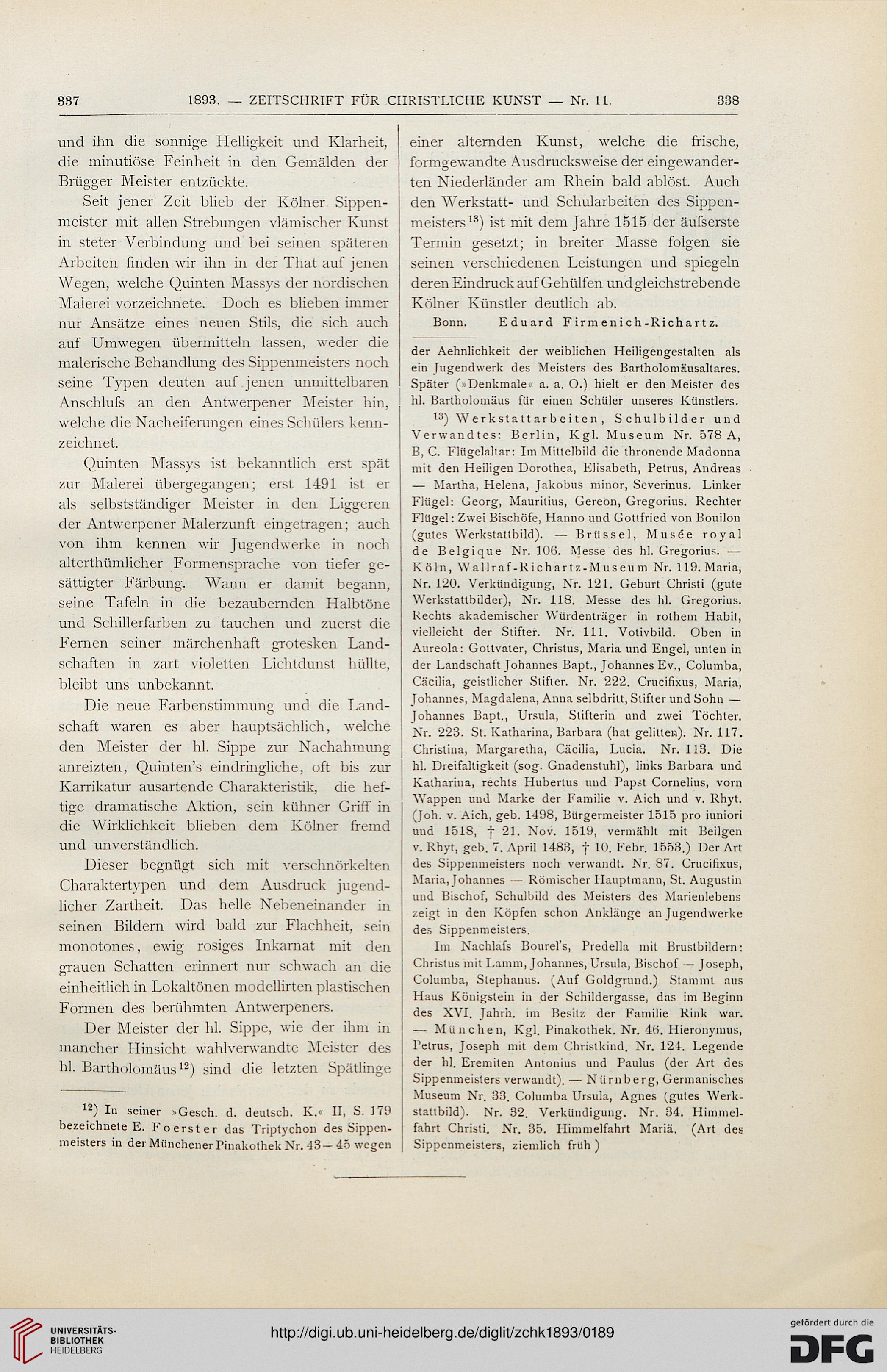837
1893. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
338
und ihn die sonnige Helligkeit und Klarheit,
die minutiöse Feinheit in den Gemälden der
Brügger Meister entzückte.
Seit jener Zeit blieb der Kölner. Sippen-
meister mit allen Strebungen vlämischer Kunst
in steter Verbindung und bei seinen späteren
Arbeiten finden wir ihn in der That auf jenen
Wegen, welche Quinten Massys der nordischen
Malerei vorzeichnete. Doch es blieben immer
nur Ansätze eines neuen Stils, die sich auch
auf Umwegen übermitteln lassen, weder die
malerische Behandlung des Sippenmeisters noch
seine Typen deuten auf jenen unmittelbaren
Anschluß an den Antwerpener Meister hin,
welche die Nacheiferungen eines Schülers kenn-
zeichnet.
Quinten Massys ist bekanntlich erst spät
zur Malerei übergegangen; erst 1491 ist er
als selbstständiger Meister in den Liggeren
der Antwerpener Malerzunft eingetragen; auch
von ihm kennen wir Jugendwerke in noch
alterthümlicher Formensprache von tiefer ge-
sättigter Färbung. Wann er damit begann,
seine Tafeln in die bezaubernden Halbtöne
und Schillerfarben zu tauchen und zuerst die
Fernen seiner märchenhaft grotesken Land-
schaften in zart violetten Lichtdunst hüllte,
bleibt uns unbekannt.
Die neue Farbenstimmung und die Land-
schaft waren es aber hauptsächlich, welche
den Meister der hl. Sippe zur Nachahmung
anreizten, Quinten's eindringliche, oft bis zur
Karrikatur ausartende Charakteristik, die hef-
tige dramatische Aktion, sein kühner Griff in
die Wirklichkeit blieben dem Kölner fremd
und unverständlich.
Dieser begnügt sich mit verschnörkelten
Charaktertypen und dem Ausdruck jugend-
licher Zartheit. Das helle Nebeneinander in
seinen Bildern wird bald zur Flachheit, sein
monotones, ewig rosiges Inkarnat mit den
grauen Schatten erinnert nur schwach an die
einheitlich in Lokaltönen modellirten plastischen
Formen des berühmten Antwerpeners.
Der Meister der hl. Sippe, wie der ihm in
mancher Hinsicht wahlverwandte Meister des
hl. Barthölon
einer alternden Kunst, welche die frische,
formgewandte Ausdrucksweise der eingewander-
ten Niederländer am Rhein bald ablöst. Auch
den Werkstatt- und Schularbeiten des Sippen-
meisters13) ist mit dem Jahre 1515 der äufserste
Termin gesetzt; in breiter Masse folgen sie
seinen verschiedenen Leistungen und spiegeln
deren Eindruck auf Gehülfen und gleichstrebende
Kölner Künstler deutlich ab.
Bonn. Eduard F irm eni ch -Richart z.
id die letzten Spätlinge
12) In seiner »Gesch. d. deutsch. K.< II, S. 179
bezeichnete E. Foerster das Triptychon des Sippen-
meisters in der Münchener Pinakothek Nr. 43— 45 wegen
der Aehnlichkeit der weiblichen Heiligengestalten als
ein Jugendwerk des Meisters des BarlholomSusaltares.
Später (»Denkmale« a. a. O.) hielt er den Meister des
hl. Bartholomäus für einen Schüler unseres Kunstlers.
13) Werkstattarbeiten, Schulbilder und
Verwandtes: Berlin, Kgl. Museum Nr. 578 A,
B, C. Flilgelaltar: Im Mittelbild die thronende Madonna
mit den Heiligen Dorothea, Elisabeth, Petrus, Andreas
— Martha, Helena, Jakobus minor, Severinus. Linker
Flügel: Georg, Mauritius, Gereon, Gregorius. Rechter
P'lügel: Zwei Bischöfe, Hanno und Gottfried von Bouilon
(gutes Werkstattbild). — Brüssel, Musee royal
de Belgique Nr. 10G. Messe des hl. Gregorius. —
Köln, YVallraf-Richartz-Museu m Nr. 119. Maria,
Nr. 120. Verkündigung, Nr. 121. Geburt Christi (gute
Werkstaubilder), Nr. 118. Messe des hl. Gregorius.
Rechts akademischer Würdenträger in rothem Habit,
vielleicht der Stifter. Nr. 111. Votivbild. Oben in
Aureola: Gottvater, Christus, Maria und Engel, unten in
der Landschaft Johannes Bapt., Johannes Ev., Columba,
Cäcilia, geistlicher Stifter. Nr. 222. Crucifixus, Maria,
Johannes, Magdalena, Anna selbdritt, Stifter und Sohn —
Johannes Bapt., Ursula, Stifterin und zwei Töchter.
Nr. 223. St. Katharina, Barbara (hat gelitten). Nr. 117.
Christina, Margaretha, Cäcilia, Lucia. Nr. 113. Die
hl. Dreifaltigkeit (sog. Gnadenstuhl), links Barbara und
Katharina, rechts Hubertus und Papst Cornelius, vorn
Wappen und Marke der Familie v. Aich und v. Rhyt.
(Joh. v. Aich, geb. 1498, Bürgermeister 1515 pro iuniori
und 1518, j 21. Nov. 1519, vermählt mit Beilgen
v. Rhyt, geb. 7. April 1483, f 10. Febr. 1553.) Der Art
des Sippenmeisters noch verwandt. Nr. 87. Crucifixus,
Maria, lohannes — Römischer Hauptmann, St. Auguslin
und Bischof, Schulbild des Meisters des Marienlebens
zeigt in den Köpfen schon Anklänge an Jugendwerke
des Sippenmeisters.
Im Nachlafs Bourel's, Predella mit Brustbildern:
Christus mit Lamm, Johannes, Ursula, Bischof — Joseph,
Columba, Stephanus. (Auf Goldgrund.) Stammt aus
Haus Königstein in der Schildergasse, das im Beginn
des XVI. Jahrb. im Besitz der Familie Rink war.
— München, Kgl. Pinakothek. Nr. 46. Hieronymus,
Petrus, Joseph mit dem Christkind. Nr. 124. Legende
der hl. Eremiten Antonius und Paulus (der Art des
Sippenmeisters verwandt). — Nürnberg, Germanisches
Museum Nr. 33. Columba Ursula, Agnes (gutes Werk-
stattbild). Nr. 32. Verkündigung. Nr. 34. Himmel-
fahrt Christi. Nr. 35. Himmelfahrt Maria. (Art des
Sippenmeisters, ziemlich früh )
1893. _ ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
338
und ihn die sonnige Helligkeit und Klarheit,
die minutiöse Feinheit in den Gemälden der
Brügger Meister entzückte.
Seit jener Zeit blieb der Kölner. Sippen-
meister mit allen Strebungen vlämischer Kunst
in steter Verbindung und bei seinen späteren
Arbeiten finden wir ihn in der That auf jenen
Wegen, welche Quinten Massys der nordischen
Malerei vorzeichnete. Doch es blieben immer
nur Ansätze eines neuen Stils, die sich auch
auf Umwegen übermitteln lassen, weder die
malerische Behandlung des Sippenmeisters noch
seine Typen deuten auf jenen unmittelbaren
Anschluß an den Antwerpener Meister hin,
welche die Nacheiferungen eines Schülers kenn-
zeichnet.
Quinten Massys ist bekanntlich erst spät
zur Malerei übergegangen; erst 1491 ist er
als selbstständiger Meister in den Liggeren
der Antwerpener Malerzunft eingetragen; auch
von ihm kennen wir Jugendwerke in noch
alterthümlicher Formensprache von tiefer ge-
sättigter Färbung. Wann er damit begann,
seine Tafeln in die bezaubernden Halbtöne
und Schillerfarben zu tauchen und zuerst die
Fernen seiner märchenhaft grotesken Land-
schaften in zart violetten Lichtdunst hüllte,
bleibt uns unbekannt.
Die neue Farbenstimmung und die Land-
schaft waren es aber hauptsächlich, welche
den Meister der hl. Sippe zur Nachahmung
anreizten, Quinten's eindringliche, oft bis zur
Karrikatur ausartende Charakteristik, die hef-
tige dramatische Aktion, sein kühner Griff in
die Wirklichkeit blieben dem Kölner fremd
und unverständlich.
Dieser begnügt sich mit verschnörkelten
Charaktertypen und dem Ausdruck jugend-
licher Zartheit. Das helle Nebeneinander in
seinen Bildern wird bald zur Flachheit, sein
monotones, ewig rosiges Inkarnat mit den
grauen Schatten erinnert nur schwach an die
einheitlich in Lokaltönen modellirten plastischen
Formen des berühmten Antwerpeners.
Der Meister der hl. Sippe, wie der ihm in
mancher Hinsicht wahlverwandte Meister des
hl. Barthölon
einer alternden Kunst, welche die frische,
formgewandte Ausdrucksweise der eingewander-
ten Niederländer am Rhein bald ablöst. Auch
den Werkstatt- und Schularbeiten des Sippen-
meisters13) ist mit dem Jahre 1515 der äufserste
Termin gesetzt; in breiter Masse folgen sie
seinen verschiedenen Leistungen und spiegeln
deren Eindruck auf Gehülfen und gleichstrebende
Kölner Künstler deutlich ab.
Bonn. Eduard F irm eni ch -Richart z.
id die letzten Spätlinge
12) In seiner »Gesch. d. deutsch. K.< II, S. 179
bezeichnete E. Foerster das Triptychon des Sippen-
meisters in der Münchener Pinakothek Nr. 43— 45 wegen
der Aehnlichkeit der weiblichen Heiligengestalten als
ein Jugendwerk des Meisters des BarlholomSusaltares.
Später (»Denkmale« a. a. O.) hielt er den Meister des
hl. Bartholomäus für einen Schüler unseres Kunstlers.
13) Werkstattarbeiten, Schulbilder und
Verwandtes: Berlin, Kgl. Museum Nr. 578 A,
B, C. Flilgelaltar: Im Mittelbild die thronende Madonna
mit den Heiligen Dorothea, Elisabeth, Petrus, Andreas
— Martha, Helena, Jakobus minor, Severinus. Linker
Flügel: Georg, Mauritius, Gereon, Gregorius. Rechter
P'lügel: Zwei Bischöfe, Hanno und Gottfried von Bouilon
(gutes Werkstattbild). — Brüssel, Musee royal
de Belgique Nr. 10G. Messe des hl. Gregorius. —
Köln, YVallraf-Richartz-Museu m Nr. 119. Maria,
Nr. 120. Verkündigung, Nr. 121. Geburt Christi (gute
Werkstaubilder), Nr. 118. Messe des hl. Gregorius.
Rechts akademischer Würdenträger in rothem Habit,
vielleicht der Stifter. Nr. 111. Votivbild. Oben in
Aureola: Gottvater, Christus, Maria und Engel, unten in
der Landschaft Johannes Bapt., Johannes Ev., Columba,
Cäcilia, geistlicher Stifter. Nr. 222. Crucifixus, Maria,
Johannes, Magdalena, Anna selbdritt, Stifter und Sohn —
Johannes Bapt., Ursula, Stifterin und zwei Töchter.
Nr. 223. St. Katharina, Barbara (hat gelitten). Nr. 117.
Christina, Margaretha, Cäcilia, Lucia. Nr. 113. Die
hl. Dreifaltigkeit (sog. Gnadenstuhl), links Barbara und
Katharina, rechts Hubertus und Papst Cornelius, vorn
Wappen und Marke der Familie v. Aich und v. Rhyt.
(Joh. v. Aich, geb. 1498, Bürgermeister 1515 pro iuniori
und 1518, j 21. Nov. 1519, vermählt mit Beilgen
v. Rhyt, geb. 7. April 1483, f 10. Febr. 1553.) Der Art
des Sippenmeisters noch verwandt. Nr. 87. Crucifixus,
Maria, lohannes — Römischer Hauptmann, St. Auguslin
und Bischof, Schulbild des Meisters des Marienlebens
zeigt in den Köpfen schon Anklänge an Jugendwerke
des Sippenmeisters.
Im Nachlafs Bourel's, Predella mit Brustbildern:
Christus mit Lamm, Johannes, Ursula, Bischof — Joseph,
Columba, Stephanus. (Auf Goldgrund.) Stammt aus
Haus Königstein in der Schildergasse, das im Beginn
des XVI. Jahrb. im Besitz der Familie Rink war.
— München, Kgl. Pinakothek. Nr. 46. Hieronymus,
Petrus, Joseph mit dem Christkind. Nr. 124. Legende
der hl. Eremiten Antonius und Paulus (der Art des
Sippenmeisters verwandt). — Nürnberg, Germanisches
Museum Nr. 33. Columba Ursula, Agnes (gutes Werk-
stattbild). Nr. 32. Verkündigung. Nr. 34. Himmel-
fahrt Christi. Nr. 35. Himmelfahrt Maria. (Art des
Sippenmeisters, ziemlich früh )