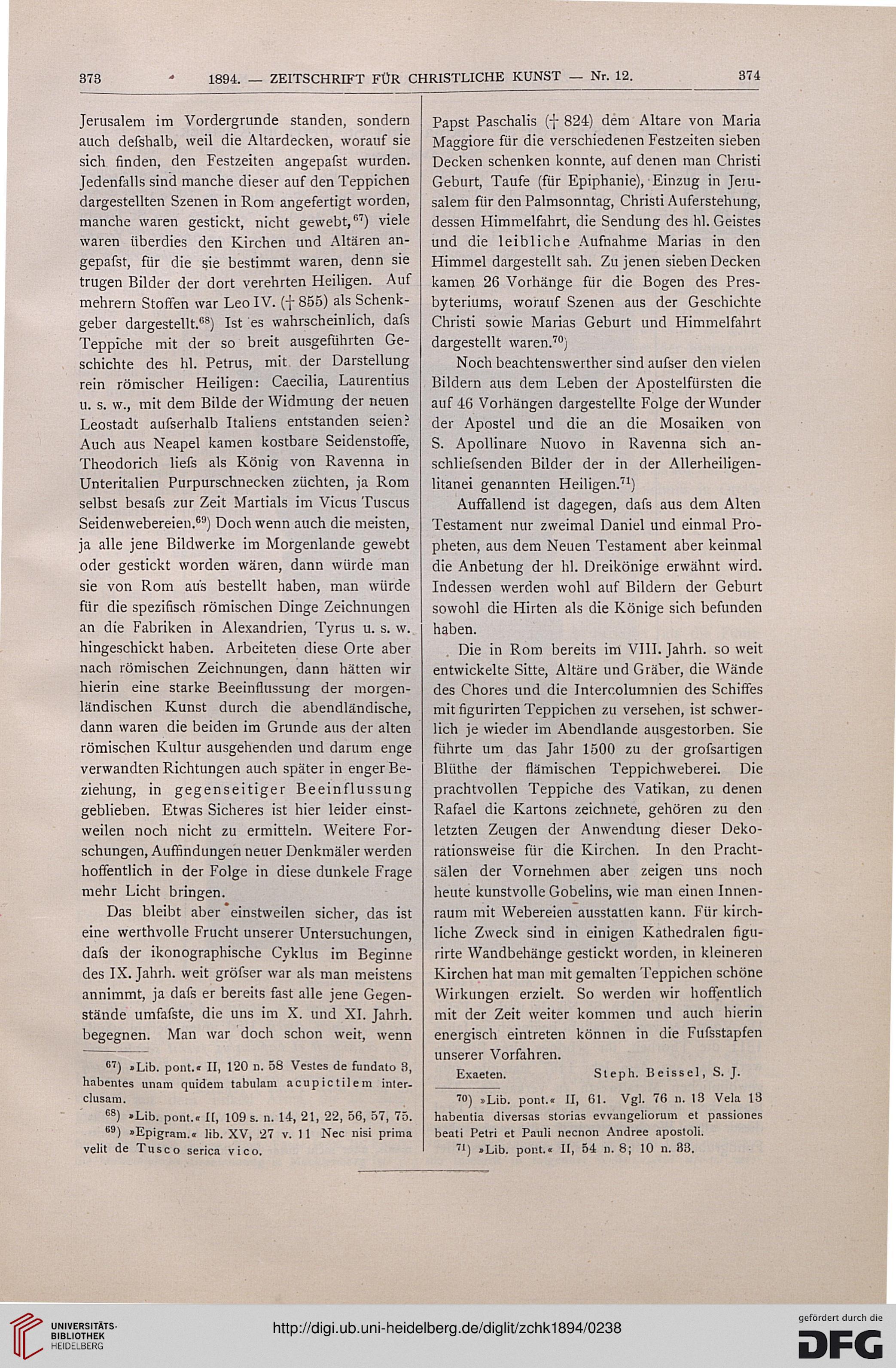373
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
374
Jerusalem im Vordergrunde standen, sondern
auch defshalb, weil die Altardecken, worauf sie
sich finden, den Festzeiten angepafst wurden.
Jedenfalls sind manche dieser auf den Teppichen
dargestellten Szenen in Rom angefertigt worden,
manche waren gestickt, nicht gewebt,67) viele
waren überdies den Kirchen und Altären an-
gepafst, für die sie bestimmt waren, denn sie
trugen Bilder der dort verehrten Heiligen. Auf
mehrern Stoffen war Leo IV. (f 855) als Schenk-
geber dargestellt.68) Ist es wahrscheinlich, dafs
Teppiche mit der so breit ausgeführten Ge-
schichte des hl. Petrus, mit der Darstellung
rein römischer Heiligen: Caecilia, Laurentius
u. s. w., mit dem Bilde der Widmung der neuen
Leostadt aufserhalb Italiens entstanden seien?
Auch aus Neapel kamen kostbare Seidenstoffe,
Theodorich liefs als König von Ravenna in
Unteritalien Purpurschnecken züchten, ja Rom
selbst besafs zur Zeit Martials im Vicus 'ruscus
Seidenwebereien.69) Doch wenn auch die meisten,
ja alle jene Bildwerke im Morgenlande gewebt
oder gestickt worden wären, dann würde man
sie von Rom aus bestellt haben, man würde
für die spezifisch römischen Dinge Zeichnungen
an die Fabriken in Alexandrien, Tyrus u. s. w.
hingeschickt haben. Arbeiteten diese Orte aber
nach römischen Zeichnungen, dann hätten wir
hierin eine starke Beeinflussung der morgen-
ländischen Kunst durch die abendländische,
dann waren die beiden im Grunde aus der alten
römischen Kultur ausgehenden und darum enge
verwandten Richtungen auch später in enger Be-
ziehung, in gegenseitiger Beeinflussung
geblieben. Etwas Sicheres ist hier leider einst-
weilen noch nicht zu ermitteln. Weitere For-
schungen, Auffindungen neuer Denkmäler werden
hoffentlich in der Folge in diese dunkele Frage
mehr Licht bringen.
Das bleibt aber einstweilen sicher, das ist
eine werthvolle Frucht unserer Untersuchungen,
dafs der ikonographische Cyklus im Beginne
des IX. Jahrh. weit gröfser war als man meistens
annimmt, ja dafs er bereits fast alle jene Gegen-
stände umfafste, die uns im X. und XI. Jahrh.
begegnen. Man war doch schon weit, wenn
67) »Lib. pont.« II, 120 n. 58 Vestes de fundato 3,
habentes unam quidem tabulam acupictilem inler-
clusam.
68) «Lib. pont.c II, 109 s. n. 14, 21, 22, 56, 57, 75.
B9) »Epigram.« lib. XV, 27 v. 11 Nee nisi prima
veüt de Tusco serica vico.
Papst Paschalis (f 824) dem Altare von Maria
Maggiore für die verschiedenen Festzeiten sieben
Decken schenken konnte, auf denen man Christi
Geburt, Taufe (für Epiphanie), Einzug in Jeiu-
salem für den Palmsonntag, Christi Auferstehung,
dessen Himmelfahrt, die Sendung des hl. Geistes
und die leibliche Aufnahme Marias in den
Himmel dargestellt sah. Zu jenen sieben Decken
kamen 26 Vorhänge für die Bogen des Pres-
byteriums, worauf Szenen aus der Geschichte
Christi sowie Marias Geburt und Himmelfahrt
dargestellt waren.70)
Noch beachtenswerther sind aufser den vielen
Bildern aus dem Leben der Apostelfürsten die
auf 46 Vorhängen dargestellte Folge der Wunder
der Apostel und die an die Mosaiken von
S. Apollinare Nuovo in Ravenna sich an-
schliefsenden Bilder der in der Allerheiligen-
litanei genannten Heiligen.71)
Auffallend ist dagegen, dafs aus dem Alten
Testament nur zweimal Daniel und einmal Pro-
pheten, aus dem Neuen Testament aber keinmal
die Anbetung der hl. Dreikönige erwähnt wird.
Indessen werden wohl auf Bildern der Geburt
sowohl die Hirten als die Könige sich befunden
haben.
Die in Rom bereits im VIII. Jahrh. so weit
entwickelte Sitte, Altäre und Gräber, die Wände
des Chores und die Intercolumnien des Schiffes
mit figurirten Teppichen zu versehen, ist schwer-
lich je wieder im Abendlande ausgestorben. Sie
führte um das Jahr 1500 zu der grofsartigen
Blüthe der flämischen Teppichweberei. Die
prachtvollen Teppiche des Vatikan, zu denen
Rafael die Kartons zeichnete, gehören zu den
letzten Zeugen der Anwendung dieser Deko-
rationsweise für die Kirchen. In den Pracht-
sälen der Vornehmen aber zeigen uns noch
heute kunstvolle Gobelins, wie man einen Innen-
raum mit Webereien ausstatten kann. Für kirch-
liche Zweck sind in einigen Kathedralen figu-
rirte Wandbehänge gestickt worden, in kleineren
Kirchen hat man mit gemalten Teppichen schöne
Wirkungen erzielt. So werden wir hoffentlich
mit der Zeit weiter kommen und auch hierin
energisch eintreten können in die Fufsstapfen
unserer Vorfahren.
Exaeten. Steph. Beissel, S. J.
™) »Lib. pont.« II, 61. Vgl. 76 n. 13 Vela 13
habentia diversas storias evvangeliorum et passiones
beati Petri et Pauli neenon Andree apostoli.
71) .Lib. pont.« II, 54 n. 8; 10 n. 33.
1894. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
374
Jerusalem im Vordergrunde standen, sondern
auch defshalb, weil die Altardecken, worauf sie
sich finden, den Festzeiten angepafst wurden.
Jedenfalls sind manche dieser auf den Teppichen
dargestellten Szenen in Rom angefertigt worden,
manche waren gestickt, nicht gewebt,67) viele
waren überdies den Kirchen und Altären an-
gepafst, für die sie bestimmt waren, denn sie
trugen Bilder der dort verehrten Heiligen. Auf
mehrern Stoffen war Leo IV. (f 855) als Schenk-
geber dargestellt.68) Ist es wahrscheinlich, dafs
Teppiche mit der so breit ausgeführten Ge-
schichte des hl. Petrus, mit der Darstellung
rein römischer Heiligen: Caecilia, Laurentius
u. s. w., mit dem Bilde der Widmung der neuen
Leostadt aufserhalb Italiens entstanden seien?
Auch aus Neapel kamen kostbare Seidenstoffe,
Theodorich liefs als König von Ravenna in
Unteritalien Purpurschnecken züchten, ja Rom
selbst besafs zur Zeit Martials im Vicus 'ruscus
Seidenwebereien.69) Doch wenn auch die meisten,
ja alle jene Bildwerke im Morgenlande gewebt
oder gestickt worden wären, dann würde man
sie von Rom aus bestellt haben, man würde
für die spezifisch römischen Dinge Zeichnungen
an die Fabriken in Alexandrien, Tyrus u. s. w.
hingeschickt haben. Arbeiteten diese Orte aber
nach römischen Zeichnungen, dann hätten wir
hierin eine starke Beeinflussung der morgen-
ländischen Kunst durch die abendländische,
dann waren die beiden im Grunde aus der alten
römischen Kultur ausgehenden und darum enge
verwandten Richtungen auch später in enger Be-
ziehung, in gegenseitiger Beeinflussung
geblieben. Etwas Sicheres ist hier leider einst-
weilen noch nicht zu ermitteln. Weitere For-
schungen, Auffindungen neuer Denkmäler werden
hoffentlich in der Folge in diese dunkele Frage
mehr Licht bringen.
Das bleibt aber einstweilen sicher, das ist
eine werthvolle Frucht unserer Untersuchungen,
dafs der ikonographische Cyklus im Beginne
des IX. Jahrh. weit gröfser war als man meistens
annimmt, ja dafs er bereits fast alle jene Gegen-
stände umfafste, die uns im X. und XI. Jahrh.
begegnen. Man war doch schon weit, wenn
67) »Lib. pont.« II, 120 n. 58 Vestes de fundato 3,
habentes unam quidem tabulam acupictilem inler-
clusam.
68) «Lib. pont.c II, 109 s. n. 14, 21, 22, 56, 57, 75.
B9) »Epigram.« lib. XV, 27 v. 11 Nee nisi prima
veüt de Tusco serica vico.
Papst Paschalis (f 824) dem Altare von Maria
Maggiore für die verschiedenen Festzeiten sieben
Decken schenken konnte, auf denen man Christi
Geburt, Taufe (für Epiphanie), Einzug in Jeiu-
salem für den Palmsonntag, Christi Auferstehung,
dessen Himmelfahrt, die Sendung des hl. Geistes
und die leibliche Aufnahme Marias in den
Himmel dargestellt sah. Zu jenen sieben Decken
kamen 26 Vorhänge für die Bogen des Pres-
byteriums, worauf Szenen aus der Geschichte
Christi sowie Marias Geburt und Himmelfahrt
dargestellt waren.70)
Noch beachtenswerther sind aufser den vielen
Bildern aus dem Leben der Apostelfürsten die
auf 46 Vorhängen dargestellte Folge der Wunder
der Apostel und die an die Mosaiken von
S. Apollinare Nuovo in Ravenna sich an-
schliefsenden Bilder der in der Allerheiligen-
litanei genannten Heiligen.71)
Auffallend ist dagegen, dafs aus dem Alten
Testament nur zweimal Daniel und einmal Pro-
pheten, aus dem Neuen Testament aber keinmal
die Anbetung der hl. Dreikönige erwähnt wird.
Indessen werden wohl auf Bildern der Geburt
sowohl die Hirten als die Könige sich befunden
haben.
Die in Rom bereits im VIII. Jahrh. so weit
entwickelte Sitte, Altäre und Gräber, die Wände
des Chores und die Intercolumnien des Schiffes
mit figurirten Teppichen zu versehen, ist schwer-
lich je wieder im Abendlande ausgestorben. Sie
führte um das Jahr 1500 zu der grofsartigen
Blüthe der flämischen Teppichweberei. Die
prachtvollen Teppiche des Vatikan, zu denen
Rafael die Kartons zeichnete, gehören zu den
letzten Zeugen der Anwendung dieser Deko-
rationsweise für die Kirchen. In den Pracht-
sälen der Vornehmen aber zeigen uns noch
heute kunstvolle Gobelins, wie man einen Innen-
raum mit Webereien ausstatten kann. Für kirch-
liche Zweck sind in einigen Kathedralen figu-
rirte Wandbehänge gestickt worden, in kleineren
Kirchen hat man mit gemalten Teppichen schöne
Wirkungen erzielt. So werden wir hoffentlich
mit der Zeit weiter kommen und auch hierin
energisch eintreten können in die Fufsstapfen
unserer Vorfahren.
Exaeten. Steph. Beissel, S. J.
™) »Lib. pont.« II, 61. Vgl. 76 n. 13 Vela 13
habentia diversas storias evvangeliorum et passiones
beati Petri et Pauli neenon Andree apostoli.
71) .Lib. pont.« II, 54 n. 8; 10 n. 33.