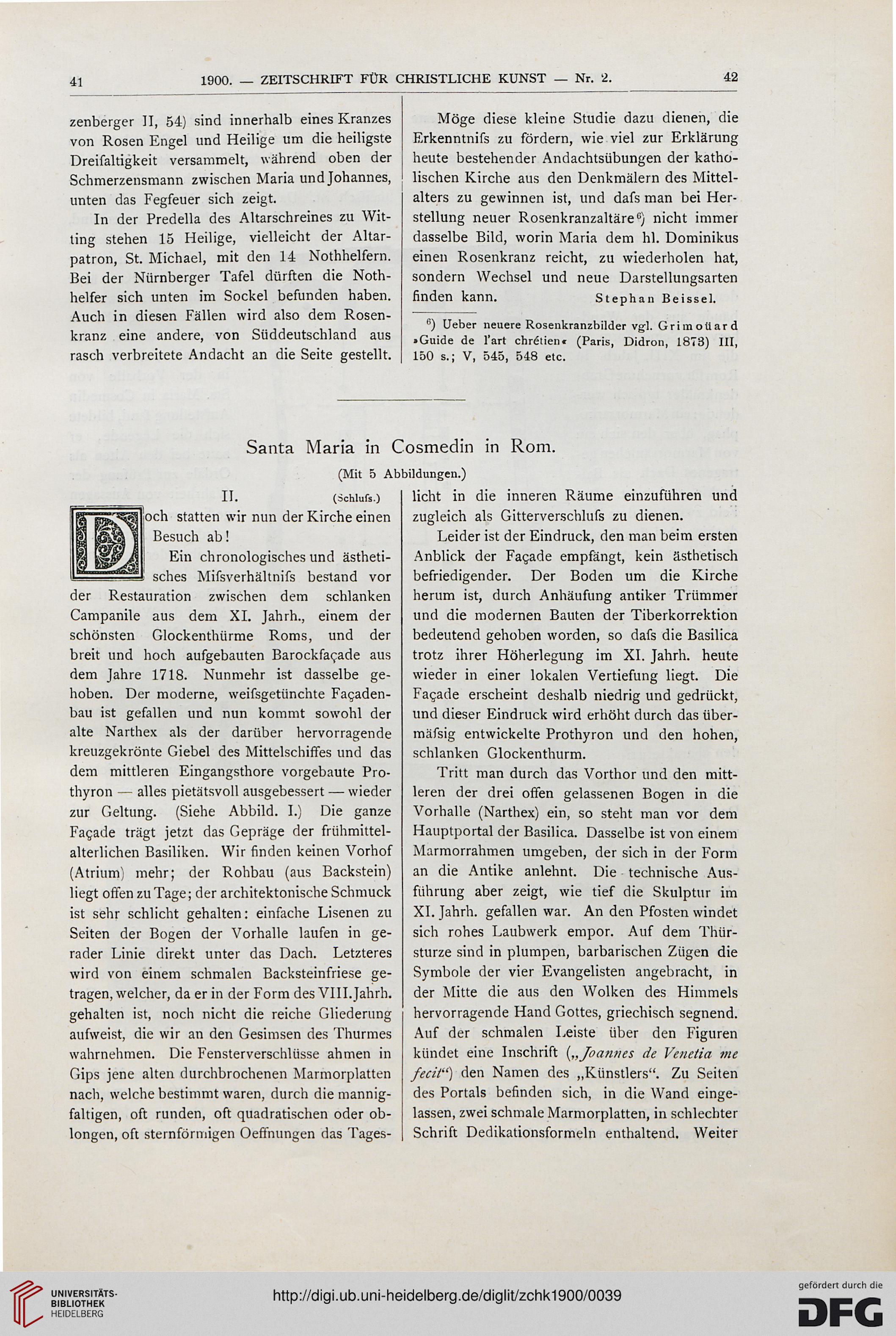41
1900. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
42
zenberger II, 54) sind innerhalb eines Kranzes
von Rosen Engel und Heilige um die heiligste
Dreifaltigkeit versammelt, während oben der
Schmerzensmann zwischen Maria und Johannes,
unten das Fegfeuer sich zeigt.
In der Predella des Altarschreines zu Wit-
ting stehen 15 Heilige, vielleicht der Altar-
patron, St. Michael, mit den 14 Nothhelfern.
Bei der Nürnberger Tafel dürften die Noth-
helfer sich unten im Sockel befunden haben.
Auch in diesen Fällen wird also dem Rosen-
kranz eine andere, von Süddeutschland aus
rasch verbreitete Andacht an die Seite gestellt.
Möge diese kleine Studie dazu dienen, die
Erkenntnifs zu fördern, wie viel zur Erklärung
heute bestehender Andachtsübungen der katho-
lischen Kirche aus den Denkmälern des Mittel-
alters zu gewinnen ist, und dafs man bei Her-
stellung neuer Rosenkranzaltäre0) nicht immer
dasselbe Bild, worin Maria dem hl. Dominikus
einen Rosenkranz reicht, zu wiederholen hat,
sondern Wechsel und neue Darstellungsarten
finden kann. Stephan Beissel.
6) Ueber neuere Rosenkranzbilder vgl. Griinoüard
»Guide de l'art chre~tien« (Paris, Didron, 1873) III,
150 s.; V, 545, 548 etc.
Santa Maria in Cosmedin in Rom.
(Mit 5 Abbildungen.)
II. (Schlufs.)
joch statten wir nun der Kirche einen
Besuch ab!
Ein chronologisches und ästheti-
sches Mifsverhältnifs bestand vor
der Restauration zwischen dem schlanken
Campanile aus dem XL Jahrh., einem der
schönsten Glockenthürme Roms, und der
breit und hoch aufgebauten Barockfacade aus
dem Jahre 1718. Nunmehr ist dasselbe ge-
hoben. Der moderne, weifsgetünchte Facaden-
bau ist gefallen und nun kommt sowohl der
alte Narthex als der darüber hervorragende
kreuzgekrönte Giebel des Mittelschiffes und das
dem mittleren Eingangsthore vorgebaute Pro-
thyron — alles pietätsvoll ausgebessert — wieder
zur Geltung. (Siehe Abbild. I.) Die ganze
Facade trägt jetzt das Gepräge der frühmittel-
alterlichen Basiliken. Wir finden keinen Vorhof
(Atrium) mehr; der Rohbau (aus Backstein)
liegt offen zu Tage; der architektonische Schmuck
ist sehr schlicht gehalten: einfache Lisenen zu
Seiten der Bogen der Vorhalle laufen in ge-
rader Linie direkt unter das Dach. Letzteres
wird von einem schmalen Backsteinfriese ge-
tragen, welcher, da er in der Form des VIII.Jahrh.
gehalten ist, noch nicht die reiche Gliederung
aufweist, die wir an den Gesimsen des Thurmes
wahrnehmen. Die Fensterverschlüsse ahmen in
Gips jene alten durchbrochenen Marmorplatten
nach, welche bestimmt waren, durch die mannig-
faltigen, oft runden, oft quadratischen oder ob-
longen, oft sternförmigen Oeffnungen das Tages-
licht in die inneren Räume einzuführen und
zugleich als Gitterverschlufs zu dienen.
Leider ist der Eindruck, den man beim ersten
Anblick der Facade empfängt, kein ästhetisch
befriedigender. Der Boden um die Kirche
herum ist, durch Anhäufung antiker Trümmer
und die modernen Bauten der Tiberkorrektion
bedeutend gehoben worden, so dafs die Basilica
trotz ihrer Höherlegung im XL Jahrh. heute
wieder in einer lokalen Vertiefung liegt. Die
Facade erscheint deshalb niedrig und gedrückt,
und dieser Eindruck wird erhöht durch das über-
mäfsig entwickelte Prothyron und den hohen,
schlanken Glockenthurm.
Tritt man durch das Vorthor und den mitt-
leren der drei offen gelassenen Bogen in die
Vorhalle (Narthex) ein, so steht man vor dem
Hauptportal der Basilica. Dasselbe ist von einem
Marmorrahmen umgeben, der sich in der Form
an die Antike anlehnt. Die technische Aus-
führung aber zeigt, wie tief die Skulptur im
XL Jahrh. gefallen war. An den Pfosten windet
sich rohes Laubwerk empor. Auf dem Thür-
sturze sind in plumpen, barbarischen Zügen die
Symbole der vier Evangelisten angebracht, in
der Mitte die aus den Wolken des Himmels
hervorragende Hand Gottes, griechisch segnend.
Auf der schmalen Leiste über den Figuren
kündet eine Inschrift {„Joannes de Venetia nie
fecit") den Namen des „Künstlers". Zu Seiten
des Portals befinden sich, in die Wand einge-
lassen, zwei schmale Marmorplatten, in schlechter
Schrift Dedikationsformeln enthaltend. Weiter
1900. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 2.
42
zenberger II, 54) sind innerhalb eines Kranzes
von Rosen Engel und Heilige um die heiligste
Dreifaltigkeit versammelt, während oben der
Schmerzensmann zwischen Maria und Johannes,
unten das Fegfeuer sich zeigt.
In der Predella des Altarschreines zu Wit-
ting stehen 15 Heilige, vielleicht der Altar-
patron, St. Michael, mit den 14 Nothhelfern.
Bei der Nürnberger Tafel dürften die Noth-
helfer sich unten im Sockel befunden haben.
Auch in diesen Fällen wird also dem Rosen-
kranz eine andere, von Süddeutschland aus
rasch verbreitete Andacht an die Seite gestellt.
Möge diese kleine Studie dazu dienen, die
Erkenntnifs zu fördern, wie viel zur Erklärung
heute bestehender Andachtsübungen der katho-
lischen Kirche aus den Denkmälern des Mittel-
alters zu gewinnen ist, und dafs man bei Her-
stellung neuer Rosenkranzaltäre0) nicht immer
dasselbe Bild, worin Maria dem hl. Dominikus
einen Rosenkranz reicht, zu wiederholen hat,
sondern Wechsel und neue Darstellungsarten
finden kann. Stephan Beissel.
6) Ueber neuere Rosenkranzbilder vgl. Griinoüard
»Guide de l'art chre~tien« (Paris, Didron, 1873) III,
150 s.; V, 545, 548 etc.
Santa Maria in Cosmedin in Rom.
(Mit 5 Abbildungen.)
II. (Schlufs.)
joch statten wir nun der Kirche einen
Besuch ab!
Ein chronologisches und ästheti-
sches Mifsverhältnifs bestand vor
der Restauration zwischen dem schlanken
Campanile aus dem XL Jahrh., einem der
schönsten Glockenthürme Roms, und der
breit und hoch aufgebauten Barockfacade aus
dem Jahre 1718. Nunmehr ist dasselbe ge-
hoben. Der moderne, weifsgetünchte Facaden-
bau ist gefallen und nun kommt sowohl der
alte Narthex als der darüber hervorragende
kreuzgekrönte Giebel des Mittelschiffes und das
dem mittleren Eingangsthore vorgebaute Pro-
thyron — alles pietätsvoll ausgebessert — wieder
zur Geltung. (Siehe Abbild. I.) Die ganze
Facade trägt jetzt das Gepräge der frühmittel-
alterlichen Basiliken. Wir finden keinen Vorhof
(Atrium) mehr; der Rohbau (aus Backstein)
liegt offen zu Tage; der architektonische Schmuck
ist sehr schlicht gehalten: einfache Lisenen zu
Seiten der Bogen der Vorhalle laufen in ge-
rader Linie direkt unter das Dach. Letzteres
wird von einem schmalen Backsteinfriese ge-
tragen, welcher, da er in der Form des VIII.Jahrh.
gehalten ist, noch nicht die reiche Gliederung
aufweist, die wir an den Gesimsen des Thurmes
wahrnehmen. Die Fensterverschlüsse ahmen in
Gips jene alten durchbrochenen Marmorplatten
nach, welche bestimmt waren, durch die mannig-
faltigen, oft runden, oft quadratischen oder ob-
longen, oft sternförmigen Oeffnungen das Tages-
licht in die inneren Räume einzuführen und
zugleich als Gitterverschlufs zu dienen.
Leider ist der Eindruck, den man beim ersten
Anblick der Facade empfängt, kein ästhetisch
befriedigender. Der Boden um die Kirche
herum ist, durch Anhäufung antiker Trümmer
und die modernen Bauten der Tiberkorrektion
bedeutend gehoben worden, so dafs die Basilica
trotz ihrer Höherlegung im XL Jahrh. heute
wieder in einer lokalen Vertiefung liegt. Die
Facade erscheint deshalb niedrig und gedrückt,
und dieser Eindruck wird erhöht durch das über-
mäfsig entwickelte Prothyron und den hohen,
schlanken Glockenthurm.
Tritt man durch das Vorthor und den mitt-
leren der drei offen gelassenen Bogen in die
Vorhalle (Narthex) ein, so steht man vor dem
Hauptportal der Basilica. Dasselbe ist von einem
Marmorrahmen umgeben, der sich in der Form
an die Antike anlehnt. Die technische Aus-
führung aber zeigt, wie tief die Skulptur im
XL Jahrh. gefallen war. An den Pfosten windet
sich rohes Laubwerk empor. Auf dem Thür-
sturze sind in plumpen, barbarischen Zügen die
Symbole der vier Evangelisten angebracht, in
der Mitte die aus den Wolken des Himmels
hervorragende Hand Gottes, griechisch segnend.
Auf der schmalen Leiste über den Figuren
kündet eine Inschrift {„Joannes de Venetia nie
fecit") den Namen des „Künstlers". Zu Seiten
des Portals befinden sich, in die Wand einge-
lassen, zwei schmale Marmorplatten, in schlechter
Schrift Dedikationsformeln enthaltend. Weiter