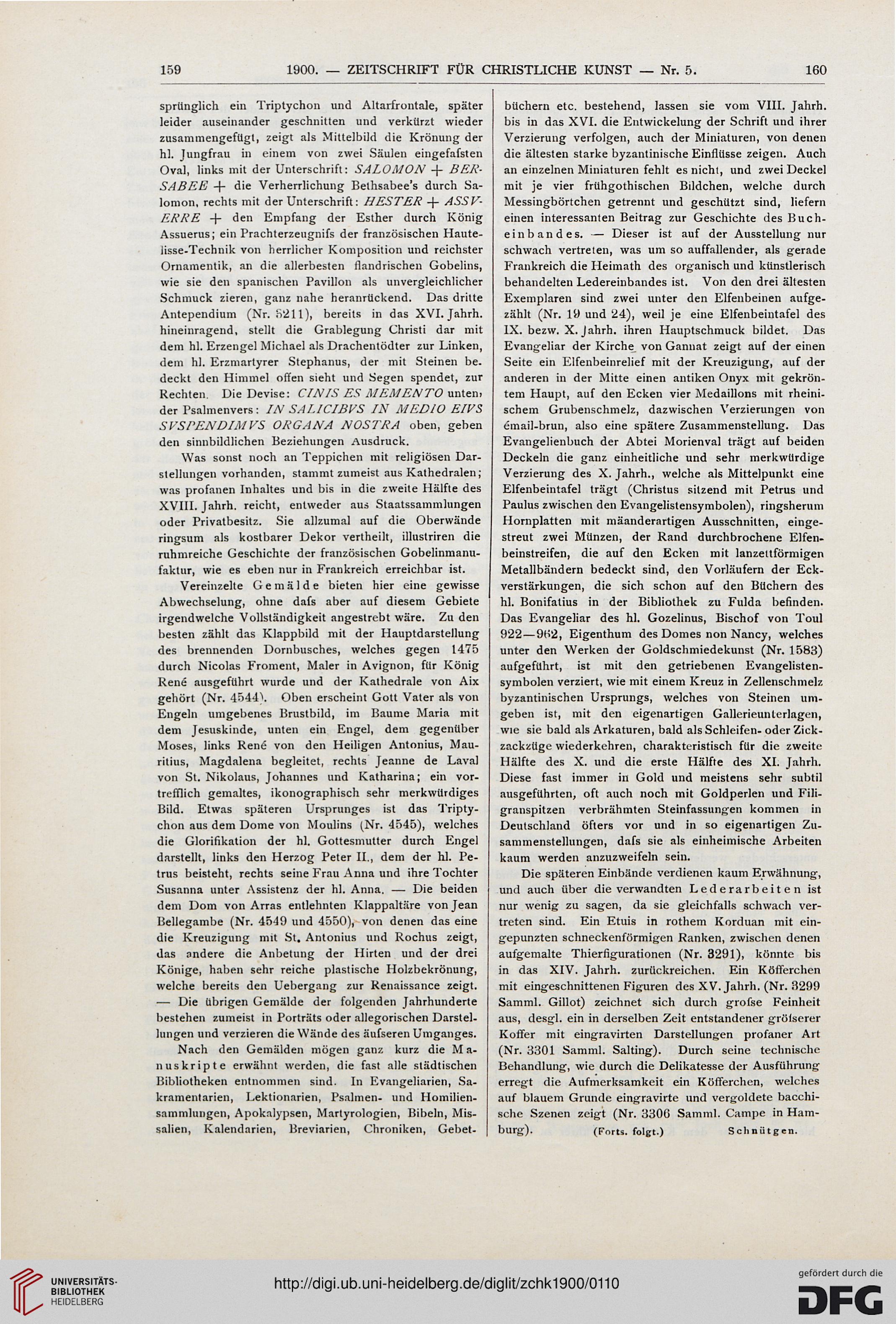159
1900. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
160
sprünglich ein Triptychon und Altarfrontale, später
leider auseinander geschnitten und verkürzt wieder
zusammengefügt, zeigt als Mittelbild die Krönung der
hl. Jungfrau in einem von zwei Säulen eingefafsten
Oval, links mit der Unterschrift: SALOMON + BER-
SABEE -4- die Verherrlichung Belhsabee's durch Sa-
lomon, rechts mit der Unterschrift: HESTER + ASSV-
ERRE -f- den Empfang der Esther durch König
Assuerus; ein Prachterzeugnifs der französischen Haute-
lisse-Technik von herrlicher Komposition und reichster
Ornamentik, an die allerbesten flandrischen Gobelins,
wie sie den spanischen Pavillon als unvergleichlicher
Schmuck zieren, ganz nahe heranrückend. Das dritte
Antependium (Nr. B211), bereits in das XVI. Jahrh.
hineinragend, stellt die Grablegung Christi dar mit
dem hl. Erzengel Michael als Drachentödter zur Linken,
dem hl. Erzmartyrer Stephanus, der mit Steinen be.
deckt den Himmel offen sieht und Segen spendet, zur
Rechten. Die Devise: CIN/S ES MEMENTO unten.
der Psalmenvers: IN SAI.ICIBVS IN MEDIO EIVS
SVSPENDIMVS ORGANA NOSTRA oben, geben
den sinnbildlichen Beziehungen Ausdruck.
Was sonst noch an Teppichen mit religiösen Dar-
stellungen vorhanden, stammt zumeist aus Kathedralen;
was profanen Inhaltes und bis in die zweite Hälfte des
XVIII. Jahrh. reicht, entweder aus Staatssammlungen
oder Privatbesitz. Sie allzumal auf die Oberwände
ringsum als kostbarer Dekor vertheilt, illustriren die
ruhmreiche Geschichte der französischen Gobelinmanu-
faktur, wie es eben nur in Frankreich erreichbar ist.
Vereinzelte Gemälde bieten hier eine gewisse
Abwechselung, ohne dafs aber auf diesem Gebiete
irgendwelche Vollständigkeit angestrebt wäre. Zu den
besten zählt das Klappbild mit der Hauptdarstellung
des brennenden Dornbusches, welches gegen 1475
durch Nicolas Froment, Maler in Avignon, für König
Rene ausgeführt wurde und der Kathedrale von Aix
gehört (Nr. 4544\ Oben erscheint Gott Vater als von
Engeln umgebenes Brustbild, im Baume Maria mit
dem Jesuskinde, unten ein Engel, dem gegenüber
Moses, links Rene von den Heiligen Antonius, Mau-
ritius, Magdalena begleitet, rechts Jeanne de Laval
von St. Nikolaus, Johannes und Katharina; ein vor-
trefflich gemaltes, ikonographisch sehr merkwürdiges
Bild. Etwas späteren Ursprunges ist das Tripty-
chon aus dem Dome von Moulins (Nr. 4545), welches
die Glorifikation der hl. Gottesmutter durch Engel
darstellt, links den Herzog Peter II., dem der hl. Pe-
trus beisteht, rechts seine Frau Anna und ihre Tochter
Susanna unter Assistenz der hl. Anna. — Die beiden
dem Dom von Arras entlehnten Klappaltäre von Jean
Bellegambe (Nr. 4549 und 4550), von denen das eine
die Kreuzigung mit St. Antonius und Rochus zeigt,
das andere die Anbetung der Hirten und der drei
Könige, haben sehr reiche plastische Holzbekrönung,
welche bereits den Uebergang zur Renaissance zeigt.
— Die übrigen Gemälde der folgenden Jahrhunderte
bestehen zumeist in Porträts oder allegorischen Darstel-
lungen und verzieren die Wände des äufseren Umganges.
Nach den Gemälden mögen ganz kurz die M a-
nuskripte erwähnt werden, die fast alle städtischen
Bibliotheken entnommen sind. In Evangeliarien, Sa-
kramentarien, Lektionarien, Psalmen- und Homilien-
sammlungen, Apokalypsen, Martyrologien, Bibeln, Mis-
salien, Kaiendarien, Breviarien, Chroniken, Gebet-
büchern etc. bestehend, lassen sie vom VIII. Jahrh.
bis in das XVI. die Entwickelung der Schrift und ihrer
Verzierung verfolgen, auch der Miniaturen, von denen
die ältesten starke byzantinische Einflüsse zeigen. Auch
an einzelnen Miniaturen fehlt es nicht, und zwei Deckel
mit je vier frühgothischen Bildchen, welche durch
Messingbörtchen getrennt und geschützt sind, liefern
einen interessanten Beitrag zur Geschichte des Buch-
einbandes. — Dieser ist auf der Ausstellung nur
schwach vertrelen, was um so auffallender, als gerade
Frankreich die Heimath des organisch und künstlerisch
behandelten Ledereinbandes ist. Von den drei ältesten
Exemplaren sind zwei unter den Elfenbeinen aufge-
zählt (Nr. 19 und 24), weil je eine Elfenbeintafel des
IX. bezw. X. Jahrh. ihren Hauptschmuck bildet. Das
Evangeliar der Kirche von Gannat zeigt auf der einen
Seite ein Elfenbeinrelief mit der Kreuzigung, auf der
anderen in der Mitte einen antiken Onyx mit gekrön-
tem Haupt, auf den Ecken vier Medaillons mit rheini-
schem Grubenschmelz, dazwischen Verzierungen von
email-brun, also eine spätere Zusammenstellung. Das
Evangelienbuch der Abtei Morienval trägt auf beiden
Deckeln die ganz einheitliche und sehr merkwürdige
Verzierung des X. Jahrh., welche als Mittelpunkt eine
Elfenbeintafel trägt (Christus sitzend mit Petrus und
Paulus zwischen den Evangelistensymbolen), ringsherum
Hornplatten mit mäanderartigen Ausschnitten, einge-
streut zwei Münzen, der Rand durchbrochene Elfen-
beinstreifen, die auf den Ecken mit lanzettförmigen
Metallbändern bedeckt sind, den Vorläufern der Eck-
verstärkungen, die sich schon auf den Büchern des
hl. Bonifatius in der Bibliothek zu Fulda befinden.
Das Evangeliar des hl. Gozelinus, Bischof von Toul
922—9H2, Eigenthum des Domes non Nancy, welches
unter den Werken der Goldschmiedekunst (Nr. 1583)
aufgeführt, ist mit den getriebenen Evangelisten-
symbolen verziert, wie mit einem Kreuz in Zellenschmelz
byzantinischen Ursprungs, welches von Steinen um-
geben ist, mit den eigenartigen Gallerieunlerlagen,
wie sie bald als Arkaturen, bald als Schleifen- oder Zick-
zackzüge wiederkehren, charakteristisch für die zweite
Hälfte des X. und die erste Hälfte des XI. Jahrh.
Diese fast immer in Gold und meistens sehr subtil
ausgeführten, oft auch noch mit Goldperlen und Fili-
granspitzen verbrähmten Steinfassungen kommen in
Deutschland öfters vor und in so eigenartigen Zu-
sammenstellungen, dafs sie als einheimische Arbeiten
kaum werden anzuzweifeln sein.
Die späteren Einbände verdienen kaum Erwähnung,
und auch über die verwandten Lederarbeiten ist
nur wenig zu sagen, da sie gleichfalls schwach ver-
treten sind. Ein Etuis in rothem Korduan mit ein-
gepunzten schneckenförmigen Ranken, zwischen denen
aufgemalte Thierfigurationen (Nr. 3291), könnte bis
in das XIV. Jahrh. zurückreichen. Ein KöfTerchen
mit eingeschnittenen Figuren des XV. Jahrh. (Nr. 3299
Samml. Gillot) zeichnet sich durch grofse Feinheit
aus, desgl. ein in derselben Zeit entstandener grölserer
Koffer mit eingravirten Darstellungen profaner Art
(Nr. 3301 Samml. Salting). Durch seine technische
Behandlung, wie durch die Delikatesse der Ausführung
erregt die Aufmerksamkeit ein Köfferchen, welches
auf blauem Grunde eingravirte und vergoldete bacchi-
sche Szenen zeigt (Nr. 3300 Samml. Campe in Ham-
burg). (Forts, folgt.) Schnutgen.
1900. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 5.
160
sprünglich ein Triptychon und Altarfrontale, später
leider auseinander geschnitten und verkürzt wieder
zusammengefügt, zeigt als Mittelbild die Krönung der
hl. Jungfrau in einem von zwei Säulen eingefafsten
Oval, links mit der Unterschrift: SALOMON + BER-
SABEE -4- die Verherrlichung Belhsabee's durch Sa-
lomon, rechts mit der Unterschrift: HESTER + ASSV-
ERRE -f- den Empfang der Esther durch König
Assuerus; ein Prachterzeugnifs der französischen Haute-
lisse-Technik von herrlicher Komposition und reichster
Ornamentik, an die allerbesten flandrischen Gobelins,
wie sie den spanischen Pavillon als unvergleichlicher
Schmuck zieren, ganz nahe heranrückend. Das dritte
Antependium (Nr. B211), bereits in das XVI. Jahrh.
hineinragend, stellt die Grablegung Christi dar mit
dem hl. Erzengel Michael als Drachentödter zur Linken,
dem hl. Erzmartyrer Stephanus, der mit Steinen be.
deckt den Himmel offen sieht und Segen spendet, zur
Rechten. Die Devise: CIN/S ES MEMENTO unten.
der Psalmenvers: IN SAI.ICIBVS IN MEDIO EIVS
SVSPENDIMVS ORGANA NOSTRA oben, geben
den sinnbildlichen Beziehungen Ausdruck.
Was sonst noch an Teppichen mit religiösen Dar-
stellungen vorhanden, stammt zumeist aus Kathedralen;
was profanen Inhaltes und bis in die zweite Hälfte des
XVIII. Jahrh. reicht, entweder aus Staatssammlungen
oder Privatbesitz. Sie allzumal auf die Oberwände
ringsum als kostbarer Dekor vertheilt, illustriren die
ruhmreiche Geschichte der französischen Gobelinmanu-
faktur, wie es eben nur in Frankreich erreichbar ist.
Vereinzelte Gemälde bieten hier eine gewisse
Abwechselung, ohne dafs aber auf diesem Gebiete
irgendwelche Vollständigkeit angestrebt wäre. Zu den
besten zählt das Klappbild mit der Hauptdarstellung
des brennenden Dornbusches, welches gegen 1475
durch Nicolas Froment, Maler in Avignon, für König
Rene ausgeführt wurde und der Kathedrale von Aix
gehört (Nr. 4544\ Oben erscheint Gott Vater als von
Engeln umgebenes Brustbild, im Baume Maria mit
dem Jesuskinde, unten ein Engel, dem gegenüber
Moses, links Rene von den Heiligen Antonius, Mau-
ritius, Magdalena begleitet, rechts Jeanne de Laval
von St. Nikolaus, Johannes und Katharina; ein vor-
trefflich gemaltes, ikonographisch sehr merkwürdiges
Bild. Etwas späteren Ursprunges ist das Tripty-
chon aus dem Dome von Moulins (Nr. 4545), welches
die Glorifikation der hl. Gottesmutter durch Engel
darstellt, links den Herzog Peter II., dem der hl. Pe-
trus beisteht, rechts seine Frau Anna und ihre Tochter
Susanna unter Assistenz der hl. Anna. — Die beiden
dem Dom von Arras entlehnten Klappaltäre von Jean
Bellegambe (Nr. 4549 und 4550), von denen das eine
die Kreuzigung mit St. Antonius und Rochus zeigt,
das andere die Anbetung der Hirten und der drei
Könige, haben sehr reiche plastische Holzbekrönung,
welche bereits den Uebergang zur Renaissance zeigt.
— Die übrigen Gemälde der folgenden Jahrhunderte
bestehen zumeist in Porträts oder allegorischen Darstel-
lungen und verzieren die Wände des äufseren Umganges.
Nach den Gemälden mögen ganz kurz die M a-
nuskripte erwähnt werden, die fast alle städtischen
Bibliotheken entnommen sind. In Evangeliarien, Sa-
kramentarien, Lektionarien, Psalmen- und Homilien-
sammlungen, Apokalypsen, Martyrologien, Bibeln, Mis-
salien, Kaiendarien, Breviarien, Chroniken, Gebet-
büchern etc. bestehend, lassen sie vom VIII. Jahrh.
bis in das XVI. die Entwickelung der Schrift und ihrer
Verzierung verfolgen, auch der Miniaturen, von denen
die ältesten starke byzantinische Einflüsse zeigen. Auch
an einzelnen Miniaturen fehlt es nicht, und zwei Deckel
mit je vier frühgothischen Bildchen, welche durch
Messingbörtchen getrennt und geschützt sind, liefern
einen interessanten Beitrag zur Geschichte des Buch-
einbandes. — Dieser ist auf der Ausstellung nur
schwach vertrelen, was um so auffallender, als gerade
Frankreich die Heimath des organisch und künstlerisch
behandelten Ledereinbandes ist. Von den drei ältesten
Exemplaren sind zwei unter den Elfenbeinen aufge-
zählt (Nr. 19 und 24), weil je eine Elfenbeintafel des
IX. bezw. X. Jahrh. ihren Hauptschmuck bildet. Das
Evangeliar der Kirche von Gannat zeigt auf der einen
Seite ein Elfenbeinrelief mit der Kreuzigung, auf der
anderen in der Mitte einen antiken Onyx mit gekrön-
tem Haupt, auf den Ecken vier Medaillons mit rheini-
schem Grubenschmelz, dazwischen Verzierungen von
email-brun, also eine spätere Zusammenstellung. Das
Evangelienbuch der Abtei Morienval trägt auf beiden
Deckeln die ganz einheitliche und sehr merkwürdige
Verzierung des X. Jahrh., welche als Mittelpunkt eine
Elfenbeintafel trägt (Christus sitzend mit Petrus und
Paulus zwischen den Evangelistensymbolen), ringsherum
Hornplatten mit mäanderartigen Ausschnitten, einge-
streut zwei Münzen, der Rand durchbrochene Elfen-
beinstreifen, die auf den Ecken mit lanzettförmigen
Metallbändern bedeckt sind, den Vorläufern der Eck-
verstärkungen, die sich schon auf den Büchern des
hl. Bonifatius in der Bibliothek zu Fulda befinden.
Das Evangeliar des hl. Gozelinus, Bischof von Toul
922—9H2, Eigenthum des Domes non Nancy, welches
unter den Werken der Goldschmiedekunst (Nr. 1583)
aufgeführt, ist mit den getriebenen Evangelisten-
symbolen verziert, wie mit einem Kreuz in Zellenschmelz
byzantinischen Ursprungs, welches von Steinen um-
geben ist, mit den eigenartigen Gallerieunlerlagen,
wie sie bald als Arkaturen, bald als Schleifen- oder Zick-
zackzüge wiederkehren, charakteristisch für die zweite
Hälfte des X. und die erste Hälfte des XI. Jahrh.
Diese fast immer in Gold und meistens sehr subtil
ausgeführten, oft auch noch mit Goldperlen und Fili-
granspitzen verbrähmten Steinfassungen kommen in
Deutschland öfters vor und in so eigenartigen Zu-
sammenstellungen, dafs sie als einheimische Arbeiten
kaum werden anzuzweifeln sein.
Die späteren Einbände verdienen kaum Erwähnung,
und auch über die verwandten Lederarbeiten ist
nur wenig zu sagen, da sie gleichfalls schwach ver-
treten sind. Ein Etuis in rothem Korduan mit ein-
gepunzten schneckenförmigen Ranken, zwischen denen
aufgemalte Thierfigurationen (Nr. 3291), könnte bis
in das XIV. Jahrh. zurückreichen. Ein KöfTerchen
mit eingeschnittenen Figuren des XV. Jahrh. (Nr. 3299
Samml. Gillot) zeichnet sich durch grofse Feinheit
aus, desgl. ein in derselben Zeit entstandener grölserer
Koffer mit eingravirten Darstellungen profaner Art
(Nr. 3301 Samml. Salting). Durch seine technische
Behandlung, wie durch die Delikatesse der Ausführung
erregt die Aufmerksamkeit ein Köfferchen, welches
auf blauem Grunde eingravirte und vergoldete bacchi-
sche Szenen zeigt (Nr. 3300 Samml. Campe in Ham-
burg). (Forts, folgt.) Schnutgen.