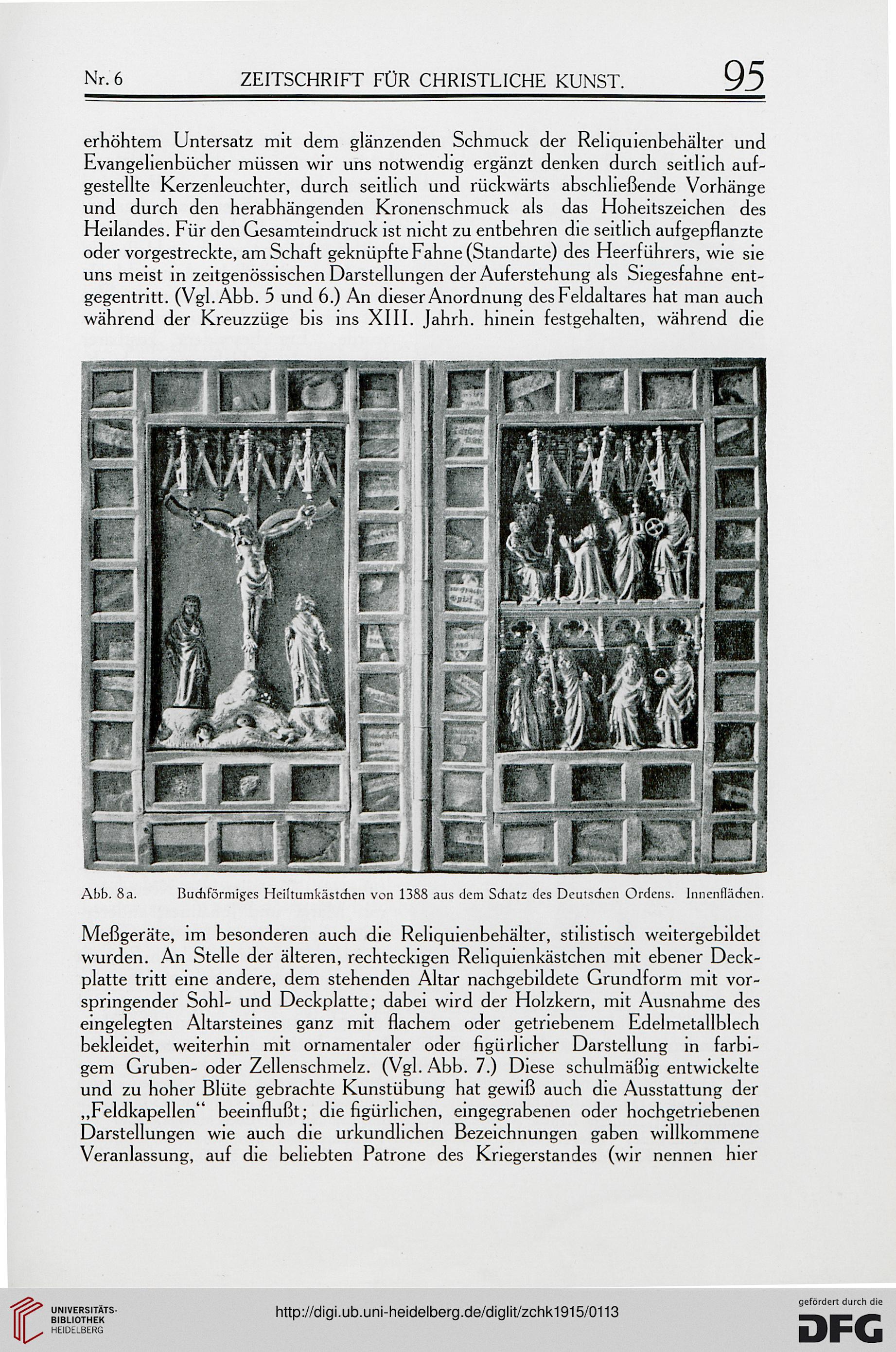Nr. 6
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
95
erhöhtem Untersatz mit dem glänzenden Schmuck der Reliquienbehälter und
Evangelienbücher müssen wir uns notwendig ergänzt denken durch seitlich auf-
gestellte Kerzenleuchter, durch seitlich und rückwärts abschließende Vorhänge
und durch den herabhängenden Kronenschmuck als das Hoheitszeichen des
Heilandes. Für den Gesamteindruck ist nicht zu entbehren die seitlich aufgepflanzte
oder vorgestreckte, am Schaft geknüpfte Fahne (Standarte) des Heerführers, wie sie
uns meist in zeitgenössischen Darstellungen der Auferstehung als Siegesfahne ent-
gegentritt. (Vgl. Abb. 5 und 6.) An dieser Anordnung des Feldaltares hat man auch
während der Kreuzzüge bis ins XIII. Jahrh. hinein festgehalten, während die
Abb. 8a.
Budiförmiges Heiltumkästdien von 1388 aus dem Schatz des Deutschen Ordens. Innenflächen.
Meßgeräte, im besonderen auch die Reliquienbehälter, stilistisch weitergebildet
wurden. An Stelle der älteren, rechteckigen Rehquienkästchen mit ebener Deck-
platte tritt eine andere, dem stehenden Altar nachgebildete Grundform mit vor-
springender Sohl- und Deckplatte; dabei wird der Holzkern, mit Ausnahme des
eingelegten Altarsteines ganz mit flachem oder getriebenem Edelmetallblech
bekleidet, weiterhin mit ornamentaler oder figürlicher Darstellung in farbi-
gem Gruben- oder Zellenschmelz. (Vgl. Abb. 7.) Diese schulmäßig entwickelte
und zu hoher Blüte gebrachte Kunstübung hat gewiß auch die Ausstattung der
„Feldkapellen" beeinflußt; die figürlichen, eingegrabenen oder hochgetriebenen
Darstellungen wie auch die urkundlichen Bezeichnungen gaben willkommene
Veranlassung, auf die beliebten Patrone des Kriegerstandes (wir nennen hier
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
95
erhöhtem Untersatz mit dem glänzenden Schmuck der Reliquienbehälter und
Evangelienbücher müssen wir uns notwendig ergänzt denken durch seitlich auf-
gestellte Kerzenleuchter, durch seitlich und rückwärts abschließende Vorhänge
und durch den herabhängenden Kronenschmuck als das Hoheitszeichen des
Heilandes. Für den Gesamteindruck ist nicht zu entbehren die seitlich aufgepflanzte
oder vorgestreckte, am Schaft geknüpfte Fahne (Standarte) des Heerführers, wie sie
uns meist in zeitgenössischen Darstellungen der Auferstehung als Siegesfahne ent-
gegentritt. (Vgl. Abb. 5 und 6.) An dieser Anordnung des Feldaltares hat man auch
während der Kreuzzüge bis ins XIII. Jahrh. hinein festgehalten, während die
Abb. 8a.
Budiförmiges Heiltumkästdien von 1388 aus dem Schatz des Deutschen Ordens. Innenflächen.
Meßgeräte, im besonderen auch die Reliquienbehälter, stilistisch weitergebildet
wurden. An Stelle der älteren, rechteckigen Rehquienkästchen mit ebener Deck-
platte tritt eine andere, dem stehenden Altar nachgebildete Grundform mit vor-
springender Sohl- und Deckplatte; dabei wird der Holzkern, mit Ausnahme des
eingelegten Altarsteines ganz mit flachem oder getriebenem Edelmetallblech
bekleidet, weiterhin mit ornamentaler oder figürlicher Darstellung in farbi-
gem Gruben- oder Zellenschmelz. (Vgl. Abb. 7.) Diese schulmäßig entwickelte
und zu hoher Blüte gebrachte Kunstübung hat gewiß auch die Ausstattung der
„Feldkapellen" beeinflußt; die figürlichen, eingegrabenen oder hochgetriebenen
Darstellungen wie auch die urkundlichen Bezeichnungen gaben willkommene
Veranlassung, auf die beliebten Patrone des Kriegerstandes (wir nennen hier