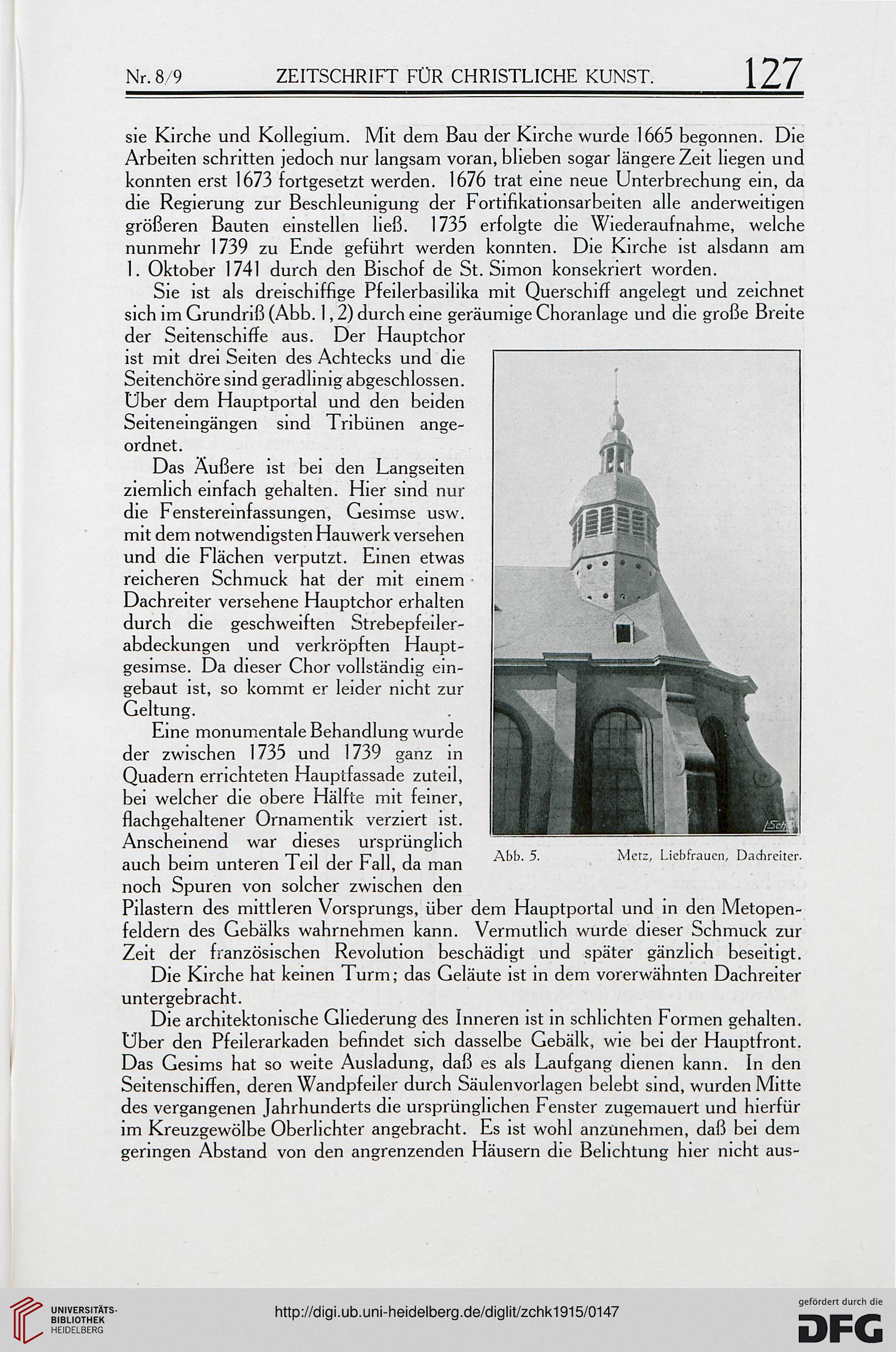Nr. 8 9
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
127
sie Kirche und Kollegium. Mit dem Bau der Kirche wurde 1665 begonnen. Die
Arbeiten schritten jedoch nur langsam voran, blieben sogar längere Zeit liegen und
konnten erst 1673 fortgesetzt werden. 1676 trat eine neue Unterbrechung ein, da
die Regierung zur Beschleunigung der Fortifikationsarbeiten alle anderweitigen
größeren Bauten einstellen ließ. 1735 erfolgte die Wiederaufnahme, welche
nunmehr 1739 zu Ende geführt werden konnten. Die Kirche ist alsdann am
1. Oktober 1741 durch den Bischof de St. Simon konseknert worden.
Sie ist als dreischiffige Pfeilerbasihka mit Querschiff angelegt und zeichnet
sich im Grundriß (Abb. 1, 2) durch eine geräumige Choranlage und die große Breite
der Seitenschiffe aus. Der Hauptchor
ist mit drei Seiten des Achtecks und die
Seitenchöre sind geradlinig abgeschlossen.
Über dem Hauptportal und den beiden
Seiteneingängen sind Tribünen ange-
ordnet.
Das Äußere ist bei den Langseiten
ziemlich einfach gehalten. Hier sind nur
die Fenstereinfassungen, Gesimse usw.
mit dem notwendigsten Hauwerk versehen
und die Flächen verputzt. Einen etwas
reicheren Schmuck hat der mit einem
Dachreiter versehene Hauptchor erhalten
durch die geschweiften Strebepfeiler-
abdeckungen und verkröpften Haupt-
gesimse. Da dieser Chor vollständig ein-
gebaut ist, so kommt er leider nicht zur
Geltung.
Eine monumentale Behandlung wurde
der zwischen 1735 und 1739 ganz in
Quadern errichteten Hauptfassade zuteil,
bei welcher die obere Hälfte mit feiner,
flachgehaltener Ornamentik verziert ist.
Anscheinend war dieses ursprünglich
auch beim unteren Teil der Fall, da man
noch Spuren von solcher zwischen den
Pilastern des mittleren Vorsprungs, über dem Hauptportal und in den Metopen-
feldern des Gebälks wahrnehmen kann. Vermutlich wurde dieser Schmuck zur
Zeit der französischen Revolution beschädigt und später gänzlich beseitigt.
Die Kirche hat keinen Turm; das Geläute ist in dem vorerwähnten Dachreiter
untergebracht.
Die architektonische Gliederung des Inneren ist in schlichten Formen gehalten.
Über den Pfeilerarkaden befindet sich dasselbe Gebälk, wie bei der Hauptfront.
Das Gesims hat so weite Ausladung, daß es als Laufgang dienen kann. In den
Seitenschiffen, deren Wandpfeiler durch Säulenvorlagen belebt sind, wurden Mitte
des vergangenen Jahrhunderts die ursprünglichen Fenster zugemauert und hierfür
im Kreuzgewölbe Oberlichter angebracht. Es ist wohl anzunehmen, daß bei dem
geringen Abstand von den angrenzenden Häusern die Belichtung hier nicht aus-
Abb. 5.
Metz, Liebfraucn, Dachreiter.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
127
sie Kirche und Kollegium. Mit dem Bau der Kirche wurde 1665 begonnen. Die
Arbeiten schritten jedoch nur langsam voran, blieben sogar längere Zeit liegen und
konnten erst 1673 fortgesetzt werden. 1676 trat eine neue Unterbrechung ein, da
die Regierung zur Beschleunigung der Fortifikationsarbeiten alle anderweitigen
größeren Bauten einstellen ließ. 1735 erfolgte die Wiederaufnahme, welche
nunmehr 1739 zu Ende geführt werden konnten. Die Kirche ist alsdann am
1. Oktober 1741 durch den Bischof de St. Simon konseknert worden.
Sie ist als dreischiffige Pfeilerbasihka mit Querschiff angelegt und zeichnet
sich im Grundriß (Abb. 1, 2) durch eine geräumige Choranlage und die große Breite
der Seitenschiffe aus. Der Hauptchor
ist mit drei Seiten des Achtecks und die
Seitenchöre sind geradlinig abgeschlossen.
Über dem Hauptportal und den beiden
Seiteneingängen sind Tribünen ange-
ordnet.
Das Äußere ist bei den Langseiten
ziemlich einfach gehalten. Hier sind nur
die Fenstereinfassungen, Gesimse usw.
mit dem notwendigsten Hauwerk versehen
und die Flächen verputzt. Einen etwas
reicheren Schmuck hat der mit einem
Dachreiter versehene Hauptchor erhalten
durch die geschweiften Strebepfeiler-
abdeckungen und verkröpften Haupt-
gesimse. Da dieser Chor vollständig ein-
gebaut ist, so kommt er leider nicht zur
Geltung.
Eine monumentale Behandlung wurde
der zwischen 1735 und 1739 ganz in
Quadern errichteten Hauptfassade zuteil,
bei welcher die obere Hälfte mit feiner,
flachgehaltener Ornamentik verziert ist.
Anscheinend war dieses ursprünglich
auch beim unteren Teil der Fall, da man
noch Spuren von solcher zwischen den
Pilastern des mittleren Vorsprungs, über dem Hauptportal und in den Metopen-
feldern des Gebälks wahrnehmen kann. Vermutlich wurde dieser Schmuck zur
Zeit der französischen Revolution beschädigt und später gänzlich beseitigt.
Die Kirche hat keinen Turm; das Geläute ist in dem vorerwähnten Dachreiter
untergebracht.
Die architektonische Gliederung des Inneren ist in schlichten Formen gehalten.
Über den Pfeilerarkaden befindet sich dasselbe Gebälk, wie bei der Hauptfront.
Das Gesims hat so weite Ausladung, daß es als Laufgang dienen kann. In den
Seitenschiffen, deren Wandpfeiler durch Säulenvorlagen belebt sind, wurden Mitte
des vergangenen Jahrhunderts die ursprünglichen Fenster zugemauert und hierfür
im Kreuzgewölbe Oberlichter angebracht. Es ist wohl anzunehmen, daß bei dem
geringen Abstand von den angrenzenden Häusern die Belichtung hier nicht aus-
Abb. 5.
Metz, Liebfraucn, Dachreiter.