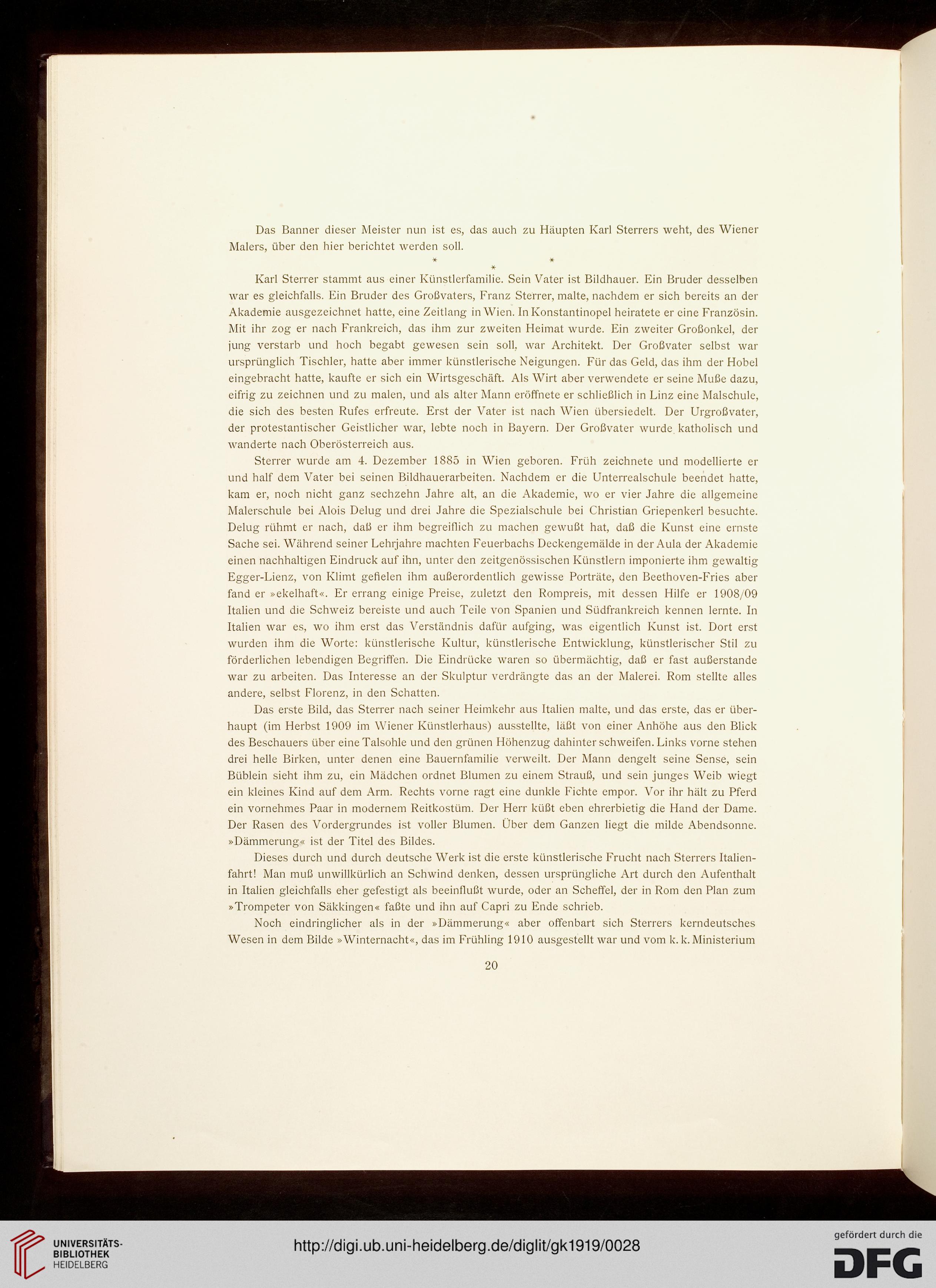Das Banner dieser Meister nun ist es, das auch zu Häupten Karl Sterrers weht, des Wiener
Malers, über den hier berichtet werden soll.
Karl Sterrer stammt aus einer Künstlerfamilie. Sein Vater ist Bildhauer. Ein Bruder desselben
war es gleichfalls. Ein Bruder des Großvaters, Franz Sterrer, malte, nachdem er sich bereits an der
Akademie ausgezeichnet hatte, eine Zeitlang in Wien. In Konstantinopel heiratete er eine Französin.
Mit ihr zog er nach Frankreich, das ihm zur zweiten Heimat wurde. Ein zweiter Großonkel, der
jung verstarb und hoch begabt gewesen sein soll, war Architekt. Der Großvater selbst war
ursprünglich Tischler, hatte aber immer künstlerische Neigungen. Für das Geld, das ihm der Hobel
eingebracht hatte, kaufte er sich ein Wirtsgeschäft. Als Wirt aber verwendete er seine Muße dazu,
eifrig zu zeichnen und zu malen, und als alter Mann eröffnete er schließlich in Linz eine Malschule,
die sich des besten Rufes erfreute. Erst der Vater ist nach Wien übersiedelt. Der Urgroßvater,
der protestantischer Geistlicher war, lebte noch in Bayern. Der Großvater wurde katholisch und
wanderte nach Oberösterreich aus.
Sterrer wurde am 4. Dezember 1885 in Wien geboren. Früh zeichnete und modellierte er
und half dem Vater bei seinen Bildhauerarbeiten. Nachdem er die Unterrealschule beendet hatte,
kam er, noch nicht ganz sechzehn Jahre alt, an die Akademie, wo er vier Jahre die allgemeine
Malerschule bei Alois Delug und drei Jahre die Spezialschule bei Christian Griepenkerl besuchte.
Delug rühmt er nach, daß er ihm begreiflich zu machen gewußt hat, daß die Kunst eine ernste
Sache sei. Während seiner Lehrjahre machten Feuerbachs Deckengemälde in der Aula der Akademie
einen nachhaltigen Eindruck auf ihn, unter den zeitgenössischen Künstlern imponierte ihm gewaltig
Egger-Lienz, von Klimt gefielen ihm außerordentlich gewisse Porträte, den Beethoven-Fries aber
fand er »ekelhaft«. Er errang einige Preise, zuletzt den Rompreis, mit dessen Hilfe er 1908/09
Italien und die Schweiz bereiste und auch Teile von Spanien und Südfrankreich kennen lernte. In
Italien war es, wo ihm erst das Verständnis dafür aufging, was eigentlich Kunst ist. Dort erst
wurden ihm die Worte: künstlerische Kultur, künstlerische Entwicklung, künstlerischer Stil zu
förderlichen lebendigen Begriffen. Die Eindrücke waren so übermächtig, daß er fast außerstande
war zu arbeiten. Das Interesse an der Skulptur verdrängte das an der Malerei. Rom stellte alles
andere, selbst Florenz, in den Schatten.
Das erste Bild, das Sterrer nach seiner Heimkehr aus Italien malte, und das erste, das er über-
haupt (im Herbst 1909 im Wiener Künstlerhaus) ausstellte, läßt von einer Anhöhe aus den Blick
des Beschauers über eine Talsohle und den grünen Höhenzug dahinter schweifen. Links vorne stehen
drei helle Birken, unter denen eine Bauernfamilie verweilt. Der Mann dengelt seine Sense, sein
Büblein sieht ihm zu, ein Mädchen ordnet Blumen zu einem Strauß, und sein junges Weib wiegt
ein kleines Kind auf dem Arm. Rechts vorne ragt eine dunkle Fichte empor. Vor ihr hält zu Pferd
ein vornehmes Paar in modernem Reitkostüm. Der Herr küßt eben ehrerbietig die Hand der Dame.
Der Rasen des Vordergrundes ist voller Blumen. Über dem Ganzen liegt die milde Abendsonne.
»Dämmerung« ist der Titel des Bildes.
Dieses durch und durch deutsche Werk ist die erste künstlerische Frucht nach Sterrers Italien-
fahrt! Man muß unwillkürlich an Schwind denken, dessen ursprüngliche Art durch den Aufenthalt
in Italien gleichfalls eher gefestigt als beeinflußt wurde, oder an Scheffel, der in Rom den Plan zum
»Trompeter von Säkkingen« faßte und ihn auf Capri zu Ende schrieb.
Noch eindringlicher als in der »Dämmerung« aber offenbart sich Sterrers kerndeutsches
Wesen in dem Bilde »Winternacht«, das im Frühling 1910 ausgestellt war und vom k. k. Ministerium
20
Malers, über den hier berichtet werden soll.
Karl Sterrer stammt aus einer Künstlerfamilie. Sein Vater ist Bildhauer. Ein Bruder desselben
war es gleichfalls. Ein Bruder des Großvaters, Franz Sterrer, malte, nachdem er sich bereits an der
Akademie ausgezeichnet hatte, eine Zeitlang in Wien. In Konstantinopel heiratete er eine Französin.
Mit ihr zog er nach Frankreich, das ihm zur zweiten Heimat wurde. Ein zweiter Großonkel, der
jung verstarb und hoch begabt gewesen sein soll, war Architekt. Der Großvater selbst war
ursprünglich Tischler, hatte aber immer künstlerische Neigungen. Für das Geld, das ihm der Hobel
eingebracht hatte, kaufte er sich ein Wirtsgeschäft. Als Wirt aber verwendete er seine Muße dazu,
eifrig zu zeichnen und zu malen, und als alter Mann eröffnete er schließlich in Linz eine Malschule,
die sich des besten Rufes erfreute. Erst der Vater ist nach Wien übersiedelt. Der Urgroßvater,
der protestantischer Geistlicher war, lebte noch in Bayern. Der Großvater wurde katholisch und
wanderte nach Oberösterreich aus.
Sterrer wurde am 4. Dezember 1885 in Wien geboren. Früh zeichnete und modellierte er
und half dem Vater bei seinen Bildhauerarbeiten. Nachdem er die Unterrealschule beendet hatte,
kam er, noch nicht ganz sechzehn Jahre alt, an die Akademie, wo er vier Jahre die allgemeine
Malerschule bei Alois Delug und drei Jahre die Spezialschule bei Christian Griepenkerl besuchte.
Delug rühmt er nach, daß er ihm begreiflich zu machen gewußt hat, daß die Kunst eine ernste
Sache sei. Während seiner Lehrjahre machten Feuerbachs Deckengemälde in der Aula der Akademie
einen nachhaltigen Eindruck auf ihn, unter den zeitgenössischen Künstlern imponierte ihm gewaltig
Egger-Lienz, von Klimt gefielen ihm außerordentlich gewisse Porträte, den Beethoven-Fries aber
fand er »ekelhaft«. Er errang einige Preise, zuletzt den Rompreis, mit dessen Hilfe er 1908/09
Italien und die Schweiz bereiste und auch Teile von Spanien und Südfrankreich kennen lernte. In
Italien war es, wo ihm erst das Verständnis dafür aufging, was eigentlich Kunst ist. Dort erst
wurden ihm die Worte: künstlerische Kultur, künstlerische Entwicklung, künstlerischer Stil zu
förderlichen lebendigen Begriffen. Die Eindrücke waren so übermächtig, daß er fast außerstande
war zu arbeiten. Das Interesse an der Skulptur verdrängte das an der Malerei. Rom stellte alles
andere, selbst Florenz, in den Schatten.
Das erste Bild, das Sterrer nach seiner Heimkehr aus Italien malte, und das erste, das er über-
haupt (im Herbst 1909 im Wiener Künstlerhaus) ausstellte, läßt von einer Anhöhe aus den Blick
des Beschauers über eine Talsohle und den grünen Höhenzug dahinter schweifen. Links vorne stehen
drei helle Birken, unter denen eine Bauernfamilie verweilt. Der Mann dengelt seine Sense, sein
Büblein sieht ihm zu, ein Mädchen ordnet Blumen zu einem Strauß, und sein junges Weib wiegt
ein kleines Kind auf dem Arm. Rechts vorne ragt eine dunkle Fichte empor. Vor ihr hält zu Pferd
ein vornehmes Paar in modernem Reitkostüm. Der Herr küßt eben ehrerbietig die Hand der Dame.
Der Rasen des Vordergrundes ist voller Blumen. Über dem Ganzen liegt die milde Abendsonne.
»Dämmerung« ist der Titel des Bildes.
Dieses durch und durch deutsche Werk ist die erste künstlerische Frucht nach Sterrers Italien-
fahrt! Man muß unwillkürlich an Schwind denken, dessen ursprüngliche Art durch den Aufenthalt
in Italien gleichfalls eher gefestigt als beeinflußt wurde, oder an Scheffel, der in Rom den Plan zum
»Trompeter von Säkkingen« faßte und ihn auf Capri zu Ende schrieb.
Noch eindringlicher als in der »Dämmerung« aber offenbart sich Sterrers kerndeutsches
Wesen in dem Bilde »Winternacht«, das im Frühling 1910 ausgestellt war und vom k. k. Ministerium
20